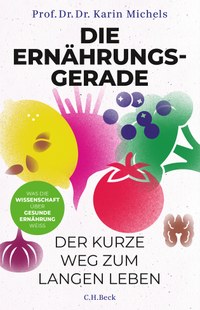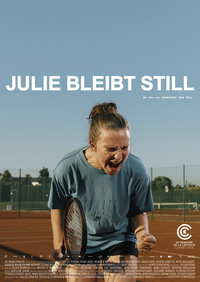Wer ist der Mann, der am 18. März der 11. Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland werden soll. Ein Gepeinigter durch das SED-Regime, der früh Repression und Unfreiheit zu spüren bekam. Rasch wurde die Freiheit sein Lebensthema, dabei verlor er jedes Maß zwischen Freiheit und Solidarität, da er Freiheit nur noch als einheitliches, allumfassendes begreifen kann. Für die Komplexität der Gesellschaft im 21. Jahrhundert ist das ungenügend.
Freiheit, Freiheit, Freiheit!
Schon bei seiner ersten Kandidatur im Juni 2010 wurde klar, wie stark die Freiheit Joachim Gaucks Wirken beeinflusst, ja sein Leben bestimmt. In Fernsehportraits genierte er sich nicht, Tränen zu lassen, wenn er an den Ort zurückkehrte, an dem er seine Kinder gen Westen hatte ziehen lassen müssen, ungewiss wann ein Wiedersehen im geteilten Deutschland möglich war.
Schon in frühester Kindheit bekam er die Macht eines Willkürsystems zu spüren, das seinen Vater 1951 mit haltlosen Beschuldigungen nach Sibirien ins Arbeitslager inhaftierte. Seine Familie blieb in völliger Unkenntnis seines Aufenhaltsortes. Die Erziehung war geprägt von der Ablehnung jeder staatlichen Obrigkeit, jeder staatlichen Einflussnahme, die im SED-Staat seine hässlichste Fratze zeigte.
Durch die frühen Erfahrungen als 11-jähriger Junge und der Prägung seines Elternhauses verschrieb sich Joachim Gauck sodann dem Widerstand gegen das SED-Regime und wurde als Pfarrer in Rostock zu einer jener vielen kleinen Zellen, die sich der propagandistisch-repressiven Gewalt der DDR nicht beugten.
Eine derartige sehr lange Unterdrückung persönlichen Freiheitsstreben, ständig auf der Hut zu sein, dem SED-Staat kein Vorwand für Eingriffsmaßnahmen zu liefern, trug bis in die Gegenwart zu einer Art Vergiftung des Geistes bei. Die Freiheit und all ihre Ableitungen wie Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit ist nicht nur Lebensthema geworden, sondern überfrachtete den Geist, um diesen ständigen Druck vor staatlichen Eingriffen eine Schutzisolierung entgegenzusetzen.
Diese Überhöhung der Freiheit, allumfassend und sakrosant und gespeist mit einer gehörigen Portion Antikommunismus, ist heute mit ein Grund dafür, dass die antikapitalistische Occupy-Bewegung als unsäglich albern bezeichnet, die Oder-Neiße-Grenze zur Disposition und Sarrazin für die Verwendung seiner bis an die Grenze gehenden "Meinungsfreiheit" von Gauck Mut attestiert wird.
Die DDR ging unter - Gauck hatte weitere 10 Jahre
In den Wendejahren 1989/1990 stürzte das Bollwerk der politischen und persönlichen Unfreiheit in sich zusammen. Auf einmal verschwand die Mauer und am 18. März 1990 gelang es die ersten allgemeinen, freien und geheimen Wahlen zur Volkskammer abzuhalten. Die von Gauck so herbeigesehnte Freiheit hatte unversehens Einzug gehalten.
Was geht nun in einem Menschen vor, der Zeit seines Lebens sein Denken, sein Begriff von der Freiheit gebraucht hatte, um in dieser falschen Welt das Leben zu organisieren. Joachim Gauck und vielen anderen Bürgerrechtlern in der DDR fehlte fortan das Feindbild, das Gegenstück zu ihrem Weltbild. Dieses Vakuum hielt zumindest für Gauck nicht lange an, der als erster Beauftragter für die Stasi-Unterlagenbehörde die ersten 10 Jahre die Aufarbeitung extensiver Überwachung der DDR-Bürger durch zum Teil der eigenen Verwandten, Freunde und Nachbarn organisierte.
Daniela Dahn weist in ihrem Artikel* aus dem Juni 2010 in der Süddeutschen Zeitung darauf hin, Joachim Gauck habe die gebotene Objektivität und Neutralität in der Erstellung der Gutachten über Stasi-Funktionäre vermissen lassen. Dieses Defizit lässt sich umso leicher erklären, wenn die Biografie und Gaucks Begriff der Freiheit in den Fokus gerückt wird.
Die absolute Subjektivität
Persönlich kann man Herrn Gauck nicht verdenken, dass sich in ihm dieses Werte- und Menschenbild gefestigt hat und dass er bei aller Berücksichtigung der Umstände gar nicht mehr in der Lage ist, das gebotene Maß an Distanz und Neutralität zu wahren.
Wenn man sich nun den Eigenschaften eines Bundespräsidenten hinwendet, drängt sich der Eindruck auf, dass Gauck trotz überwältigender Rhetorik, eines messerscharfen intellektuellen Habitus am Schluss für das Präsidentenamt ungeeignet ist.
Dies mag auf den ersten Blick verwundern, bringt er doch mannigfache Eigenschaften mit, die vermuten lassen, dass alsbald das ramponierte Image des Bundespräsidenten ---durch seinen Vorgänger hinterlassen- vergessen gemacht wird.
Aber unter Berücksichtigung Gaucks Freiheitsbildes ist jedes Maß, jede Distanz, jeder Blick für die Werte jenseits der Freiheit verloren gegangen. Alle Zustände in der Gesellschaft werden dem Paradigma der Freiheit unterworfen. In Zeiten einer Finanz- und Wirtschaftskrise, der zunehmenden Verelendung und Ausgrenzung einer breiten Schicht durch den freiheitlichen Kapitalismus, ist in der Tat die Solidarität viel stärker in Gefahr verloren zu gehen, als das Grundmaß der persönlichen Freiheit. Während die Bundeskanzlerin in der Krise durchaus dem Staatsinterventionismus nicht vollkommen abgeneigt ist, wäre für Gauck die bloße Vorstellung darüber, ein Verrat an seinem eigenen Werte- und Menschenbild.
Gauck ist als künftiger Bundespräsident zum Umdenken verpflichtet
Joachim Gauck wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit am 18.03.2012 zum 11. Bundespräsidenten gewählt werden. Er ist dann 72 Jahre alt. Ihm wächst fortan die Aufgabe zu, für die gesamte Gesellschaft eine integrierende Funktion zu entfalten. Er muss sich einem Paradigmenwechsel zuwenden und öffnen, der sich von seinem starren Freiheitsbegriff abwendet.
Dieser Freiheitsbegriff kann keine hinreichenden Antworten auf die komplexen Probleme einer Gesellschaft im 21. Jahrhundert mehr finden und funktionierte allenfalls als Schutzmechanismus für den Repressionsapparat zwischen 1945 und 1990.
Wenn es Herrn Gauck nicht gelingt, sich selbst zu öffnen, um den Problemen der Gesellschaft, aller in Deuschland lebenden Menschen zu begegnen, werden die nächsten 5-10 Jahre verlorene Jahre auf der Suche nach Orientierung, Zusammenhalt und der Definition von Freiheit und Solidarität im 21. Jahrhundert.
Sein starres Bild von der ganzheitlichen Freiheit trug ihn durch die bitteren Jahre zwischen 1945 bis 1990. Für das 21. Jahrhundert taugt dieses Freiheitsbild freilich nicht mehr.
Der intellektuelle Habitus erlaubt es Joachim Gauck diese notwendige Analyse nachzuvollziehen, er muss nur noch über seinen zugegebenermaßen sehr großen biografischen Schatten springen.
Das Amt und der zu leistende Amtseid verlangen diesen Schritt.
*)= http://www.sueddeutsche.de/politik/praesidentschaftskandidat-joachim-gauck- gespalten-statt-versoehnt-1.956510