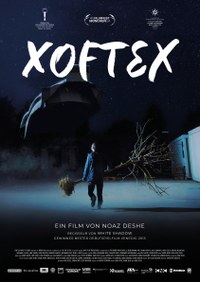Ich stimme Deniz Utlu zu, dass "Migrationshintergrund" ein problematischer Begriff ist. Er ist unscharf (in der Tat: ein Philipp Rösler hat keinen "Migrationshintergrund") und er meint in der Regel eine bestimmte Gruppe: jungen Männer, deren Eltern oder Grosseltern aus dem aus dem südosteuropäischen oder vorderasiatischen Raum (Türkei!) nach Deutschland eingewandert sind. Zudem wird er oft gebraucht, wenn es darum geht, soziale Probleme zu adressieren. Es wirkt dann verklemmt. Der Begriff ist ja überhaupt nur in Gebrauch gekommen, weil seine "Vorgänger" (Utlu): Gastarbeiter, Ausländer oder ausländischer Mitbürger nicht mehr akzeptabel waren. Er ist also, so sehe ich das, ein Werkzeug der politischen Korrektheit.
Nun muss das gar nicht schlecht sein. Würde sich der Begriff tatsächlich durchsetzen und in den alltäglichen Sprachgebrauch einwandern, würde zumindest ansatzweise eine historische Erfahrung mitgemeint. Aber auch darin gebe ich Deniz Utlu recht, dass der Begriff das "Migrantische von der Migrationserfahrung entkoppelt" und entzeitlicht, also quasi essentialisiert, zum Wesen einer Person macht. Was tun? Utlu ist pessimistisch: "So lange das Konstrukt des Anderen gebraucht wird und das Denken beherrscht, lassen sich beliebt viele andere Worte finden", ... die, so kann man schlussfolgern, alle auch nichts bringen.
Das "Konstrukt des Anderen": Heerscharen von sich progressiv dünkenden Studenten der Soziologie, Philosophie, Ethnologie usf. wurden damit verblendet. Ich kann es nicht mehr hören. Einerseits ist es eine Binse, dass "der Andere" ein Konstrukt ist, also schlicht von selbst nicht vorkommt, andererseits ist der Begriff bestens geeignet, dumm zu machen. Erfahrungen auszublenden, Wahrnehmungen zu leugnen, Differenzen zu unterschlagen. Ich möchte es an einem harmlosen Beispiel demonstrieren. Ich spiele Fußball in einer Freizeitgurkentruppe. Es gibt zwei große Blöcke: Ur-Deutsche und Türken, daneben Polen, Albaner, Slowaken, Schweizer. Man müsste natürlich zu jedem dieser Bezeichnungen Anführungszeichen setzten, denn der eine Türke hat einen deutschen Pass und der andere ist eigentlich ein Kurde. Usf. Aber bitte, machen wir es nicht zu kompliziert an dieser Stelle.
Nun ist es in der Tat so, dass noch der schlechteste unserer Türken technisch besser ist als der beste der Urdeutschen. Wahr ist aber auch, dass sie sehr oft einmal zu viel dribbeln, statt den sicheren Pass zu spielen, und hängen bleiben. Ganz wie es das Klischee will. Unabhängig davon, ob man diese Auffälligkeit nun den Genen meiner Mitspieler oder ihrer Sozialisation zuschreibt, ist das kein "Konstrukt" (oder doch nur in einem sehr, sehr allgemeinen und somit unnützen Sinn). Es ist eine Tatsache.
Nun ist es ja gar nicht so, dass alle Türken, die bei uns mitspielen oder mitgespielt haben, exzellente Techniker sind. Eine Regel bedeutet ja zugleich, dass es Ausnahmen gibt. Aber wahr ist auch, dass die Ausnahme ohne Regel nichts besagen könnte.
Für eine ironische Sprache
Ich kann mich sogar an einen verblüffend schlechten Techniker erinnern. Er spielte nur einmal bei uns. Keine Ahnung, wer in mitgeschleppt hat, er war einfach plötzlich da, "Hallo ich bin der Cem". Es war Cem Özedmir, und wir bemühten uns sehr, unsere Aufregung zu kaschieren und den Promi als normalen Mitspieler zu behandeln. Im übrigen kam er uns dabei schon sehr entgegen, war angenehm unprätentiös, gab gar nicht vor, gut zu spielen, stellte sich vielmehr nach einer Weile lächelnd ins zweite Glied und machte den Torhüter.
Nun mögen Spötter einwenden, dass seine bescheidenen technischen Fähigkeiten nur zeigen, wie sehr sich der Vorsitzende der Grünen schon der deutschen Mehrheitsgesellschaft angepasst hat. Für mich ist es einfach eine nette Anekdote, die ich bei passender Gelegenheit zum Besten geben kann. Eine kleine, je nach Rahmen ausbaufähige Erzählung, die etwas über meine, und bei größerem Ausbau vielleicht sogar etwas über unsere Wirklichkeit sagen könnte. Es gibt keine politische korrekte Sprache für diese Erzählung. Ich müsste sie, würde ich sie hier ausbauen, mit Behelfsbegriffen anreichern. Ich könnte diese Begriffe nur ironisch einsetzen. So wie das meine türkischen Mitspieler selbst tun, wenn sie auf ihren "Migrationshintergrund" verweisen. Vielleicht wird es in ein paar Jahren der Begriff "Zuwanderungsgeschichte" sein, wie Deniz Utlu meint. Auch nicht optimal. Aber unperfekte Begriffe in Gänsefüßchen zu setzen, ist mir allemal lieber, als mit der pseudosoziologischen Keule "Konstrukt des Anderen" zu kommen.