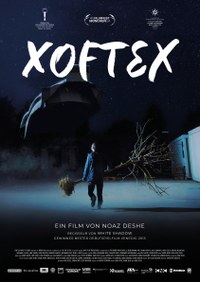Früher nahmen gestandene Linke Zeitschriften wie das Wall Street Journal oder andere Kapitalblätter nur mit spitzen Fingern zur Hand. Mal schauen, was der Feind so sagt, das war dann so die Devise. Heute muss das nicht mehr so sein. Gerade wenn es um populistische Attacken auf die Reichen geht und die Frage, was davon zu halten ist, bieten diese Blätter brauchbares Anschauungsmaterial. Für das Journal etwa schreibt auch Robert Frank. Er hat nicht nur ein Buch über die neue Reichtumskultur geschrieben (Richistan), sondern wurde eigens abgestellt, um in täglichen Kolumnen eines wealth reports den Reichen und Superreichen genau auf die Finger zu schauen. In einem aktuellen Eintrag muss er feststellen, dass die Schlagzeilen der Zeitungen voll sind mit Angriffen auf die Plutokraten, und er fragt besorgt: Are we on the verge of a class war?
Andere Länder schließen sich an. Auf der Spielwiese des Feuilletons ließ die FAZ einen bedrückten britischen Analysten zu Wort kommen, der klagte, Banker hätten in Großbritannien gerade ein Ansehen wie Kinderschänder. Das Königreich ist ungleich schwerer von der Immobilienkrise gebeutelt als Deutschland. Hierzulande halten sich die Bankvorstände imagemäßig noch auf dem Niveau von Ladendieben.
Zum Populismus gehört der Boulevard und so finden sich auch dort jetzt Anklagen wegen dreister Bonuszahlungen, mit Bild und allen Details, und wenig überraschend melden sich wieder Kritiker zu Wort, die mit guten Gründen anmerken, derlei Personalisierungen verhinderten die Analyse des Systems, das auf Grund der kanalisierten Empörung unangetastet bleibe. Das ist nicht falsch und nicht die ganze Wahrheit. Zunächst einmal hat eine Wanderung der Begriffe von der Peripherie in den Mainstream stattgefunden. Über die maßlose Gier der Wirtschaftseliten und die Korruption in Ökonomie und Politik haben vor Jahren schon Soziologen geschrieben, etwa Manuel Castells in der Netzwerkgesellschaft, oder Kevin Phillips, ehemaliger Berater des Weißen Hauses, der bereits von den achtziger Jahren als dem "Jahrzehnt der Gier" sprach. Damals galten in der Öffentlichkeit die feinen Herren Manager noch als Vorbilder. Heute ist nicht mehr zu übersehen, dass die role models von einst Gauner sind, die ihre Geschäfte im großen Stil und zum allgemeinen Schaden betrieben haben, und die trockene Erkenntnis des Theoretikers weicht der Frustration der Enttäuschten, die als Volkszorn medial inszeniert und bearbeitet wird.
Aber daraus muss nicht folgen, dass Wut und Zorn gegen Gaunerei und Gier die falschen Gefühle sind. Philipps schreibt auch, eine nachdrückliche Opposition des Volkes gegen Wirtschaftseliten, die sich selbst bedienen, ist so uramerikanisch wie der apple pie – sie ist sozusagen Alltagskultur. Als solche ist sie nicht notwendig progressiv, kann es aber sein, wenn sie in einen entsprechenden hoch- wie alltagskulturellen Kontext eingebettet ist. In diesem Fall regiert nicht das schnöde Ressentiment, sondern eine Kultur des begründeten Verdachts. Diese durchaus auch emotionale Opposition gegen die Wirtschaftseliten ist eine demokratische Tugend – wenn auch leider noch keine urdeutsche. In diesen Zusammenhang gehört auch die Forderung nach einem new new deal for the arts, nach massiven, den dreißiger Jahren vergleichbare staatliche Förderung von Kunst und Kultur, die gegenwärtig in den USA kursiert. Auch Roosevelt war ein Populist, als er seinerzeit gegen Banken und Plutokraten stänkerte, ebenso wie derzeit Obama oder wie Andrew Jackson, der Mitte des 19.Jahrhunderts meinte: "Der nächste Krieg den wir führen müssen, ist der gegen das Finanzwesen". Innerhalb einer breiten kulturellen und progressiven Bewegung hat dann auch ein altes neues Stück seine Bühne: Eat the Rich.