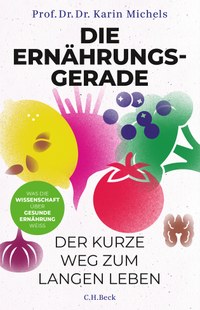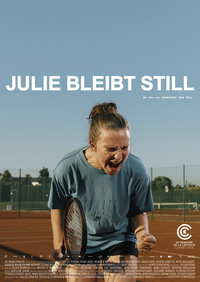Vielleicht hat es auch mit Auschwitz zu tun. Damit, dass das Ungeheure aus unseren Köpfen verschwindet. Vielleicht war es ja vor noch nicht allzu langer Zeit so: Da schlägt bei jemandem, der immer schon gerne geschrieben hat und über eine gewisse exhibitionistische Neigung verfügt, das Schicksal zu. Es wird Krebs diagnostiziert. Er denkt sich, Mist, warum muss es ausgerechnet mich treffen, es ist so ungerecht, und er hadert, flucht und weint und nimmt den Stift zur Hand. Aber dann hält ihn vielleicht doch etwas vom Schreiben ab. Etwas, das Größer ist als er, und er sagt sich, was ist schon mein kleines bescheidenes Leben dagegen, und die Scham durchdringt ihn.
Es gibt dieses Dagegen nicht mehr, es gibt keine Transzendenz mehr, die einem die eigene Endlichkeit vor Augen führte und die Nichtigkeit lehrte, und also wird in die Tasten gehauen und es entstehen so erfolgreiche Bücher wie das von Christoph Schlingensief oder Spiegel-Titel wie der aktuelle. „Gestern wollte ich wieder sterben – Spiegel-Reporter Jürgen Leinemann über sein Leben mit Krebs“ steht da in großen Lettern auf dem Umschlag, im Heft dann ein 13-seitiger Vorabdruck, der, darauf kann man wetten, als Buch (Das Leben ist der Ernstfall) ebenfalls ein Bestseller werden wird.
Nun ist es nicht so, dass dieser gern gelesene Exhibitionismus mit offenem Mantel und schmierigem Grinsen daherkommt – Leinemann verheimlicht die Schwächen, Zweifel und Nöte, die ihn seit der Entdeckung eines Zungengrund-Karzinoms heimsuchen, nicht. Verständlicherweise tut er nichts anderes, als sie zu beschreiben, aber der eine Zweifel, der fehlt: Ob man die Chose wirklich öffentlich machen musste. Ähnlich ist der Fall Schlingensief gelagert. „Ach Mann, ist das eine Kacke, so eine unendliche Kacke“, ist zurecht fast schon zum geflügelten Wort geworden, und wenn man neben ihm stünde, würde man ihn in den Arm nehmen. Aber man steht nicht neben ihm, man liest ein „Tagebuch“, das ein Fremder geschrieben hat.
„Ich war mal eine verbale Sau, aber ich bin es nicht mehr“, sagt (die, so weit bekannt, gesunde) Charlotte Roche ebenfalls im aktuellen Spiegel, ein geradezu postmodernes Geständnis. Man darf gespannt sein, wovon der angekündigte Nachfolger von Feuchtgebiete handelt. Vielleicht von der Bild-Zeitung, die sie abgrundtief hasst, weil der Erfolg des Blatts auf „Fragen wie ‚Wer ist gestorben?‘, ‚Wer hat geil Krebs?‘“ basiere.
Wer hat geil Krebs? – Fragen auf diesem Niveau mögen das Wesen der Bekenntnisliteratur unserer Tage verfehlen, und doch kann an ihnen die schlichte Tatsache aufstoßen, dass sie überhaupt geschrieben wurden. Es mag eine Leistung sein, das Publikum über seine Krankheit so zu unterrichten, dass es sich nicht langweilt, aber läge wahre Größe nicht auch hier im Verzicht? Das Problem, man könnte es die Anerkennungsfalle nennen, ist: Verzicht wird nicht belohnt. Wer beschließt, ein Buch nicht zu schreiben, weil ihn die Scham durchdringt, muss schon darauf hoffen, dass Gott anstelle des Marktes und des Publikums tritt und er auch wirklich, wie geschrieben steht, alles sieht.
Zum Glück gibt es Alternativen. Unser Vorschlag: Wenn die eigene Krankheit schon öffentlich gemacht werden muss, dann bitte mit dem Anspruch, es nicht unter dem Rang von Kunst zu machen (Merke: es könnte das letzte Werk sein!). Kunst über Krankheit zu machen, das heißt doch, blöd- und tiefsinnig zugleich zu sein, heißt, ihr ein Schnippchen schlagen. Es gibt Vorbilder, zum Beispiel die berühmten Gedichte des krebskranken, 2006 verstorbenen Robert Gernhardt. „Dialog“ heißt eines: „Gut schaust du aus!“ – „Danke! Werds meinem Krebs weitersagen. Wird ihn ärgern.“