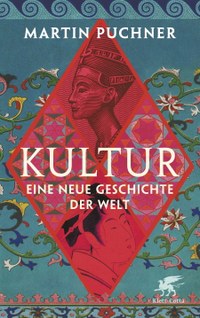Seit einiger Zeit vermittelt der Chefredakteur der Bild-Zeitung den Eindruck, dass er als cooler Hund gesehen werden möchte. So zog Kai Diekmann für einen Arte-Film mit Henryk M. Broder durch das nächtliche Berlin und wirkte stolz wie Bolle, als er sich im tiefsten Wedding als Freund und Gönner von Clemens von Wedel ausweisen konnte, einem schrägen Künstlertypen, der „wirklich so am Existenzminimum“ lebt. Aber das war quasi noch ein Anfängerfehler und hatte ungefähr das Niveau eines Hans-Olaf Henkel, der im Berlin-Mitte-Restaurant Lindenleif einmal eine halbe Stunde lang Biergläser spülte.
Professioneller war da schon Diekmanns Coup, Genossenschafter bei der tageszeitung (taz) zu werden, gegen die er in der bleiernen Zeit noch prozessiert hatte, weil ihm in einer Satire ein Problem mit seiner Männlichkeit unterstellt wurde (so genannter Penis-Vergleich). Umso cooler wirkt nun, dass er bei der taz nicht nur einfach stiller Gesellschafter ist, sondern sich mit diebischer Freude in die Basisarbeit einbringt. Über die Aktivitäten kann man sich detailliert in seinem Blog kaidiekmann.de informieren, der seit gut einer Woche online ist.
Als Leser dieses Blogs wird man Zeuge eines mentalitätsgeschichtlichen Wandels, der in seiner Tragweite gar nicht unterschätzt werden kann. kaidiekmann.de überträgt die Sprache des Pop-Boulevard in den Legitimationsdikurs der Eliten. Sehr konkret gesprochen, bedeutet das: Man darf Kai Diekmann in seinem Blog nicht nur ungestraft einen „Großkotz“ nennen, vielmehr fordert er geradezu auf, ihm in Form von kräftigen Beleidigungen den Respekt zu zollen. Verkrampft und hölzern war gestern.
Der Rest ist Formsache
Entsprechend enthält eine Selbsterklärung des Bloggers mit dem Titel „Drei Fragen an mich selbst“ einen stilsicheren Mix aus Selbsterniedrigung und Selbsterhöhung. Dabei legt „Kai“ eine entwaffnende Ehrlichkeit an den Tag, wie sie in Vor-Blogger-Zeiten dem aufgeklärt-selbstironischen Geist der Zeitschrift MAD würdig war, den schon damals nur Ignoranten für spätpubertär halten konnten: „Ich bin einfach unheilbar eitel. Deshalb halte ich es ja auch für eine gute Idee, Interviews mit mir selbst zu führen… Es geht eher um öffentliche Aberkennung. taz, Süddeutsche, Spiegel usw. bemühen sich redlich, werden mir aber einfach nicht gerecht – ich bin viel, viel schlimmer!“
Der Rest ist Formsache, etwa wenn er an den offenbar restverklemmten Kollegen von der Welt am Sonntag, Alan Posener, ein scharfes Pic von seinen beiden Vorzimmermiezen adressiert. Totale Selbstironie, totale Offenheit, totaler Triumph – und ein Sieg und eine Niederlage für seine alten Feinde zugleich. Es ist ein wenig so, als wäre der Spaßkommunarde und Situationist Dieter Kunzelmann auf seine alten Tage zum Berater von Kai Diekmann avanciert, nachdem dieser sich ja noch in seinem philosophischen Grundlagenwerk Der große Selbstbetrug skeptisch über Ziele und Methoden der Studentenrevolte geäußert hatte.
Aber keine Sorge, sofern man ihn noch für notwendig erachtet, müsste der Kampf gegen Springer heute mit völlig anderen Mitteln geführt werden. Mit all dem, was unter Achtundsechzigern wie Kunzelmann zu Unrecht als deutsche Sekundärtugenden verschrien war: mit großer Humorlosigkeit, konsequenter Rechthaberei und einer ordentlichen Frisur also. Vor allem letzteres dürfte Diekmann einen Schlag versetzen, von dem er sich so schnell nicht erholt.