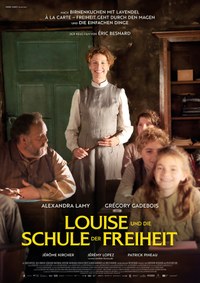Die Psychologin Birgit Rommelspacher, die an der Berliner Alice-Salomon-Fachhochschule Interkulturalität und Geschlechterstudien lehrt, hat der Frauenbewegung einen inneren Feind beschert: den „antimuslimischen Feminismus“. Seine Agentinnen, so schrieb sie in der taz, predigten eine „Essenzialisierung von Differenz“ und machten „gemeinsame Sache mit Rechten“. Namentlich klagt sie Ayaan Hirsi Ali, Necla Kelek und Seyran Ates an, weil diese den Islam „zugunsten des Christentums abschaffen“ wollten und das Scheitern des „multikulturellen Zusammenlebens“ herbeiredeten. Dass die Genannten selbst dem islamischen Kulturkreis angehören, ihre Aversion also auf reale Erfahrungen zurückzuführen sein könnte, kommt Rommelspacher nicht in den Sinn. Stattdessen schürt sie das Ressentiment gegen das „europäische Erbe“ und die „aufgeklärte Wissenschaft“, die sie für identisch mit „Kolonialismus“ und „Rassismus“ hält.
Nun wurde sie von der taz-Redakteurin Heide Oestreich verteidigt: „Anhand verschiedener historischer Beispiele verwies Rommelspacher darauf, dass die Fahne der Emanzipation auch mal in einem Wind wehen kann, der eher freiheitsfeindlich ist.“ Dieser Wind ist allerdings selbsterzeugt. Der Irrglaube, Feministinnen würden sich stets für die Sache der Frauen einsetzen, hätte lange vor Rommelspachers Auslassungen erschüttert werden müssen. Sind es doch mehrheitlich „Feministinnen“, die in ihrer Funktion als Gender- und Postkolonialismus-Forscherinnen seit Jahren Öffentlichkeitsarbeit für den Abbau von Frauenrechten betreiben. Die Auseinandersetzung mit dem Islam ist dabei nur eine ihrer Baustellen. Darüberhinaus zeigen sie Verständnis für afrikanische Beschneidungsrituale, Frauenhandel, Polygamie und sonstige Riten „fremder Kulturen“, die allein qua ihres angeblichen Fremdseins als das Bessere der „westlichen Zivilisation“ vorgestellt werden. Dieser wird dann im Gegenzug attestiert, die Ursprungsstätte frauenfeindlichen Denkens zu sein, als wären es nicht die Vereinigten Staaten und Westeuropa, wo die Frauenbewegung ihre größten Erfolge verbuchen konnte. Die Berliner Kulturwissenschaftlerinnen Christina von Braun und Bettina Mathes etwa deuten in ihrem 2007 erschienenen Buch Verschleierte Wirklichkeit das von europäischen Politikern mit guten und schlechten Argumenten geforderte Kopftuch- und Schleierverbot als Ausdruck eines Bedürfnisses nach „Penetration“. In dieselbe Richtung zielt der von der Genderforscherin Gabriele Dietze geprägte Terminus des „Political Veil“, des „politischen Schleiers“, der die Forderung nach Aufhebung des Schleierzwangs als Sehnsucht nach der Unterwerfung des Frauenkörpers unter die kapitalistische Warenlogik zu deuten versucht.
Was den postkolonialistischen Feminismus so unangenehm macht, ist aber nicht nur seine Neigung zur Psychologisiererei, sondern vor allem die Tatsache, dass muslimische Frauen in ihm gar nicht vorkommen. Gebraucht werden sie lediglich als Stichwortlieferanten, sei es als selbsterklärte „Opfer“ oder irregeleitete „Verführte“ westlichen Denkens. Anders als der Traditionsfeminismus, dessen Vertreterinnen genau wussten, für wen sie Partei zu ergreifen hatten, bewegt sich der postmoderne Feminismus damit in demselben Zirkel, den er seinen Kritikern unterstellt: Er ist eine Selbstbespieglung westlicher Akademikerinnen im Spiegel des „Anderen“, als dessen Popanz „fremde Kulturen“ herhalten müssen.