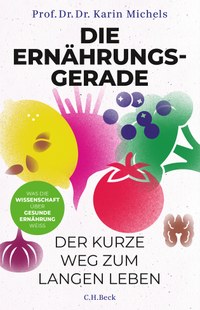Dieser Tage veröffentlichte Thomas Hettche in der FAZ einen kunstreaktionären Artikel, der die poetische Arbeit diffamiert, die im Internet erscheint. Titel: „Warum Literatur sich im Netz verfängt“. Dazu benutzt er drei die Feuilletons alldurchstapfende Thesen, kriegt freilich den Lehm von den Stiefeln nicht weg.
1. Das Internet sei nur an Klatsch interessiert und unkonzentriert; es befördere ein, nenn ich das mal, literarisches Pisa. Man sehe das an der unangemessenen Beachtung einer jungen Plagiatsautorin, der Hettche aber selbst unangemessenen Raum einräumt. Denn nicht das Netz war diskutiert, sondern ein Buch. Welchen Dietrich einer benutzt (copy oder Kuli), spielt fürs Plagiat keine Rolle, auch nicht, woraus jemand abschreibt, zumal das Phänomen – wie die Skandalgier – alt wie die Dichtung selbst ist und die Geschichte ihrer Kritik. Bis zu den jüngsten histoires de cul Catherine Millets hin drängt einem eben nicht das Netz, sondern der Buchmarkt die Beispiele auf. Auch das Netz, selbstverständlich, kennt solche Texte. Nur sind Bekenntnisse seit je eine Säule der Literatur: zu denken ist an Rousseau, an Montauk, an Erinnerung, sprich.
Was jemand schreibt, ist zweitrangig; wie er es macht, ist entscheidend. Im Netz erscheint nicht weniger Müll als im Buch, dessen Trägersubstanz, Papier, öfter noch zum Abwischen dient. Hingegen blendet Hettche, gewiss ein ehrenwerter Mann, alle poetische Netzarbeit aus, die das gefährdete Werk wieder neu fokussiert: ob des Kreises um Johannes Auer, ob Christiane Zintzens in|ad|ae|qu|at, ob Hartmut Abendscheins Bibliotheca Caelestis. Das „Unliterarische“ an deren Kunst besteht einzig darin, dass sie nicht zwischen Buchdeckel passt – ja, Hettche verschweigt sogar Jelineks Netzseiten. Es geht ihm nämlich nicht um Dichtung. Vielmehr lässt sich das literarische Netz (noch) nicht vom Markt regulieren, ja kaum überschauen. Der aber hat, nicht das Netz, die Dichtung zu „Events” umgebogen. Woran Hettche kräftig mitbiegt, seit er hinaufgebürgert ist.
2. Das Urheberrecht werde durchs Netz bedroht. Büchern freilich gestattet Hettche die Verletzung des „vom Autor bestimmten Textes”; sie soll nur auf hohem Niveau geschehen. Dem ist beizupflichten. Nur wer bestimmt die Kriterien? Auch hier sieht Hettche nicht wirklich die Dichtung, sondern seine wohlbezahlte Deutungshoheit gefährdet, weshalb er alle, die den Heidelberger Appell (zum Schutz des Urheberrechts) nicht unterschrieben haben, „keine ernstzunehmenden Schriftsteller” nennt. Das ist nicht ohne Verrat: Auch Paulus Böhmer, ein enger Freund Hettches, hat ihn nicht unterschieben. Die Polemik wischt aber auch Rainald Goetz, den Konkurrenten aus Suhrkamptagen, und Jelinek vom Tisch und Benjamin Stein.
3. Literatur im Netz befördere den Personenkult. Dieser ist ein vom Pop angetretenes Erbe aus Zeiten künstlerischer Autonomiekämpfe. Um Label zu werden, brauchte ein Baudelaire nicht, brauchten weder Pynchon noch Kracht das Netz. Es relativiert den Kult sogar, schon weil sich der Autor sich, etwa in kommentierbaren Blogs, angreifbarer macht, als ein Hettche das ertrüge: Zu offen würde benannt, was er absichern will: nicht Qualität, sondern Macht. Wäre der jungen Plagiatsautorin Roman im Netz erschienen, keine Aufferhähnin hätte nach ihm gekräht, und auch die Hettches wären bedeutungsärmer: so arm schon, wie sie es sind.
Alban Nikolai Herbst hat zahlreiche Bücher veröffentlicht, zuletzt Selzers Singen (Berlin 2010). Mit t betreibt der Grimmelshausen-Preisträger eines der meistgelesenen literarischen Weblogs im deutschen SprachraumDie Dschungel. Anderswel