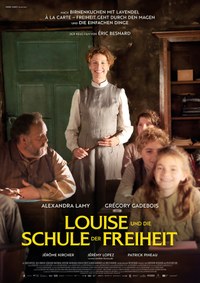Groß angekündigt, seit Montag nun also in den Buchläden: Die Politische Soziologie von Niklas Luhmann, ein Werk aus dem Nachlass, unveröffentlicht, aber nicht ungelesen zu Lebzeiten. Der Mitte der sechziger Jahren entstandene Text, so ist im editorischen Begleitwort von André Kieserling zu lesen, kursierte unter seinen Studenten. Wer nun, fast 50 Jahre später, das Suhrkamp-Buch in den Händen hält, wird dies vielfach nicht ohne nostalgische Gefühle tun. Bis weit in die neunziger Jahre konnte man kein Studium der Geistes- oder Sozialwissenschaften absolvieren, ohne sich mit Luhmann zu beschäftigen. Mehr noch, kein Student kam um die Kontroverse zwischen Bielefelder Systemtheorie und Frankfurter Schule herum.
Das waren die beiden großen Antagonisten der Suhrkamp-Kultur jener Tage: Auf der einen Seite Habermas et al. mit ihrem Streben nach Aufklärung, herrschaftsfreier Kommunikation und einer Soziologie, die sich als Wissenschaft der Kritik verstand. Auf der anderen Seite Luhmann et al. mit ihrer Rede von System und Umwelt und der Forderung nach Abklärung der Aufklärung. Irgendwie stand man in diesem Streit dazwischen. Das Herz schlug für die Frankfurter, aber der Verstand musste den Bielefeldern öfter recht geben, als einem lieb war. Vor allem aber schien der Luhmannsche Blick die Welt sehr gut zu erklären. Schuld daran war der Komplexitätsbegriff, genauer gesagt, die Weltformel von der Reduktion von Komplexität, die bis heute in Alltagszusammenhängen ihre Gültigkeit bewahrt hat: Should I stay or Should I go.
Weiteres kam bei Luhmann dazu, sein Sound etwa. Seine hoch abstrakten Texte konnten, dazu musste man nicht einmal Drogen nehmen, einem Comicstrip gleich konsumiert werden, wie Rainald Goetz einmal bemerkte. Last but not least sein lakonischer Humor. Der ehemalige Verwaltungsrechtler Luhmann blickte auf die Welt – wie ein ehemaliger Verwaltungsrechtler. Nun war für jeden Frankfurter Schüler Verwaltung ein rotes Tuch, im Kern nicht nur von Adornos Gesellschaftsphilosophie stand die Negativ-Chiffre von der „total verwalten Welt“ – das meint die Herrschaft der Mittel über die Zwecke.
Geschult wurde Adornos Blick an Kafka, aber auch Luhmann schien die Dinge dem Prager Schriftsteller ähnlich zu sehen. „Hohe Komplexität macht die Verwaltung für das Publikum undurchschaubar.“ Daraus folgt nun aber nicht, dass Verwaltung etwas ist, das man überwinden kann. Nach Luhmann ist sie Teilsystem einer Politik, die durch „bindende Entscheidungen“ Probleme löst (notwendige Komplexitätsreduktion!) und diese in geregelte Verfahren überführt (notwendige Komplexitätssteigerung). Es kann daher nicht anders sein, als dass sich der Bürger von der Verwaltung gegängelt fühlt, nicht mehr durchblickt, Frust entwickelt. „Die Verwaltung muss daher lernen, in einer Atmosphäre der uninformierten Abneigung einen modus agendi zu finden.“
Es dürfte schwierig sein, eine mildere Reflexion auf den Verwaltungsapparat zu finden als in diesem Luhmannschen Nachlasstext. Dass die Einsicht ins vermeintlich Notwendige dann doch nicht recht glücklich macht, kann man an anderen Stellen des Buchs erahnen. Etwa dort, wo Luhmann über die prekäre Legitimität des politischen Systems reflektiert und zu einer seltsam anrührenden Notiz zur DDR kommt: „Die einmalige Chance, einen Staat auf persönliche Gesinnung zu gründen, ist am 13. August 1961 aufgegeben worden.“