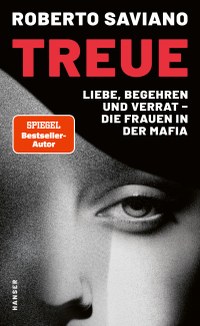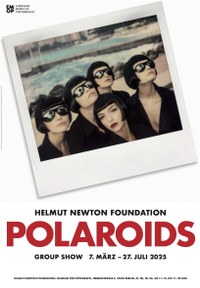Und schließlich sagt einer: „’89 habe ich mit der Therapie angefangen.“ Und das ist ein wenig irritierend, weil man „1989“ gewöhnlich nicht sagen kann, ohne irgendetwas zu den politischen Ereignissen von 1989 zu sagen. In Carolin Schmitzens Film Portraits deutscher Alkoholiker steht dieses „’89“ aber einfach so da – als Wegmarke in einer Lebensgeschichte, über die der Zuschauer wenig weiß.
Das ist ein Effekt, der den Stil von Portraits deutscher Alkoholiker gut beschreibt. Anders als der Titel nahelegt, kriegt man die sechs Protagonisten des Films nicht zu sehen, im Abspann sind ihre Namen anonymisiert. Carolin Schmitz kombiniert die Erzählungen der Süchtigen stattdessen mit Bildern deutscher Wirklichkeit: Landschaftsaufnahmen, Flughafenaufnahmen, Krankenhausaufnahmen, Kleinstadtaufnahmen.
Portraits deutscher Alkoholiker ließe sich einem, wenn man das so sagen kann, Subgenre des Dokumentarfilms zurechnen, das Birgit Kohler vom Berliner Arsenal kürzlich „Performing Documentary“ genannt hat; definiert worden wäre es von dem Film Hat Wolff von Amerongen Konkursdelikte begangen? (2004), einer detailversessenen Wirtschaftswunderschattengeschichte des früh verstorbenen Gerhard Friedl.
„Performing Documentary“ heißt, die Zweifel an der Abbildbarkeit der Welt in Abstraktion und Fragment zu verwandeln. Es geht darum, den alten Geschichten zu entkommen, den Bildern nicht zu glauben, die man immer schon vor sich sieht, wenn man nur einen Titel hört. Portraits deutscher Alkoholiker klänge dann nach Menschen, die auf Couches oder vor Bücherregalen sitzen und aus ihrem Leben erzählen. Es wäre diesen Menschen anzusehen, was die Sucht mit ihnen gemacht hat, aufgeschwemmte Gesichter, gerötete Nasenspitzen, und gleichzeitig würden sie alle von einem Standpunkt des Geläutertseins aus sprechen: das eigene Leben als Geschichte eines tiefen Falls und später Rettung oder wenigstens Stabilisierung.
Eine faszinierende Orangenentsaftungsmaschine
Carolin Schmitz verweigert sich in ihrem Film diesen Anforderungen. Die Geschichten der Sucht werden nicht personalisiert und psychologisiert – entgegen der massenmedialen Lehrmeinung, dass man die Welt über Personen und Psychologien am Besten verstehen kann. Der Film fokussiert auf die Sucht selbst, die als eine Sucht nach der Sucht erscheint: Der Großteil der Erzählungen handelt vom Heimlichkeitsmanagement, das die Trinker betrieben haben, um trinken zu können. Von Flaschen, die in Akten oder Eisenbahnplattentunneln versteckt wurden. Ein einstiger Ladenbesitzer beschreibt, wie er auf seiner Kasse immer einen Stapel Briefe liegen hatte für den Fall, dass kurz vor Ladenschluss ein Kunde käme, der ihn davon abhalten könnte, noch Alkohol zu besorgen – in diesem Fall habe er sich kurz verabschiedet unter dem Vorwand, die Geschäftspost noch einwerfen zu müssen und gleich zurück zu sein. Dass es viel einfacher gewesen wäre, den Alkohol bereits vorrätig zu haben, lässt die absurde Komplexität von Sucht erkennen.
Es ist nicht leicht, Portraits deutscher Alkoholiker zu schauen, weil Bild und Ton scheinbar eigene Sache machen. Sich dieser Zumutung auszusetzen, ist aber ein lohnendes Unterfangen, schon weil das einzige Bild, das zweimal zu sehen ist, so eindrucksvoll ist: eine faszinierende Orangenentsaftungsmaschine, die beim zweiten Mal leer läuft, weil keine Orangen mehr zur Verfügung stehen.