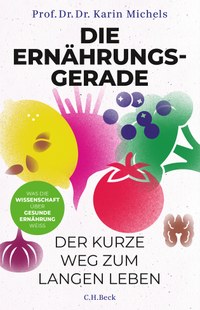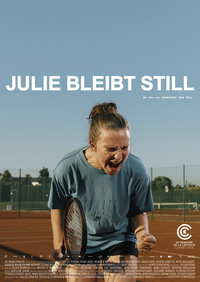Von der Existenz eines Historischen Stadtarchivs in Köln haben die meisten Leser wohl erst im Moment seiner Zerstörung erfahren. Das Archiv in der Kölner Innenstadt teilt diese traurige Berühmtheit mit der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar, die man sich auch viereinhalb Jahre nach der Katastrophe ohne die Assoziation eines Flammenmeers nur schwer vorstellen kann. Immerhin, man liest, dass von den rund 100.000 Büchern der Amalia-Bibliothek die Hälfte gerettet wurde. Das stimmt froh, aber es bedeutet eben auch, dass die andere Hälfte unwiederbringlich verloren ist.
Noch sind die Verluste des Kölner Stadtarchivs nicht genau zu beziffern, aber sicher ist, dass sie enorm sind. Schon jetzt heißt es, dass das Volumen des Schadens erheblich größer sei als beim Brand der Anna-Amalia-Bibliothek: „Wir reden hier von ungefähr 18 Regalkilometern wertvollsten Archivguts, und zwar europäischen Ranges“, sagen Experten. Das stimmt traurig. Natürlich ist das eine suspekte Trauer, die uns da befällt. Eine Art Fernstentrauer, vergleichbar der Fernstenliebe, die dem menschenscheuen Nietzsche vorschwebte und die so ziemlich alles umfasst, nur nicht das, was gerade konkret und lebendig vor einem steht.
‚Bisher hast du dich doch überhaupt nicht um dieses Archiv interessiert‘, wird man uns denn auch vorhalten, und das stimmt natürlich. Aber es trifft den Kern der Sache nicht. Unsere Trauer ist verdorbener und reiner zugleich. Sie bezeugt die schlichte, tief empfundene Wahrheit, dass einem der Wert einer Sache erst im Moment ihres Verlustes so recht bewusst wird. Belege für diesen Befund finden sich reichlich. Hat man zum Beispiel schon einmal darüber nachgedacht, warum der Nachruf zu den Gattungen des Feuilletons gehört, die kein Journalist gerne schreibt, deren Abschaffung aber vermutlich das Ende des Feuilletons, wie wir es kennen, bedeuteten würde? Eben. Und in dem Moment, wo die Feuilletons tatsächlich keine Nachrufe mehr druckten, würden wir dann auch wirklich verstanden haben, was wir an ihnen hatten.
So spricht der traurige Konservative. Das Bewahren einer Sache hat sich der Konservativismus bekanntlich schon in seinem Namen sichern lassen. Es gehört aber zu seiner Tragik, dass er immer nur das bewahren kann, was praktisch schon verloren ist. Es lässt sich daran erkennen, dass die, die besonders häufig von Werten sprechen, ebenso oft das Wort von ihrem Verfall im Munde führen. Deshalb sagt eine luzide politische Theorie, dass es einen namhaften politischen Konservativismus in der Moderne nicht mehr geben kann. Vermutlich aber ist der Konservativismus einfach eine Überforderung des Menschen, obwohl er genau das Gegenteil sein will. Aber das soll nicht unsere Sorge sein. Wir sprechen hier von einem Kulturkonservativismus. Und getrauert wird nun einmal da, wo das Herz sitzt. Man stelle sich nur einmal vor, dass das Archiv der Münchner Arbeiterbewegung in Flammen stünde. Oder dass die großartige Privatbibliothek des DDR-Philosophen Jürgen Kuczynski vernichtet worden wäre. Die Trauer wäre schier grenzenlos.
Ach so ja, fast vergessen, die rund 1.700 laufenden Meter von Kuczynskis Bibliothek befinden sich seit ein paar Jahren in der Berliner Stadt- und Landesbibliothek. Darüber haben wir auch im Freitag berichtet. Der Verfasser dieser Zeilen kennt das altehrwürdige Gebäude sogar aus eigener Anschauung. Es macht, anders als das Kölner Stadtarchiv, dessen Einsturz angeblich vorauszusehen war, einen äußerst stabilen Eindruck. Die Einsicht, dass man die Bedeutung einer Sache erst im Moment ihres Verlustes erkennt, ist natürlich kein Argument gegen das sichere Aufbewahren. Ganz im Gegenteil.