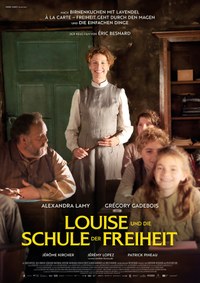Ob bei Schaeffler, Opel oder anderswo – immer wieder sind Forderungen nach einer Beteiligung der Belegschaften am Unternehmen zu hören. Wenn es nach DGB-Vorstand Dietmar Hexel ginge, würden Mitarbeiter „über den Kurs der Unternehmenspolitik deutlich mehr mitbestimmen und risikoarm am Kapital beteiligt“. Linksparteichef Oskar Lafontaine fordert, staatliche Hilfen für bedrohte Firmen nur zu gewähren, wenn im Gegenzug die Belegschaften Anteilseigner der Betriebe werden – mit bis zu 49 Prozent. Wer wie Merkel allein über Staatshilfen, aber nicht über die Demokratisierung der Firmenentscheidungen nachdenke, bleibe einer „VEB-Mentalität“ verhaftet.
Derzeit fallen Mitbestimmung und Beteiligung in der Praxis eher auseinander, als dass sie Teile eines integrierten Konzeptes sind. Bestehende Möglichkeiten der Kapitalbeteiligung für Beschäftigte gehen kaum über steuerliche Fördermodelle von Vermögensbildung hinaus und werden zudem nur selten genutzt: Lediglich in etwa zwei Prozent aller Betriebe sind Mitarbeiter am Kapital der Firma beteiligt. Wenig beachtet, weil zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, ist Mitte Februar das Mitarbeiterkapitalbeteiligungsgesetz reformiert worden. Für Beschäftigte wurde unter anderem der steuerliche Freibetrag auf 360 Euro im Jahr erhöht, zu dem sie Anteile an „ihren“ Betrieben erwerben können. Außerdem soll ein Mitarbeiterbeteiligungsfonds in das Investmentgesetz aufgenommen werden.
Zu dem Zeitpunkt, als die Diskussion über die Novelle Mitte 2007 mit dem Vorstoß des damaligen SPD-Chefs Kurt Beck zu einem „Deutschlandfonds“ begann, wähnte sich die Wirtschaft noch im Aufschwung. Von einer angemessenen Beteiligung der Belegschaften am Firmenerfolg war die Rede. Als das Gesetz Anfang 2009 abschließend im Bundestag beraten wurde, fragte sich selbst der Regierungsvertreter, ob die Änderungen angesichts der Wirtschaftskrise überhaupt auf Nachfrage stoßen. Die Grünen warnten im Parlament sogar davor, dass die Kapitalbeteiligung eher auf ein unsicheres Finanzanlageprodukt hinauslaufe, aber keinesfalls auf eine Ausweitung der Mitbestimmung. Ein neuer „Schwung für eine Beteiligungskultur“, wie die Koalition großspurig warb, ist von diesem Gesetz sicher nicht zu erwarten.