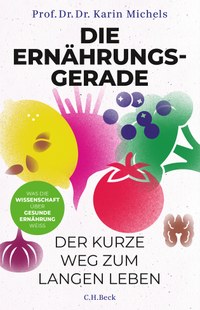Von allen Seiten lobende Worte, und im Gerichtssaal gab es Beifall, als heute der 2. Senat des Bundesgerichtshofs ein lange erwartetes Urteil zur Sterbehilfe verkündete. Der Fall, der ihm zur Entscheidung vorlag, geht auf das Jahr 2007 zurück: Die Tochter der damals 75-jährigen Erika K., die seit fünf Jahren im Wachkoma lag und in einem Pflegeheim versorgt wurde, hatte auf Anraten ihres Anwaltes Wolfgang Putz den Schlauch der Magensonde, mit dem die Patientin künstlich ernährt wurde, durchtrennt. Vorangegangen war eine längere Auseinandersetzung zwischen der Familie der Patientin und der Pflegeheimleitung, die einen schon ausgehandelten Kompromiss revidierte und anordnete, die künstliche Ernährung wieder aufzunehmen. Es sei aber, so die Tochter Elke G., der mündlich geäußerte Wunsch ihrer Mutter gewesen, in einer solchen Situation in Würde sterben zu können und nicht weiter intensivmedizinisch versorgt zu werden. Eine schriftliche Verfügung lag nicht vor.
Das Landgericht Fulda hatte Putz daraufhin zu neun Monaten Freiheitsstrafe mit Bewährung wegen versuchten gemeinschaftlichen Totschlags verurteilt. Obwohl es feststellte, dass die Heimleitung mit der Beibehaltung der Magensonde eine vorsätzliche Körperverletzung begangen habe, sah es in der eigenmächtigen Entfernung des Schlauchs eine rechtswidrige Handlung, zu der der Anwalt angestiftet habe. Putz, der in der Sterbehilfebewegung kein Unbekannter ist, brachte den Fall vor den BGH, der das Fuldaer Urteil nun kassierte und den Angeklagten freisprach.
Während das Landgericht noch auf der Grundlage vergleichbarer widersprüchlicher Entscheidungen geurteilt hatte, konnten sich die Bundesrichter inzwischen auf das Patientenverfügungsgesetz stützen, das regelt, unter welchen Voraussetzungen der Patientenwille bei Einwilligungsunfähigkeit bindend ist. Wie schon das Landgericht sehen auch die Karlsruher Richter in der Wiederaufnahme der künstlichen Ernährung einen "rechtswidrigen Angriff auf das Selbstbestimmungsrecht" der Patientin. Im Unterschied zur Ansicht der Vorinstanz, so die Richter weiter, habe sich der Anwalt durch seine Mitwirkung am Durchtrennen des Schlauches jedoch nicht strafbar gemacht. Die von den Betreuern geprüfte mündliche Verfügung der Patientin sei bindend gewesen und der Behandlungsabbruch könne nicht nur in passiver Form durch Unterlassung, sondern wie in diesem Falle auch aktiv erfolgen.
Bedeutung hat das Urteil zunächst für Ärzte, die nun Rechtssicherheit darüber haben, dass sie lebensnotwendige Maßnahmen auch dann aktiv einstellen dürfen, wenn der Sterbeprozess noch nicht irreversibel eingesetzt hat. Maßgeblich ist nur der vorab ermittelte Wille, ab welchem Zeitpunkt ein Patient nicht weiter versorgt werden will.
Was viele nun als Stärkung der Patientenautonomie feiern und Justizministerin Leutheusser-Schnarrenberger als vorwärtsweisende Entscheidung begrüßt, die das Spannungsfeld von passiver und aktiver Sterbehilfe rechtlich absichere, könnte sich für Patienten auch als Bumerang erweisen. Denn wie in anderen medizinischen Bereichen auch, so etwa in der Transplantationsmedizin, ist der nun höchstrichterlich für rechtskräftig erklärte "mutmaßliche Wille" ein höchst auslegungsfähiges Konstrukt. Und angesichts der Situation in den Heimen mag manchem ein schnelles Ableben auch humaner erscheinen als ein Weiterleben unter unwürdigen Bedingungen. Es könnte sich andererseits aber auch der gesellschaftliche Druck auf Ärzte verstärken, lange und absehbar nicht mehr "lohnende" Versorgungszeiten zu verkürzen und Ressourcen einzusparen. Wie dieser Tag in die Rechtsgeschichte eingehen wird, bleibt noch abzuwarten.