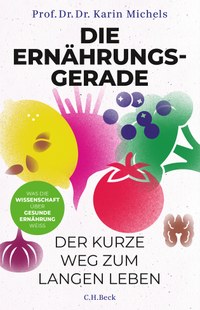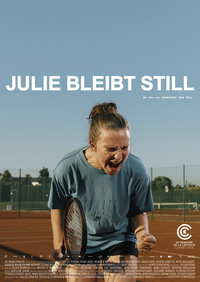Das deutsche Bildungssystem steht unter Beobachtung: Anfang dieser Woche hat das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) eine Studie zu den sprachlichen Kompetenzen der 15-Jährigen im Ländervergleich veröffentlicht. In dieser Studie schneiden Bayern und Baden-Württemberg am besten ab. Bereits vergangene Woche wurde der nationale Bildungsbericht der Kultusministerkonferenz und des Bundes vorgestellt. Beide Untersuchungen zeigen: Nach PISA ist es der Politik bislang nicht gelungen, das große Problem der sozialen Selektion durch das Bildungssystem zu lösen. Die IQB-Studie reproduziert die Ergebnisse, die auch PISA 2006 und die beiden vorangegangenen PISA-Studien lieferten: Das deutsche Schulsystem setzt auf Ausgrenzung. Und PISA hat, so scheint es, diese Ausgrenzung nur verschärft. Die „Gewinner“, Bayern und Baden-Württemberg, sieben wie kein anderes Land Kinder aus sozial benachteiligten Familien durch das rigide System aus – und klopfen sich für die damit erreichten guten Ergebnisse zufrieden selbst auf die Schultern. Kinder aus unteren sozialen Schichten haben bei ihnen bei gleich guten Leistungen eine sechs Mal geringere Chance, ein Gymnasium zu besuchen, als Kinder aus Akademiker-Familien.
Bildungsforscher erklären diesen Effekt mit einer pragmatischen Zukunftschancen-Einschätzung durch die beurteilenden Lehrerinnen und Lehrer: Die Hürden des Gymnasialweges seien für viele Schülerinnen und Schüler heute kaum noch ohne massive außerschulische Unterstützung – sei es durch die Eltern oder durch Nachhilfe – zu nehmen. Die zuständigen Politiker aber üben sich in Verschleierung solcher Ergebnisse. In der medialen Öffentlichkeit diskutieren sie nur über zwei zentrale Fragen: Wer führt den Ländervergleich an? Gibt es insgesamt eine Verbesserung? Keiner aber fragt: Auf wessen Kosten führt Sachsen in PISA, und führen Bayern und Baden-Württemberg im Sprachen-Kompetenzvergleich? Oder: Wer hat sich genau verbessert? Erst kürzlich wies das ZDF im heute journal auf die fragwürdigen Schlüsse hin, die man in Sachsen aus PISA gezogen hatte: Mehr Leistungsdruck – dann wird es schon. Und in Baden-Württemberg geht es ohne außerschulische Hilfe kaum noch: Mit 24,3 Prozent Mathe-Nachhilfe bei 15-Jährigen ist das Land Spitzenreiter in einer weiteren Kategorie. Wer sich Nachhilfe nicht leisten kann, hat Pech gehabt.
Die Politik reagiert auf PISA vor allem dadurch, Ergebnisse und Leistung noch stärker in den Mittelpunkt zu stellen: Die Kulturministerkonferenz beschloss im Jahr 2006 eine Gesamtstrategie zum Bildungsmonitoring. Das darin geforderte ergebnisorientierte Monitoring auf der Basis von Bildungsstandards bedeutet für viele Schülerinnen und Schüler noch mehr Leistungsdruck. Es wird durch Leistungsvergleichsstudien auf internationaler und nationaler Ebene geleistet: PISA und die Vergleiche des IQB. Dessen Bildungsstandards sollen alles richten. Viel Geld fließt da hinein. Das IQB ist ein Institut der Humboldt-Universität in Berlin.
Nebenan, am Institut für Erziehungswissenschaften, war ein Jahr lang die Professorenstelle für Allgemeine Pädagogik unbesetzt. Das ist symptomatisch für den Umgang mit Bildung in diesem Land: Reine Ergebnisorientierung. Alles wird auf seine Wirtschaftlichkeit hin bewertet. Humboldts Bildungsideal? Danach kräht doch kein Hahn mehr. Unter der fehlenden Besetzung der Professur an der Humboldt-Universität litten auch die Lehrveranstaltungen, in der Lehramts-Studierende die Grundlagen der Allgemeinen Pädagogik – also etwas über Kinder und ihre Entwicklung - lernen sollten, warum individuelle Förderung und die individuelle Entwicklung von Schülerinnen und Schülern wichtig sind, und wie man sie umsetzt. Und auch, warum die Separation der Schülerinnen und Schüler nach der vierten Klasse Potential und Kompetenz in brutaler Weise ignoriert und zerstört. Die Finnen haben vor 30 Jahren bereits begriffen, wieso das ein Problem ist. Sie führen in allen PISA-Studien mit herausragenden Ergebnissen. Weil sie Selektion vermeiden und das Abitur für alle anstreben. Hierzulande ist das immer noch undenkbar.
Katrin Rönicke ist Bloggerin der Mädchenmannschaft
Hintergrund:
Die Ländervergleichsstudien des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) treten an die Stelle der ehemaligen "PISA-E-Studien", in denen die Bundesländer miteinander verglichen werden. Die PISA-Studien werden von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) herausgegeben. Die Kultusministerkonferenz beschloss 2003 und 2004, als Reaktion auf die im internationalen Vergleich schlechten Ergebnisse deutscher Schülerinnen und Schüler, die Einführung von Bildungsstandards, auf deren Grundlage die Leistungen besser verglichen und kontrolliert werden sollten. Das IQB in Berlin hat diese Standards in den vergangenen Jahren entworfen und die aktuelle Studie auf dieser Basis durchgeführt.
Weiterführende Links: