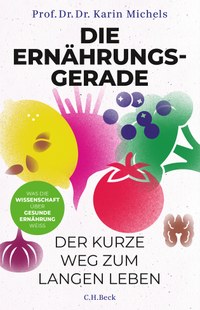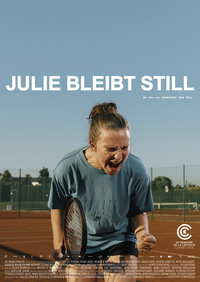Das epochale Experiment ist bis auf weiteres gestundet. Wenn die letzten US-Kampftruppen den Irak ab- und aufgeben, hat sich nicht nur George Bushs Greater Middle East erledigt. Dann ziehen auch die Architekten und Vollstrecker eines Staatsumbaus von dannen, der gescheitert ist. Im Irak wie auch in Afghanistan wurde der abenteuerliche Versuch unternommen, ein Haus vom Dach her zu bauen – sprich: einen Staat erst zu zerstören und nach den Vorstellungen der Zerstörer als Muster für eine ganze Region neu zu errichten.
Der Irak wurde zum Muster zweifellos. Aber dies in einem anderen Sinne, als seine Schöpfer glaubten. In den Hochzeiten der Anti-Terror-Hysterie und eines imperialen Messianismus wollte die Bush-Administration keinen Gedanken daran verschwenden, dass ein von ihr mutmaßlich befreites Volk diese Befreiung möglicherweise als Eroberung empfinden könnte – und die ihm zugemutete Truppenpräsenz als Besatzung. Erstaunlicherweise konnten weder in den USA noch in Westeuropa die bürgerlichen Demokratien ein Regulativ sein, geschweige denn Gegenmacht entwickeln, um eine Korrektur dieser Hybris und der ihr verwandten Selbstüberschätzung zu bewirken, bevor Hunderttausende dafür sterben mussten. Mindestens eine halbe Million Iraker haben die Intervention vom März 2003 und die anarchischen Jahre danach mit dem Leben bezahlt. Bis heute sind 4.413 Amerikaner, 180 Briten und 140 Soldaten anderer Staaten gefallen, deren Regierungen sich Anfang 2003 George Bush als willige Koalitionäre andienen wollten.
Natürlich ist das Kalkül dieses beschleunigten Disengagements eindeutig. Je mehr sich die Obama-Administration zwischen Euphrat und Tigris Entlastung verschafft, desto stärker gewinnt sie zwischen Kunduz und Kandahar an Handlungsspielraum. Es mutet fast schon grotesk an, dass der Irak-Exit in einem Augenblick forciert wird, da es in Bagdad keine handlungsfähige Regierung gibt, Instabilität und Verunsicherung vorherrschen, die sich bereits Tag für Tag in Terroranschlägen entlädt. Da die Amerikaner mindestens eine Mitverantwortung an dieser Lage zu schultern haben, wenn nicht von Schuld zu sprechen ist, müssten sie doch wenigstens mit dem operativen Teil ihres Besatzungskorps bleiben, bis ein durch sichere Mehrheit im Parlament legitimierter Premierminister regiert.
Wenn sie trotzdem gehen (50.000 Mann bleiben allerdings, und das sind alles andere als rückwärtige und Kantinen-Dienste), dann nicht aus Einsicht in das Misslingen ihrer Besatzung, sondern schlichtweg aus der Angst vor noch mehr Überforderung. Sollte der Irak noch einmal in das Inferno eines religiös aufgeladenen Bürgerkrieges driften, wären Amerikaner aller Voraussicht nach nicht als Kombattanten gebeten.