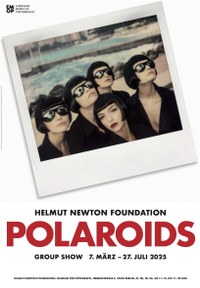Es gab schon bessere Zeiten für Datenschützer und Bürgerrechtler: Just mit der Verhaftung zweier Männer in Berlin wegen Terrorverdachts, rücken ihre Bedenken über die geplante Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung in den Hintergrund. Sicherheit geht vor. Beispielhaft zeigt sich das an dem drohenden Scheitern der Online-Petition für ein „Verbot der Vorratsdatenspeicherung“. Ein Tag vor Ablauf der dreiwöchigen Frist haben nur 30.000 Menschen die vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung (AK Vorrat) initiierte Petition mitgezeichnet. 50.000 Unterschriften dagegen wären nötigt, um sich in einer öffentlichen Sitzung des Petitionsausschusses des Bundestages angehört zu werden.
"Es sieht leider düster aus", sagt Alvar Freude. Der Netzaktivist, der unter anderem in der Enquetekommission „Internet und digitale Gesellschaft“ im Bundestag sitzt, spricht dem 14. September als inoffizielle Deadline der Petition entscheidende Bedeutung zu: „Die Petition kann zwar noch weitere drei Wochen gezeichnet werden“, sagt Freude, „doch scheitert der AK Vorrat an der ersten Hürde, dann verliert er das Anrecht, seine Forderungen im Ausschuss persönlich vortragen zu dürfen."
Vom Bundestag fordert das Bündnis aus Bürgerrechtlern und Datenschützern: Die Abgeordneten sollen keine verdachtslose Speicherung von Telefon- und Internetverbindungsdaten zulassen und die Bundesregierung auffordern, sich für eine Aufhebung der entsprechenden EU-Richtlinie sowie ein europaweites Verbot der Speicherung einzusetzen.
Petition nicht vermittelbar
Von einem Misserfolg der Petition will der AK Vorrat offiziell noch nicht sprechen: „Die Chancen stehen gut, dass wir eine ausreichende Zahl an Mitzeichnern erreichen“, sagte ein Sprecher des Bündnisses gestern. Auf der Berliner Demonstration „Freiheit statt Angst“ hätten sich noch viele Leute in die Unterschriftenlisten eingetragen. Intern aber werden bereits Zweifel hörbar: Man habe die Wichtigkeit des Themas nicht so kommunizieren können, wie ursprünglich geplant. Vielen Menschen sei nicht ersichtlich gewesen, warum sie nach der Zeichnung der Verfassungsbeschwerde 2010, bei der das Bundesverfassungsgerichts die bestehenden Regelungen zur Vorratsdatenspeicherung kippte, nun auch noch eine Petition gegen die Vorratsdatenspeicherung unterstützen sollten.
Auch ein Vergleich mit der E-Petition gegen die Internetsperren von 2009 ist aufschlussreich: Damals unterschrieben binnen dreier Tage 20.000 Menschen die Petition gegen die Sperrung von Internetseiten. Am Ende waren es beinahe 135.000. Es kam zu einer öffentlichen Anhörung, die, von den Medien aufgegriffen und weiterverbreitet, den Druck auf die politischen Entscheidungsträger erhöhte, Alternativen à la „Löschen statt Sperren“ wahrzunehmen. Zwar wurde die Gesetzesänderung für Internetsperren zunächst verabschiedet, nach weiterem Sturmlaufen der Netzaktivisten aber fallen gelassen.
Wild-West Datenschutz
Von solch einem Medien-Hype ist in diesen Tagen nichts zu spüren. Das gesellschaftliche Diskurspendel zwischen Freiheit und Sicherheit schlägt zu Gunsten Letzterem aus. Terrorverdacht in Berlin und 9/11-Mythologie sei Dank. Dabei zeigen gerade der Datenskandal von Dresden und die hemmungslose Speicherung von Verbindungsdaten durch die Provider, dass nach dem Urteil Karlsruhes rechtlicher Wild West herrscht.
Der über das Thema zerstrittenen Koalition dürfte das Aufmerksamkeitsproblem der Netz-Aktivisten indes gerade recht kommen. Kann sich Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger in den aktuellen Verhandlungen über die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung doch als letzte Bastion der Bürgerrechte inszenieren. Dass das von ihr propagierte Quick-Freeze-Verfahren vielen Datenschützern immer noch zu weit geht, fällt neben dem Hardliner-Innenminister Hans-Peter Friedrich dabei kaum ins Gewicht.