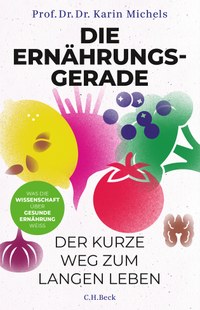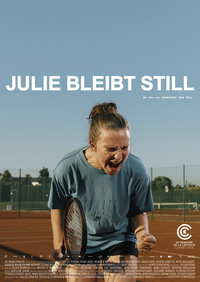Als vor über elf Jahren die ehemalige grüne Gesundheitsministerin Andrea Fischer Mediziner, Juristen und Kritiker der modernen Reproduktionstechnologie auf einem Kongress zusammenbrachte, stritten der Philosoph Ludger Honnefelder und der Reproduktionsmediziner Henning Beier darüber, ob es sich beim Embryo bloß um einen „Zellhaufen“ handele oder ihm von Anfang an ein besonderer Schutz zukomme. Mit von der Partie war auch der damals aufstrebende Bonner Neurobiologe Oliver Brüstle, der sich gerade mit einem Patent einen Namen gemacht hatte, das später als „Brüstle-Patent“ Rechtsgeschichte schreiben sollte.
Damals ging Brüstle nicht nur mit den berechtigten Heilungsinteressen von Parkinson-Patienten hausieren. Er brachte seine Forschung an den aus embryonalen Stammzellen (ES-Zellen) gewonnenen Vorläuferzellen auch als „Standortvorteil“ ein. Vermasselt wurde ihm das Geschäft allerdings durch eine Klage von Greenpeace, die vor dem Bundespatentamt die Aufhebung des Patents erwirkte. Der Rechtsstreit landete nach mehreren Instanzen schließlich vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg.
Urteil folgt Patentamt
Dieser hat 14 Jahre nach der ersten Patenterteilung nun entschieden, dass der in der Europäischen Biopatentrichtlinie zentrale Begriff des „menschlichen Embryo“ weit auszulegen sei und ES-Zellen – auch zum Zwecke der Forschung – nicht patentierbar sind. Das Potenzial, dass sich aus ihnen oder auch einer unbefruchteten Eizelle menschliches Leben entwickelt, wiege schwerer als Erfinderschutz und Forschungsfreiheit. Die Verwendung von ES-Zellen zu wissenschaftlichen Zwecken, so entschieden die Richter, sei von der anschließenden „industriellen und kommerziellen Verwertung“ nicht zu trennen. Einzig wenn diese Forschung unmittelbar dem Embryo nutzte, könne eine Ausnahme erteilt werden.
Im Kern folgt der Europäische Gerichtshof mit diesem Urteil einer wegweisenden Entscheidung des Europäischen Patentamtes von vor drei Jahren. Dieses hatte das amerikanische WARF/Thomson-Patent, bei dem es auch um die Gewinnung von ES-Zellen ging, für in Europa nicht gültig erklärt, weil es gegen die sogenannte Ordre-Public-Klausel, also gegen die guten Sitten, verstößt. Schon damals war vermutet worden, dass diese Entscheidung auch den Fall Brüstle beeinflussen würde.
Der Europäische Gerichtshof hat nun auch bekräftigt, dass Verfahren, die auf die Herstellung von Vorläuferzellen zielen und auf ES-Zellen zurückgehen, ebenfalls nicht patentiert werden können. Auf diese Weise kann das Verbot nicht durch eine geschickte Abfassung der Patentschrift umgangen werden.
Allerdings kommt das Urteil auch etwas spät. Denn längst kaprizieren sich Stammzell-Forscher nicht mehr auf die ethisch bedenklichen ES-Zellen, sondern auf die induzierten pluripotenten Stammzellen, die aus normalen Körperzellen des Menschen gewonnen werden können. Ob sie für den therapeutischen Einsatz geeignet sind, ist aber noch nicht abzusehen.
Symptomatisch ist, dass die obersten europäischen Richter betonen, „die einschlägigen Vorschriften nur juristisch“ auslegen und keinesfalls „auf Fragen medizinischer und ethischer Natur“ eingehen zu wollen. Um das Ansehen der Bioethik scheint es unter Juristen nicht gut bestellt. Daran hat sich seit dem Jahr 2000 jedenfalls nichts geändert.