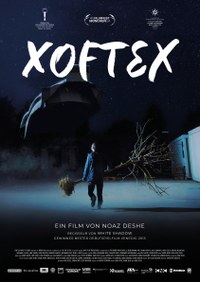Die Entscheidung des Parlaments in Athen hat viel mit Unterwerfung, noch mehr mit Nötigung, alles mit Erpressung zu tun. Nach dieser Nacht vom 12. zum 13. Februar bleibt von der parlamentarischen Demokratie in ihrer griechischen Spielart nicht etwa der berühmte Schatten ihrer selbst, sondern die Erinnerung an einen gelungenen Auftritt in Zeiten der Finanzmarkt-Autokratie. Die Mehrheit dieses Parlaments hat funktioniert, weil es funktionieren musste. Sie hat entschieden, ohne die Wahl zu haben. Vor allem, ohne eine Wahl haben zu wollen.
Wer ist der Nächste
Wie jedes Wort einen Sinn, so hat auch jede Tat ihre Täter. Vordergründig mögen das die Minister des Kabinetts Papademos und die Parlamentarier einer Regierungsmehrheit sein, die sich dem Glauben hingeben, sie hätten ihrem Staat und ihrem Volk die ultimative Rettung vor dem Bankrott beschert, quasi ein Überleben vor dem Tod. Daran mag glauben, wer die Frage ausblendet, worin die Rationalität einer solchen Rettung bestehen soll.
Mindestens ebenso kommen als Täter jene in Betracht, die sich gerade um einen Vorstoß ins postdemokratische Zeitalter verdient machen. Der Umgang mit der griechischen Exekutive und Legislative bezeugt keine Krise, sondern die Selbstaufgabe der bürgerlich-parlamentarischen Demokratie. Deren Verheißung, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, klang schon immer kühn und vermessen. Jetzt zeigt sich, sie ist offenbar weder haltbar noch zeitgemäß. In Griechenland – und nicht nur dort – geht Staatsgewalt eher vom Internationalen Bankenverband und Hedgefonds, von den Managern des Eurorettungsfonds und der EU-Troika, von den EU-Finanzministern und dem Europäischen Rat aus. Da triumphiert nicht etwa die Ökonomie über die Politik, sondern wird Politik an der Demokratie vorbei betrieben. In all diesen Instituten ballt sich politische Macht, um Finanzmacht die nächste und übernächste Chance zu geben. Besonders die EU-Troika bezeugt den politischen Willen, es privater Finanzgewalt auch künftig zu ermöglichen, Staaten und deren öffentliches Gut als Geisel zu nehmen, wenn sie als Schuldner an Bonität verlieren. Wer die Verschuldungsquoten der meisten Eurostaaten registriert, muss sich fragen, wen trifft es als Nächsten? Gibt es Alternativen außer einem kategorischen Abschied von diesem System?
Totgesagte leben länger
Um auf Griechenland zurückzukommen – kein Parlament der Welt kann guten Gewissens Maßnahmen beschließen, die Hunderttausende oder Millionen Menschen einem sozialen Abstieg preisgeben, aus dem es für die Betroffenen möglicherweise zeit ihres Lebens kein Entrinnen gibt. Man sollte sich das in einem vor Selbstgerechtigkeit strotzenden Deutschland vor Augen halten. Die Zahl von 150.000 bis 2016 zu entlassenen Staatsbediensteten ist oft genannt worden, doch auch die Renten der Pensionäre werden um 20 Prozent gekürzt wie die Mindestlöhne im Privatsektor um 22 Prozent, von 750 auf 586 Euro – für Beschäftigte unter 25 Jahren liegt die Reduktion sogar bei einem Drittel bisheriger Bezüge.
Da wird nicht nur ein soziales Dasein erzwungen, das in Armut und Depression mündet. Dieser Aderlass zeigt die Ingredienzien einer Austeritätspolitik, wie sie für den Neoliberalismus nicht typischer sein kann. Man hatte geglaubt, der sei erledigt: Wegen einer Mitverantwortung für die Weltfinanzkrise 2008 und deren Eindämmung durch staatliche Konjunkturprogramme, die dem Neoliberalismus abschworen, um nationale Ökonomien vor dem Krisensturz zu bewahren. Aber Totgesagte leben eben länger, wenn ihnen mit einer Vehemenz Leben eingehaucht wird, dass es für die Verelendung von Millionen Menschen reicht. Zu allem Überfluss suggeriert die öffentliche Meinung in Deutschland, die Griechen bekommen, was sie verdient haben. Wirksamer lässt sich dem europäischen Gedanken kaum schaden.