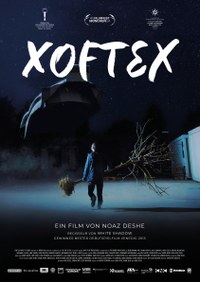Die Debatte um ein Leistungsschutzrecht für Verlage wird langsam bizarr: So viele Worte, kaum ein Ergebnis. Wenn überhaupt kann man den Streit darüber, wer an Texten im Internet Geld verdient, als Lehrbeispiel für die verderbliche Wirkung des Lobbyismus lesen. Und darüber, wie unsinnig industriepolitische Bemühungen in einem Umfeld sind, das einem dynamischen Wandel unterworfen ist.
Mehrere Jahre liegt die Politik jetzt schon im Dauerfeuer der Lobbyisten. In erster Reihe immer Springers Chefkanonier Christoph Keese. Die Unermüdlichkeit, mit der der Konzerngeschäftsführer für Public Affairs gegen das Wesen des Internets kämpft, macht ihn beinahe sympathisch. Sinnvoll wird sein Kampf dadurch freilich nicht.
Von der Bundesregierung hatten sich die Verlage eigentlich eine politische Wende erhofft. Aber außer einer Absichtserklärung im Koalitionsvertrag ist bisher nichts geschehen. Und auch die neuerliche Ankündigung des Koalitionsausschusses, nun werde bald ein Gesetz im Sinne der Medienhäuser kommen, ist so schwammig formuliert, dass man die Hilflosigkeit der Politik geradezu mit Händen greifen kann.
16 dürre Zeilen widmete die Koalition dem Thema und die sind voller Unklarheiten und Widersprüche: Allein die Unterscheidung zwischen „gewerblich“ und „privat“, die der Politikertext trifft, geht an der Realität des Netzes vorbei. Gleichwohl frohlocken die Verlage und begrüßen den Beschluss. In Wahrheit können die wolkigen Worte auch die Verlage nicht glücklich machen: Man sieht nicht, wie ein kommendes Gesetz das konzeptionelle Problem des Verlagsvorhabens lösen soll. Die Grenzen zwischen öffentlich und privat und gewerblich sind im Netz aufgelöst worden. Das bedeutet keineswegs, dass es im Netz keine Rechtsbegriffe gibt. Es bedeutet nur, dass Springers Vision eines kommerziell kontrollierten Netzes anachronistisch ist. Der Versuch der Verlage, das eigene Versagen im Netz durch die Hintertür der Politik wiedergutzumachen, ist zum Scheitern verurteilt.
Die Verteidiger des Leistungsschutzrechts haben es bis heute nicht geschafft deutlich zu machen, wo eigentlich das Problem liegt, was sie wollen und wie das umgesetzt werden kann. Sie erwecken den Eindruck, dass im Netz mit illegal kopierten Texten viel Geld verdient wird, das an den Verlagen vorbeigeht.
Erstens stimmt das nicht und zweitens verbietet das Urheberrecht das schon heute. Weil sie wissen, dass die Netznutzer der Übermacht Googles misstrauen, tarnen die Verlage in der öffentlichen Vermittlung ihren Angriff auf das Netz als Angriff auf Google. Aber selbst Google kopiert keine Texte. Es ist kurios, wie Keese und Konsorten hier gegen das Offensichtliche anrennen: Die Suchmaschine stellt Links zur Verfügung, keine Inhalte. Ein Besuch bei Google-News genügt, um die Frage abschließend zu klären. Und was den Link angeht, schreibt Keese selbst in seinem Blog: „Frei bleibt auch der Link.“
Hinter diesen Widersprüchen verbirgt sich das eigentliche Ziel der Verlage: die Kontrolle des Netzes, das sowohl der privaten als auch der öffentlich-rechtlichen Nutzung entzogen und zu einem rein kommerziellen Raum umgestaltet werden soll. Durch Druck und Wiederholung versuchen die Verlage, die Schwäche ihrer Position wettzumachen. Aber auch eine noch so willfährige Politik kann nicht dafür sorgen, dass im Netz die Flüsse aufwärts fließen und die Hasen Jäger schießen.