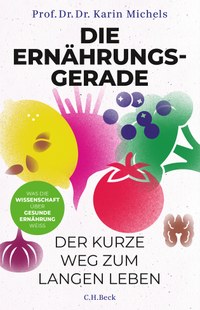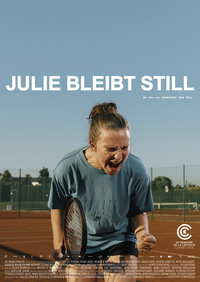So viel Lob ist Bundesrichtern selten zuteil geworden: Stärkung des Patientenwillens, mehr Rechtssicherheit – und der Spiegel befand sogar, dass es sich um ein „revolutionäres“ Urteil handelt. Wenn revolutionär umstürzend bedeutet, dann ist da sogar etwas daran. Denn der Freispruch des Rechtsanwalts Wolfgang Putz, der vom Landgericht Fulda wegen Beihilfe zum Totschlag verurteilt worden war, weil er seiner Mandantin 2007 geraten hatte, die Magensonde zu kappen, mit der ihre 75-jährige Mutter versorgt wurde, hat Signalwirkung. Er wird die Realität auf Intensivstationen und in Pflegeheimen verändern.
Die Karlsruher Richter sahen es als rechtens, dass die Tochter der Patientin dem Wunsch ihrer Muter gefolgt sei. Diese lag seit fünf Jahren im Wachkoma und soll vor ihrem Schlaganfall mündlich geäußert haben, in einer solchen Situation nicht künstlich ernährt werden zu wollen. Insofern, folgerten die Richter, habe auch der juristische Berater nicht strafbar gehandelt. Wie schon die Fuldaer Richter sah auch der BGH in der Wiederaufnahme der künstlichen Ernährung durch die Pflegeheimleitung einen „rechtswidrigen Angriff“ auf das Selbstbestimmungsrecht der betroffenen Patientin, doch im Unterschied zur Vorinstanz hatte er nicht mehr zu prüfen, unter welchen Bedingungen der Patientenwille bindend ist. Dies ist mittlerweile im Patientenverfügungsgesetz geregelt.
In drei wesentlichen Punkten stellt das Karlsruher Gericht die bisher recht widersprüchliche Urteilslandschaft klar: Es erkennt, erstens, nun auch den sehr auslegungsfähigen „mutmaßlichen Willen“ von nicht mehr äußerungsfähigen Menschen an. Es hebt, zweitens, die bisherige Abgrenzung zwischen aktiver und passiver Sterbehilfe auf. War es Ärzten bislang nur erlaubt, die Behandlung durch „Unterlassung“ zu beenden, dürfen sie nun selbst aktiv die Geräte abstellen oder die künstliche Ernährung abbrechen. Und dies auch dann – das ist der dritte Punkt –, wenn sich der Patient oder die Patientin noch nicht im irreversiblen Sterbeprozess befindet.
Wenn man so will, ist das Urteil ein Meilenstein im Kampf der medizinkritischen Bewegung, die vor über 40 Jahren begann, sich gegen Apparatemedizin und ärztlichen Paternalismus zu wehren, und Patientenautonomie forderte.
Aber Selbstbestimmung ist kontextgebunden, und unfreiwillig könnten sich deren Befürworter auch zu Erfüllungsgehilfen medizinischer Ökonomisierung machen. In den unterbesetzten Pflegeheimen, deren Zustände Verdi-Chef Frank Bsirske kürzlich mit denen in „Flüchtlingslagern“ verglich, wird schnell einmal eine Magensonde gelegt, um Abläufe zu rationalisieren.
Liefert der schriftliche oder nur „mutmaßliche“ Wille dann den Vorwand, um sich teurer Patienten zu entledigen? Viele Heimbewohner, so die Erfahrung, könnten mit Unterstützung normal ernährt werden, stünden nur mehr personelle Ressourcen bereit. Auch wenn Patientenautonomie ein hohes Anliegen ist und verteidigt werden sollte, darf das nicht zu einer Verantwortungsumkehr führen.
Wenn die Furcht vor schlechten Verhältnissen es Menschen erstrebenswerter erscheinen lässt, aus dem Leben entlassen werden zu wollen, landen wir in einer Grauzone des Humanen.
Wer will Gehilfe ökonomischen Sterbens sein?