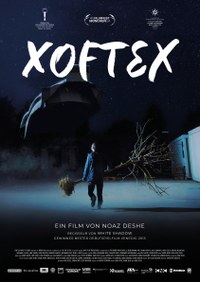Als die rot-grüne Koalition 1998 antrat, hatte sie zwar gesellschaftlichen Rückhalt. Doch die Leute mit dem Geld spielten nicht mit. In den Worten des EU-Parlamentariers Sven Giegold: „Die Investitionen gingen runter. Das war ein harter Angriff“. Zu welchen volkswirtschaftlich relevanten Maßnahmen die Wirtschaftsentscheider erst greifen werden, sollte sich 2013 die Bildung einer rot-rot-grünen Koalition abzeichnen, sendet selbst deren Befürwortern einen vorausahnenden Schauder das Rückenmark herab.
Niemand machte im „Ballhaus Ost“ in Berlin deutlicher als Giegold, wie groß der Abstand zwischen der rot-rot-grünen Idee und einem rot-rot-grünen Koalitionsvertrag im Bund noch ist. Nicht nur die Investoren stünden einer solchen Realität entgegen, sondern gegenwärtig auch das Wahlvolk. „Wir müssen uns eingestehen, dass wir für Rot-Rot-Grün eine Zustimmungsquote von 25 Prozent haben. Es ist die unbeliebteste aller Kombinationen“, erklärte der Grüne, der in seinem Vor-EU-Leben Attac-Vordenker war. Das Publikum nahms nur unter leisem Murren hin.
Der Freitag hatte zum „Salon“ geladen: „Kommt 2013 Rot-Rot-Grün?“. Mit Giegold diskutierten Linkspartei-Vizechefin Katja Kipping und der neue Juso-Vorsitzende Sascha Vogt. Freitag-Verleger Jakob Augstein moderierte vor rund 150 Zuhörern ein Gespräch, das sich nicht zum Streit entwickeln wollte, dafür aber produktiver war als mancher vergleichbare Schlagabtausch in jüngerer Zeit.
So verzichtete der erst Mitte Juni zum Juso-Chef gekürte Vogt darauf, für die SPD sofort die Führungsrolle in Anspruch zu nehmen. Giegold unternahm keinen Grünen-typischen Versuch, alle anderen für etwas beschränkt zu erklären. Kipping kam ohne SPD-Bashing aus. Dies könnte auch daran gelegen haben, dass Vogt zum Auftakt als erstes erklärte, die SPD müsse „mit einigen Projekten aus der Regierungszeit aufräumen“, nämlich Rente mit 67 sowie Hartz IV.
Womit deutlich wurde, dass im Halbrund nur solche politischen Exponenten saßen, die an einem rot-rot-grünen „Projekt“ zu arbeiten bereit und damit in ihren Parteien gegenwärtig in der Minderzahl sind. Giegold und Kipping sind Gründungsmitglieder des Instituts Solidarische Moderne, eine Art rot-rot-grüner Think Tank.
Die bereits hergestellte Nähe erlaubte es auch, halbwegs untaktisch den entscheidenden Konflikt anzudeuten: Einerseits muss und wird jedes rot-rot-grüne Bündnis den Komplex Wirtschaft-Arbeit-Soziales in den Mittelpunkt stellen – schon allein, um rot-grüne Fehler zu korrigieren, wie Vogt ausführte. Andererseits kann dies nur mit der Mehrheitsgesellschaft funktionieren, wie Giegold erneut mahnte: „Ein Umverteilungsprojekt muss in Deutschland immer mit einer Vision verbunden werden, wie die Leute am Wertschöpfungsprozess teilhaben.“ Die Konsumenten, die Kleinbürger, die gemeinen Steuerzahler brauchten Sinn- und Zweckvorgaben im Alltag. Lebhaft stimmte Kipping zu: Das Beispiel des Energiesektors könne zeigen, „wie erneuerbare und solidarische Ökonomien verknüpft werden können“. Das Muster „kleine Ökostrom-Stadtwerke statt großer Atom-Konzerne“ müsse übertragbar werden.
Über die deutlich im Raum stehende Frage, ob solch ein sozial-ökolgischer Wandel nationalstaatlich überhaupt anzuschieben sei, tröstete Kipping hinweg: Etwa das Institut Solidarische Moderne werde bei europäischen Nachbarlinken laut begrüßt: „Das bedeutet schon was, wenn so etwas in Deutschland stattfindet.“