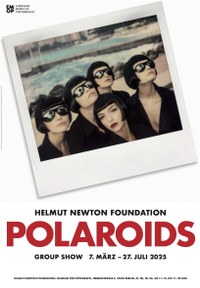Mit Louise Brown, die am 25. Juli 1978 kurz vor Mitternacht im britischen Kershaw Cottage Hospital geboren wurde, verbindet man eigentlich den Namen des Gynäkologen Patrick Steptoe, denn der „Vater“ des ersten Retortenbabys hatte damals einen einzigartigen Medienrummel forciert. Dass allerdings 32 Jahre vergehen mussten, bis der Mann hinter Steptoe, der Physiologe Robert Edwards, den Nobelpreis für Medizin zuerkannt bekommt, weil es ihm als erstem gelang, menschliches Leben außerhalb des weiblichen Körpers zu zeugen, hat gute Gründe. Die Geschichte der künstlichen Befruchtung ist auch die Geschichte eines großen unvollendeten Menschenexperiments, und das schwedische Nobelpreiskomitee war sich dieser Brisanz offenbar bis vor kurzem noch bewusst.
Angefangen hatte alles damit, dass Edwards in den fünfziger Jahren ungezählte Mäuse mit Hormonen hyperfertilisierte und so Massenschwangerschaften provozierte. Wie später die Kloner Ian Wilmut oder Hwang Woo Suk forschte Edwards für die Nutztierhaltung, doch er dachte schon früh über die Vorteile nach, die es haben könnte, menschliche Embryonen in vitro herzustellen. Da winkte nicht nur die lukrative Aussicht, weibliche Sterilität zu überlisten; Wie in seinen Erinnerungen nachzulesen ist, ging es Edwards auch um die Überprüfung des Embryos auf mögliche Erbschäden – also um das, was man heute Präimplantationsdiagnostik (PID) nennt.
Ethische Bedenken über Absicht und Durchführung plagten Edwards offenkundlich nicht, selbst wenn er der Möglichkeit des Klonens reserviert gegenüber stand. Wie einst die ärztlichen Leichensezierer beschaffte auch er sich sein „Material“ über klandestine Kanäle, und die Frauen, deren Gewebe er für seine Experimente verwendete, wussten in der Regel nichts davon. Sein Verbrauch an menschlichen Eizellen war enorm, über viele Jahre hinweg schlugen seine Versuche fehl. Selbst das Experiment mit eigenem Samen scheute er nicht.
Wie die heutigen Reproduktionsmediziner heiligte auch Edwards die Mittel durch den „heiligen“ Zweck, nämlich unfruchtbaren Frauen zum Kind zu verhelfen. Prominente Kritiker wie James Watson, den Mitentdecker der Doppelhelix, der die massenhafte Verwerfung von Embryonen als Kindstötungen ansah und Edwards Methode dafür kritisierte, dass sie keine Frau von ihrer Unfruchtbarkeit heilen könne, beeindruckten den „ruppigen Yorkshireman“, wie Edwards sich selbst nannte, nicht.
Als Lesley Brown, die aus einfachen Verhältnissen stammte, auf Steptoe und Edwards traf und einen Totogewinn in dieses Experiment investierte, wusste sie nicht, dass bislang keine Frau vor ihr durch IVF schwanger geworden war. Dass es schließlich klappte und Retortenkinder heute „ganz normal“ aufwachsen, ändert nichts daran, dass sie von der Wissenschaft zum Versuchsobjekt gemacht wurde – wie viele Frauen vor und nach ihr.
Warum hält das Nobelpreiskomitee den 1925 geborenen Edwards ausgerechnet jetzt für würdig, mit dem höchsten Medizinerpreis ausgezeichnet zu werden? Ein Grund könnte sein, dass die PID in Schweden heute routinemäßig nach der künstlichen Befruchtung eingesetzt wird, um Mehrlingsschwangerschaften zu verhindern. Dieses Argument soll die PID auch in anderen Ländern salonfähig machen. So gesehen hat Robert Edwards wirklich 32 Jahre benötigt, um an sein Ziel zu kommen.