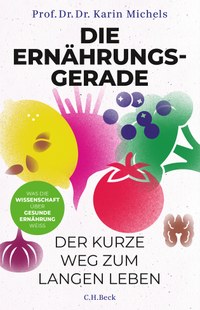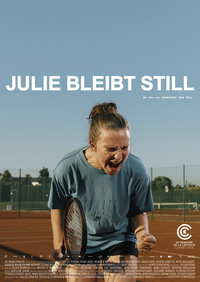Es gibt immer einen Grund. Nichts geschieht einfach bloß. So lapidar diese nachgerade altertümliche Feststellung erscheint, so gefährlich wird sie aber in einer Gesellschaft, die von faktischem Wissen nicht nur geprägt ist, sondern dieses Wissen ganz selbstverständlich auch als hinreichende Erklärung empfindet. Kürzlich etwa haben Forscher herausgefunden, dass die körperliche Misshandlung von werdenden Müttern nachhaltige Veränderungen im Erbgut der Ungeborenen veranlasst, chemische Abdrücke der Gewalt, die sich nachweislich wie hartnäckige Flecken über die Gene legen. Was diese Flecken aber für Folgen haben, ob sie überhaupt welche haben, weiß niemand. Dennoch glaubt man, den Schluss ziehen zu können, dass zwischen den Problemen der betreffenden Kinder, zwischen ihren Entwicklungsschwierigkeiten und den Hieben auf die Mutter auf genau diesem Wege ein Zusammenhang besteht. Der Unterleib wird zum Ort, zum Raum, in dem das Böse mit dem Individuum verknüpft wird.
Auch das Internet ist so ein Unterleib, ein Raum, in dem das Schlechte gedeiht, immer wieder und derzeit ganz besonders: Völlig absehbar war die reflexhafte Verknüpfung der Gräuelgroßtat eines 32-jährigen Norwegers mit dessen Aktivitäten auf Facebook, seinen Äußerungen als Blogger und seiner Vorgehensweise als Moderator von Kommentaren. Was man weiß und als Fakt betrachten kann, ist allerdings allein, dass Anders Breivik das Internet auf außerordentlich bewusste Weise in seinen Plan integrierte, indem er es als Verteiler für seine wahnhaften Gedanken benutzte – als allgemein zugängliche Ablage für seine Wortansammlung, die allein aufgrund ihres Papiergewichts nur schwerlich per Post versendbar gewesen wäre. Dass der Mann seine Ideologie am Netz geschärft, sie mehr noch aus dem virtuellen Raum generiert hat, ist dagegen nicht nur unwahrscheinlich, es kann tatsächlich auch niemand wissen. Und dennoch steht der Unionspolitiker Hans-Peter Uhl nicht allein mit seiner These, dass die Tat des Norwegers „im Internet geboren“ wurde. Cyberpolizisten patroullieren, überwachen, es muss etwas passieren, damit der virtuelle Unterleib nicht weiter solche Gräuel gebiert. Die Frage bleibt: Woher kamen denn die Schläge?
Das Motiv der Überantwortung kausaler Zusammenhänge oder gar Zwänge an das Netz als sich zunehmend verselbstständigenden Unterleib, als Mittel, das weniger Arbeitsgegenstände verändert denn den Arbeitenden selbst, hat sich festgesetzt. So hat der Konstanzer Philosoph Jürgen Mittelstraß kürzlich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung dargelegt, dass der Glanz des Internets im Potenzial seiner Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten liege, das mit diesem Glanz verbundene Elend aber in der Aneignung des Menschen durch eben jene, von ihm geschaffene technische Welt. Das Netz verleibt sich seinen Macher ein, und plötzlich soll man sich in einer Art Odyssee „2011“ gefangen sehen, auf der Reise zum Jupiter, der hier kein Planet ist, sondern die Gegenwart, in der das Raumschiff Erde nicht Frank, sondern die Menschheit umherschifft. Und HAL ist das Internet, das Autonomie erlangt und offenkundig versucht, die Kontrolle zu übernehmen.
Dass die Realität doch eine andere ist, darf man als erfreulich betrachten, selbst wenn der Hunger nach Erklärungen dadurch nicht gestillt wird. Es gibt ja immer einen Grund. Aber es gehört auch zu den Wahrheiten einer Wissensgesellschaft, dass viele Gründe auf unbestimmte Zeit unfassbar bleiben, weil sie keinerlei Erklärung liefern.