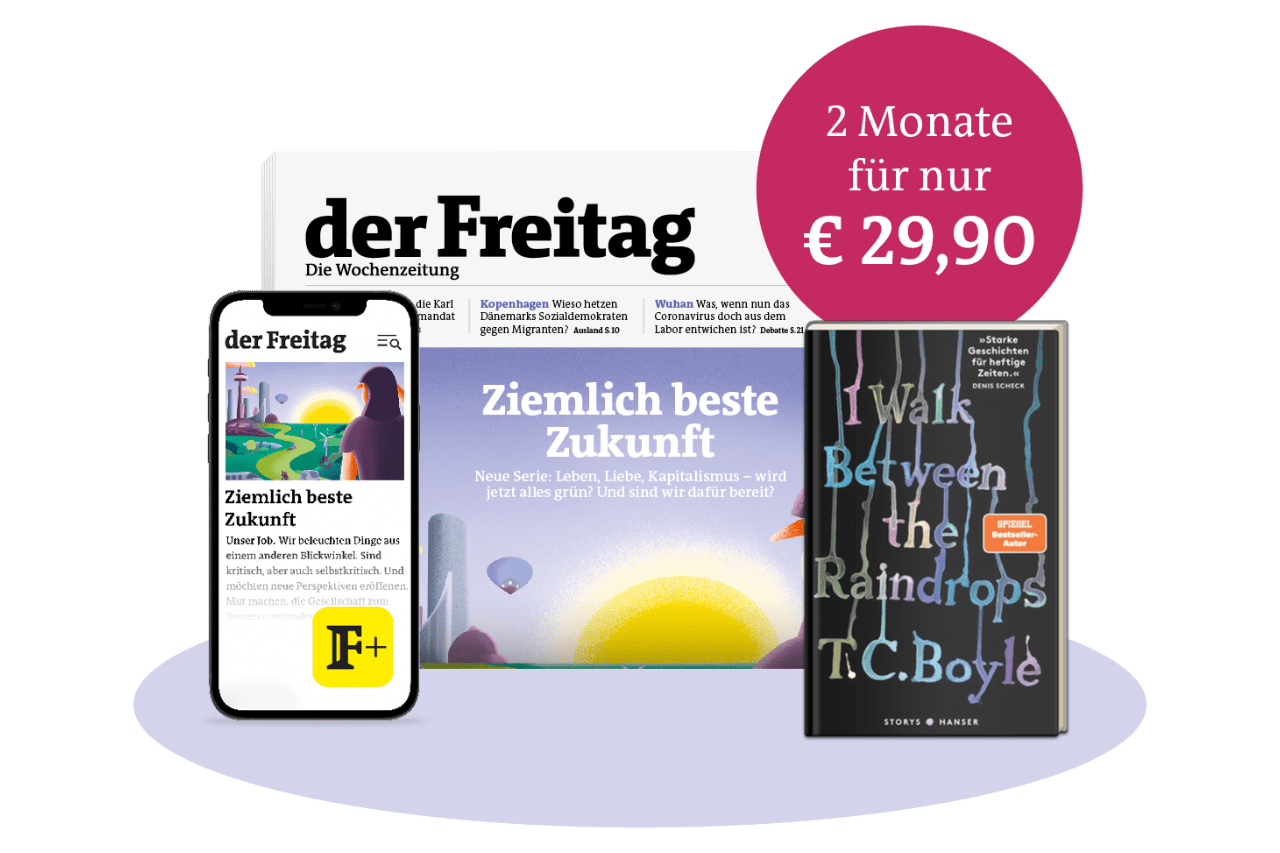Es sind fast 20 Jahre vergangen, seit der Gründung von Wikileaks. Es folgten Enthüllungen, Anschuldigungen, Haftbefehle und mehr als ein Jahrzehnt des Kampfes für die Freiheit.
Die Leaks
Assange, der aus Australien stammt, gründete Wikileaks im Jahr 2006. Im Oktober 2010 wurden beide weltbekannt, als sie eine Reihe von Leaks der ehemaligen US-Soldatin Chelsea Manning veröffentlichten. Am berüchtigtsten war das Video Collateral Murder, das zeigte, wie US-Soldaten im Irak von einem Hubschrauber aus ein Dutzend unbewaffnete Zivilisten töteten, darunter zwei Reuters-Mitarbeiter. Einen Monat später veröffentlichte Wikileaks eine Sammlung von mehr als 250.000 diplomatischen US-Depeschen, was zu peinlichen Enthüllungen, diplomatischen Verstimmungen und heller Panik in Washington führte.
Die US-Regierung begann eine strafrechtliche Untersuchung, die 2013 zur Verurteilung Mannings vor einem Kriegsgericht führte, unter anderem wegen Verstößen gegen das Spionagegesetz.
Die schwedische Anklage und die Jahre in der Botschaft Ecuadors
Im August 2010 wurde in Schweden ein Haftbefehl gegen Assange erlassen, weil ihm zwei Frauen in Schweden sexuelle Nötigung und Vergewaltigung vorgeworfen hatten; Assange bestritt die Vorwürfe. Im November wurde ein internationaler Haftbefehl erlassen.
Assange stellte sich der Polizei in London. Nach kurzer Untersuchungshaft wurde er gegen Kaution freigelassen; er wehrte sich erfolglos gegen seine Auslieferung nach Schweden, da er befürchtete, die dortigen Behörden würden ihn an die USA ausliefern.
Am 19. Juni 2012 betrat er als Motorradkurier verkleidet die ecuadorianische Botschaft in London und beantragte politisches Asyl. Er verbrachte 2.487 Tage, also fast sieben Jahre, in der Botschaft.
Im Mai 2017 stellte der schwedische Generalstaatsanwalt die Ermittlungen gegen Assange ein. Die britische Polizei erklärte jedoch, dass sie Assange trotzdem verhaften würde, wenn er die Botschaft verließe, da er gegen die Bedingungen der U-Haft verstoßen habe.
Obwohl die USA keine Anklage gegen ihn erhoben hatten, nannte das Justizministerium im 2018 versehentlich Assange in einem Gerichtsdokument, was darauf hindeutete, dass er möglicherweise heimlich angeklagt worden war. 2018 sagten Ärzte, die Assange untersucht hatten, dass sein langer Aufenthalt in der Botschaft „gefährliche“ Auswirkungen auf seine körperliche und geistige Gesundheit habe.
Im Hochsicherheitsgefängnis
Die Geduld Ecuadors mit Assange sollte endlich sein; zweimal wurde sein Internetanschluss gekappt, weil man weitere Wikileaks-Veröffentlichungen befürchtete. Der linke Präsident, während dessen Amtszeit Assange die Botschaft betreten hatte, Rafael Correa, wurde abgewählt. Sein Nachfolger, Lenin Moreno, erklärte am 2. April 2019, Assange habe „wiederholt gegen die Bedingungen seines Asyls verstoßen“. Neun Tage später wurde er aus dem Gebäude gezerrt, Beamte in Zivil trugen ihn zu einem Polizeiwagen, der ihn zum Belmarsh-Gefängnis brachte.
Scotland Yard erklärte, er sei verhaftet worden, weil er gegen die Auflagen seiner Haftentlassung verstoßen habe, aber auch im Auftrag der USA.
Am 1. Mai 2019 wurde Assange zu 50 Wochen Haft verurteilt, weil er 2012 gegen seine Auflagen verstoßen hatte. Am nächsten Tag begann das US-Auslieferungsverfahren offiziell.
Später im Mai erhoben die USA 17 zusätzliche Anklagen gegen ihn, die alle unter das Spionagegesetz fallen und weit über die erste Anklage hinausgehen, die bei seiner Ausweisung aus der Botschaft veröffentlicht wurde. Schweden kündigte außerdem an, die Ermittlungen wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs wieder aufzunehmen. Am 13. Juni gab der damalige britische Innenminister Sajid Javid bekannt, dass er den Auslieferungsbeschluss der USA für Assange unterzeichnet habe.
Der Kampf gegen die Auslieferung
Die Räder der Justiz drehten sich langsam: Assanges Auslieferungsanhörung begann im Februar 2020, wurde auf Mai vertagt und dann wegen der Coronapandemie weiter verzögert. Im Januar 2021 gab es einen kurzzeitigen Sieg für ihn, als die Bezirksrichterin Vanessa Baraitser entschied, dass „der geistige Zustand“ von Assange eine Auslieferung an die USA verunmögliche. Die USA kündigten umgehend an, gegen die Entscheidung Berufung einzulegen, und im Dezember wurde sie vom Obersten Gerichtshof auf der Grundlage von Zusicherungen der USA über seine Behandlung aufgehoben.
Im März 2022 lehnte der Oberste Gerichtshof die Berufung von Assange ab: im Juni genehmigte die britische Innenministerin Priti Patel seine Auslieferung, wodurch er einem Prozess in den USA immer näher kam. Im Januar dieses Jahres leitete sein Anwaltsteam eine erneute Berufungsverhandlung vor dem High Court ein. Seine Frau Stella sagte, seine einzige Hoffnung bestünde darin, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte seine Auslieferung stoppt, obwohl dies angesichts der hohen Hürden für ein Eingreifen des Gerichtshofs nicht selbstverständlich sei. Die Richter teilten mit, Assange könne an der Anhörung teilnehmen, sei aber zu krank, um dies zu tun, was die Sorge um seinen Gesundheitszustand in Belmarsh noch verstärkt.
Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs im März war nicht eindeutig. Die beiden Richter erklärten, Assange könne seinen Fall zu einer Berufungsanhörung bringen, aber nur, wenn die USA dem Gericht keine angemessenen Zusicherungen geben könnten. Im April lieferten die USA Zusicherungen, aber zwei Monate später gaben die Richter dem Wikileaks-Gründer in einer Entscheidung, die von den Anhängern im Gerichtssaal mit Beifall begrüßt wurde, die Erlaubnis, in Berufung zu gehen, da sie der Meinung waren, dass er sich im Falle einer Auslieferung nicht auf den ersten Verfassungszusatz der USA berufen könne, der die Meinungsfreiheit dort schützt, und dass er wegen seiner Staatsangehörigkeit vor Gericht benachteiligt werden könnte.
Sinneswandel der USA
Während des Berufungsverfahrens in London gab es erste Anzeichen für ein Umdenken in den USA. Das Wall Street Journal berichtete, Washington erwäge einen Vergleich, bei dem die Spionagevorwürfe fallen gelassen würden, wenn Assange in London einen Anklagepunkt gestünde. Assanges Anwaltsteam blieb skeptisch. Als Joe Biden aber dann auf eine Frage zu Australiens Ersuchen an die USA, die Anklage fallen zu lassen, mit den Worten antwortete „Wir denken darüber nach“, wuchs die Zuversicht. Trotzdem wurde Mitte Juni ein Anhörungstermin für den 8. und 9. Juli anberaumt, was darauf hindeutete, dass die USA weiterkämpfen. Dann veröffentlichte Wikileaks die Nachricht eines Deals: Assange werde sich in einem Anklagepunkt der Verschwörung zur Beschaffung und Weitergabe geheimer US-Verteidigungsdokumente schuldig bekennen und dafür die Freiheit wiedererlangen.