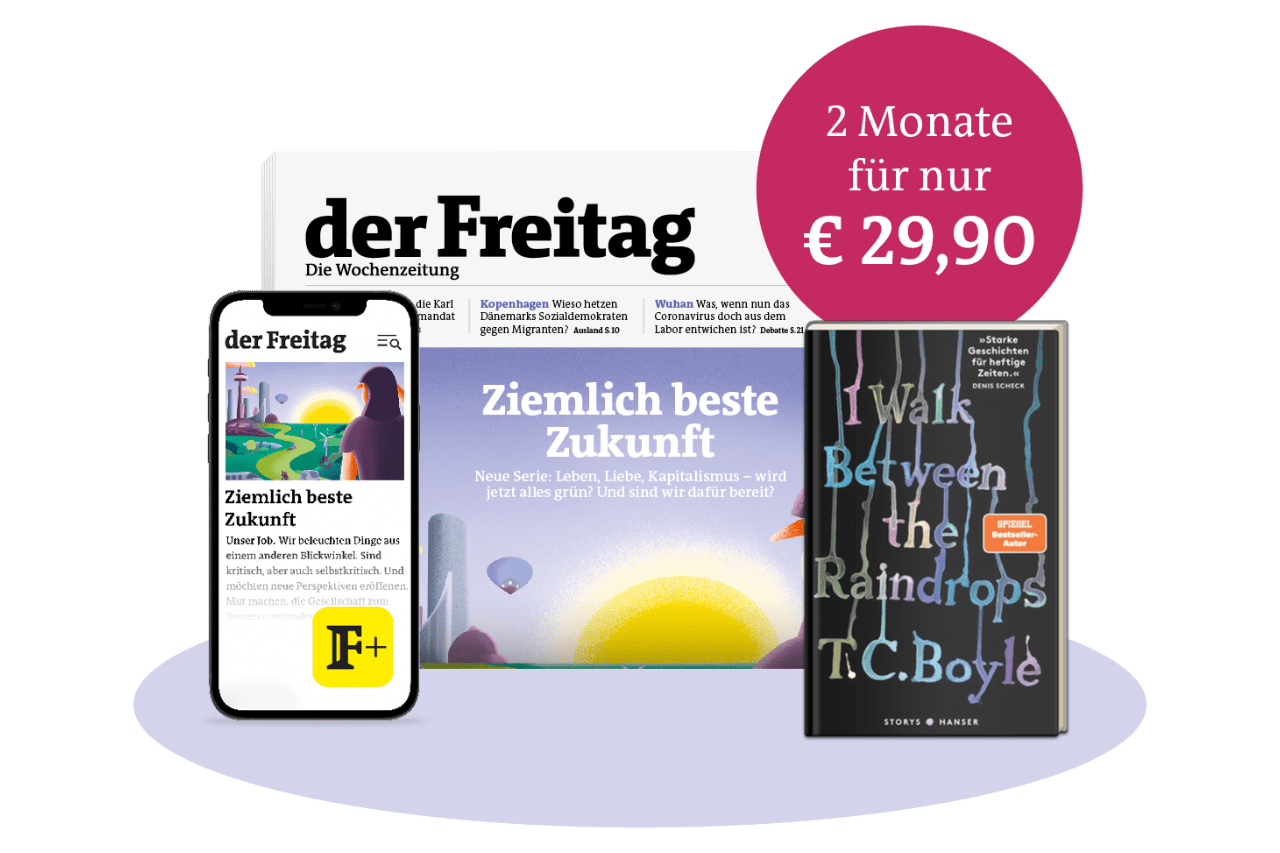Martin Scorseses Liebe zum Kino ist fast so legendär wie seine eigenen Filme. Seit Jahren setzt sich der Regisseur von Killers of the Flower Moon für das Filmerbe ein, restauriert in Vergessenheit geratene Werke aus den USA, aus Italien und vielen anderen Ländern. Eine besondere Liebe verbindet ihn dabei mit dem Werk des britischen Regieduos Michael Powell und Emmerich Pressburger, deren Filme wie Leben und Tod von Oberst Blimp und Die Roten Schuhe in den 1940er und 50ern international gefeiert wurden und zu Klassikern der Filmgeschichte gehören.
In dem von Scorsese präsentierten Dokumentarfilm Made in England erzählt Scorsese so enthusiastisch wie persönlich, welchen Einfluss ihr Werk allgemein und auf seine eigene Arbeit im Besonderen hatte. Das visuelle Essay unter der Regie von David Hinton zeichnet nach, wie Scorsese das Regieduo wiederentdeckte und 1980 nach Amerika holte. Dort wurde Powell später nicht nur Scorseses Berater, sondern lernte auch dessen jahrelange Editorin Thelma Schoonmaker kennen. Die beiden waren von 1984 bis zu Powells Tod 1990 verheiratet. Die dreifache Oscarpreisträgerin (für Wie ein wilder Stier, Aviator und Departed) setzt sich seitdem für die Restauration der Filme ihres verstorbenen Mannes ein. Ein Gespräch mit der 84-Jährigen über das filmische Vermächtnis.
der Freitag: Frau Schoonmaker, Sie waren mit Michael Powell verheiratet und sind nun auch ausführende Produzentin des Dokumentarfilms „Made in England“. Doch vor der Kamera überlassen Sie die Bühne Martin Scorsese. Warum?
Thelma Schoonmaker: Ach, ich arbeite lieber im Hintergrund. Und was braucht es da mich noch, wenn Marty schon alles sagt? Sein Verhältnis zu Powell und Pressburger ist so stark und prägend, dass es mehr als genug Stoff für einen Film hergibt. Er hat meinen Mann und Emmerich dem Vergessen entrissen. Ihre Filme waren aus der Mode gekommen, in der Nachkriegszeit begann in Großbritannien eine neue Ära, Powell und Pressburger passten nicht mehr in die Zeit. Erst durch Martin Scorsese erinnerte man sich wieder daran, wie wunderbar ihre Filme sind.
Waren Ihnen denn die Filme ein Begriff?
Als Jugendliche hatte ich Leben und Tod von Oberst Blimp gesehen, der ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Aber ich hatte keine Ahnung, wer den Film inszeniert hatte, geschweige denn, dass ich viele Jahre später einen der beiden Regisseure heiraten würde. Als ich dann als Editorin mit Marty an Wie ein wilder Stier arbeitete, schwärmte er mir von den Filmen vor und gab mir immer wieder VHS-Kassetten. Eines Tages sagte er zu mir: „Ich werde mir heute Abend einen Film ansehen, von dem ich befürchte, dass er nicht besonders gut ist. Wenn ich ihn nicht mag, spring ich aus dem Fenster!“ Es war Ich weiß wohin ich gehe von 1945, ihr romantischster Film, und Marty war wirklich in Sorge. Am nächsten Tag kam er zu mir in den Schnittraum und platzte heraus: „Ein Meisterwerk. Du musst ihn dir anschauen, jetzt gleich!“
Wie haben Sie Michael Powell dann persönlich kennengelernt?
Das dauerte noch eine Weile. Mit seiner Euphorie hatte Marty alle angesteckt, Francis Ford Coppola, George Lucas, Brian De Palma, alle waren fasziniert von den Filmen, konnten aber nicht verstehen, wie zwei Menschen zusammen Regie führen konnten, und fragten sich zugleich, warum so viele Jahre nichts von ihnen zu hören war. Powell und Pressburger waren wie verschollen. Als dann Marty zum Edinburgh Film Festival eingeladen wurde und einen Preis für Alice Doesn’t Live Here Anymore erhalten sollte, fragten sie ihn, wen er sich als Laudator wünscht. Und er sagte: „Michael Powell.“ Da fragten sie ihn: „Wer ist das?“ Das muss man sich mal vorstellen! So sehr waren sie in Vergessen geraten. Das weckte Martys Ehrgeiz erst recht. Er fuhr nach London und Stanley Kubrick brachte die beiden schließlich zusammen.

Thelma Schoonmaker wurde 1940 in Algerien geboren (ihr Vater arbeitete bei einem Ölkonzern), wollte Diplomatin werden, lernte dann aber bei einem Schnittkurs Martin Scorsese kennen, der sie für seinen ersten Film Wer klopft denn da an meine Tür? (1967) engagierte und für den sie als Editorin seit den 1980ern fast ausschließlich arbeitet
Michael Powell schrieb in seiner Autobiografie: „In meinen Adern begann wieder Blut zu fließen.“
Weil da ein junger amerikanischer Regisseur kam und jede Einstellung kannte, die er je gedreht hatte, und ihn mit Fragen bombardierte. Es war ein unbeschreiblicher Moment für ihn, wie eine Wiedergeburt. Und der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Emmerich ging es zu der Zeit bereits nicht mehr gut, aber Marty brachte Michael in die Vereinigten Staaten, präsentierte Peeping Tom auf dem New York Film Festival und pries die Filme, wo immer er konnte. Der Respekt war schnell gegenseitig. In Michaels Augen war Martys Hexenkessel ein Meisterwerk. Robert De Niro und Marty fuhren mit Michael durch New York und zeigten ihm, wo sie Hexenkessel gedreht hatten. Und auch das Gym, in dem De Niro gerade für seine Rolle als Boxer in Wie ein wilder Stier trainierte. Er sah die roten Boxhandschuhe und meinte gleich, das würde auf der Leinwand nicht gut aussehen. Und Marty entgegnete: „Du hast recht, es sollte Schwarzweiß sein.“ So beeinflusste er ab da etliche unserer Filme, hatte immer wieder wunderbare Ideen.
„Made in England“ zeigt auch, wie vielschichtig und ambivalent die Filme von Powell und Pressburger waren. Etwa die Propagandafilme, die sie im Auftrag der britischen Regierung während des Zweiten Weltkriegs drehten, bei denen aber Deutsche durchaus differenziert und nicht pauschal als Nazis porträtiert wurden.
Weil Emmerich als deutscher Jude aus Deutschland fliehen musste, aber wusste, dass es dort auch gute Menschen gab und er darauf insistierte, auch wenn das zu der Zeit in England nicht populär war. Bevormundung konnten beide nicht akzeptieren. All ihre Filme verweigern sich diesem simplen Gut-Böse-Schema. Das ist eine große Stärke ihres Werks, Blimp entstand 1942 und beginnt als Satire über das britische Militär. Und sie hatten schon fremdsprachige Dialoge in ihren Filmen, als das in englischen und amerikanischen Filmen noch undenkbar schien.
Im Film sagt Michael Powell an einer Stelle, Zusammenarbeit sei nicht möglich ohne Liebe. Stimmen Sie dem zu?
Absolut. Es geht nur mit gegenseitigem Vertrauen und liebevollem Respekt. Das galt für Michael und Emmerich ebenso wie für Marty und mich. Wir machen seit fast einem halben Jahrhundert jeden Film zusammen. Wir können auch mal unterschiedlicher Meinung sein, aber das passiert fast nie. Ich habe meinen Beruf als Editorin bei ihm gelernt, wir arbeiten und denken sehr ähnlich. Viele Verhältnisse zwischen Regisseur und Editor sind Konkurrenz, ein Gerangel um das letzte Wort und den letzten Schnitt. Das tut den Filmen selten gut.
Wie arbeiten Sie konkret am Schnitt eines Scorsese-Films?
Marty wiederholt sich nicht, jeder Film ist anders, und so ist auch der Schnitt jedes Mal eine neue Herausforderung. Aber wir streiten nicht, es ist eine Kollaboration, die viel Freude bereitet. Manchmal biete ich ihm verschiedene Versionen einer Szene an und wir reden darüber. Worüber wir uns aber immer einig sind, ist die Länge!
Bei „Made in England“ sind die Rollen anders verteilt. Sie sind ausführende Produzentin, Martin Scorsese vor der Kamera. Inwieweit lässt er sich als Erzähler zähmen?
Oh, nie im Leben würde ich Martin Scorsese Regieanweisungen geben! Er weiß, was er tut.
Trotzdem gibt es doch womöglich auch Dinge, die Martin Scorsese im Laufe der Jahre von Ihnen gelernt hat?
Manchmal sehe ich etwas in einer Szene, das ihm entgangen ist, eine kleine Geste oder einen Blick. Ich bin keine große Feministin, aber ich bin überzeugt, dass ich als Frau einen anderen Blick auf Dinge habe. Und das hilft dem Film. Das ist auch Marty bewusst.
Und Michael Powell?
Als wir uns kennenlernten, drehte er keine Filme mehr. Aber wir arbeiteten zusammen an seiner Autobiografie. Er wusste, was er erzählen wollte, aber auch da war ich für den Schnitt und Rhythmus verantwortlich. Übrigens auch das ganz ohne Hickhack.
Zum Schluss noch die Frage, wie Sie sich kennenlernten.
Marty holte Michael und Emmerich nach New York für eine Retrospektive im MoMA. Weil er mir so viele ihrer Filme empfohlen hatte und ich sie liebte, ging ich mit zu einer Vorführung von Blimp. Emmerich sprang herum und begrüßte alle möglichen Leute und Freunde, die er eingeladen hatte. Michael stand still in einer Ecke. Das war das erste Mal, dass ich ihn sah. Danach lud ihn Marty zum Dinner bei sich nach Hause ein, wir arbeiteten zu der Zeit am Schnitt von Wie ein wilder Stier in seinem Apartment. Wir saßen dann zusammen am Tisch, er hat nicht viel geredet, aber ich war wie vom Blitz getroffen. Der Rest ist Geschichte.