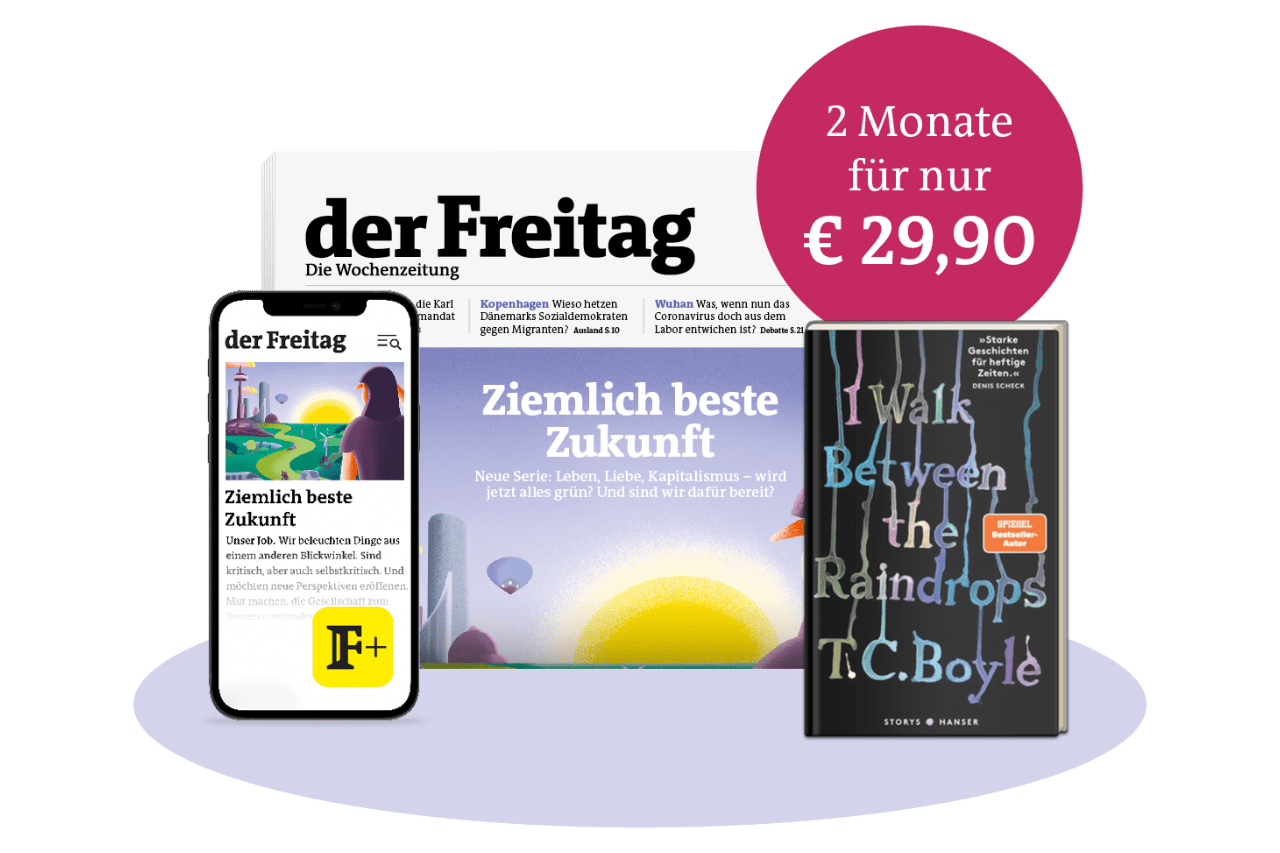Bis heute sterben Schätzungen zufolge weltweit Zehntausende Frauen jährlich an den Folgen einer Abtreibung, weil sie keinen Zugang zu sicheren Schwangerschaftsabbrüchen haben.
Ein Viertel der Weltbevölkerung lebt in Staaten, die Abtreibungen entweder gar nicht erlauben, oder nur, um das Leben der Frau zu retten. Das berechnete eine Studie im Auftrag der amerikanischen Guttmann-Stiftung, die sich weltweit für den Zugang zu sicheren Abtreibungen einsetzt. Die meisten Staaten erlauben jedoch den Schwangerschaftsabbruch unter bestimmten Bedingungen, etwa nach einer Vergewaltigung, bei Inzest, einer starken Fehlbildung des Fötus oder falls die Gesundheit der Schwangeren gefährdet ist. Nur 37 Prozent aller Frauen leben in Staaten, die Abtreibungen bis zu einem gewissen Zeitraum unabhängig von solchen Bedingungen zulassen. Hier können aber – wie auch in Deutschland – andere Beschränkungen gelten, etwa Zwangsberatungen oder andere Hindernisse, die es schwierig machen, tatsächlich Zugang zu einer sicheren Abtreibung zu erhalten.
Wer reicht ist, überlebt
Entscheidend sind neben der Gesetzeslage auch andere Faktoren, etwa gesellschaftliche Stigmatisierung, finanzieller Aufwand, die Techniken, die zum Einsatz kommen können sowie die allgemeine Entwicklung des Gesundheitssystems. Hier zeigt sich eine krasse globale Ungleichheit: In reichen Gesellschaften kommt es nur noch selten vor, dass Frauen bei Abtreibungen sterben. Aber 45 Prozent aller Abtreibungen weltweit finden unter nicht sicheren Bedingungen statt – fast alle von ihnen in Entwicklungsländern. Das hat die Weltgesundheitsorganisation WHO errechnet, die zuletzt 2018 einen Bericht über den Zugang zu sicheren Abtreibungen vorgelegt hat.
Acht Millionen Frauen müssen laut WHO jedes Jahr einen Schwangerschaftsabbruch mit „gefährlichen oder invasiven Methoden“ erleiden. Das kann etwa bedeuten, dass Gegenstände in die Vagina eingeführt werden, Frauen sich vergiften oder dass durch Schläge eine Fehlgeburt ausgelöst wird. Während in wohlhabenden Ländern solche als „sehr unsicher“ klassifizierten Abtreibungen kaum noch vorkommen, sind es in Zentralamerika und der Karibik etwa ein Viertel, in Afrika sogar circa die Hälfte der Abtreibungen, schätzt die WHO. Hier ist die Sterberate besonders hoch.
Immerhin ist die Sterberate global seit Jahren rückläufig. Das liegt neben Verbesserungen in der gesundheitlichen Versorgung und der stellenweise fortschreitenden Legalisierung vor allem an der Entwicklung und Verbreitung weniger gefährlicher Abtreibungsmethoden.
Eine besondere Rolle spielte dabei das Medikament Mifepriston, das seit 2005 in Kombination mit Misoprostol auch von der Weltgesundheitsorganisation als sicheres Mittel empfohlen wird. Solche „Abtreibungspillen“ können von Frauen auch selbst eingenommen werden, wenn sie keinen Zugang zu einer legalen Abtreibung in einer Klinik haben.
Das in den Niederlanden ansässige internationale Kollektiv womenonweb.org hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, Mifepriston als Abtreibungsmittel weltweit zu verbreiten. Frauen aus Ländern, die keinen Zugang zu sicheren Abtreibungen erlauben, können sich das Mittel per Post schicken lassen.
Die von christlich-evangelikalen Kräften geprägte US-Regierung war ein Rückschlag für Abtreibungsrechte weltweit. 2017 beschloss die Trump-Regierung, alle internationalen Organisationen, die irgendwo auf der Welt über Abtreibungen auch nur informieren, von der internationalen US-Hilfe für Gesundheitsversorgung in Höhe von fast neun Milliarden Dollar jährlich auszuschließen. Trotz internationaler Bemühungen, diesen finanziellen Wegfall auszugleichen, wurde die Gesundheitsversorgung in zahlreichen ärmeren Ländern beeinträchtigt.
Besonders die Arbeit von Organisationen, die über Verhütung oder Aids-Prävention informieren, ist davon betroffen. Dabei ist Zugang zu Verhütungsmitteln vielleicht die wirksamste Maßnahme, um Abtreibungen zu vermeiden. Kriminalisierung hingegen zwingt Frauen, auf unsichere Methoden des Schwangerschaftsabbruchs auszuweichen, kann aber nirgendwo auf der Welt Abtreibungen wirksam verhindern. Deshalb gehen die Abtreibungsraten seit Jahren allgemein ausgerechnet in den Ländern mit den liberalsten Abtreibungsgesetzen zurück.
Abtreibung

Grafik: der Freitag
Was Schwangerschaftsabbrüche betrifft, ist die Welt rückständig. In vielen Ländern sind sie bis heute illegal. In Südamerika und Afrika haben Frauen es am schwersten.
Europa
In der Europäischen Union ist der Schwangerschaftsabbruch nur auf dem überwiegend römisch-katholisch bevölkerten Inselstaat Malta ausnahmslos verboten. Ärzten und Frauen, die abbrechen, drohen hier zwischen 18 Monaten und drei Jahren Haft. Im restlichen Europa sind Abbrüche nach dem Willen der Frau überwiegend straffrei. Neben Malta hat nur noch Polen ein sehr restriktives Abtreibungsgesetz. Hier ist der Schwangerschaftsabbruch erlaubt, wenn das Leben der Frau in Gefahr ist, sie vergewaltigt wurde oder wenn das Kind sehr wahrscheinlich behindert sein wird. Ein Bürgerbegehren zur weiteren Verschärfung des Abtreibungsgesetzes scheiterte dennoch 2016 im Parlament.
Nordamerika
In den USA sind Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich erlaubt, gewisse Einzelheiten regeln die US-Bundesstaaten gesondert. Vorstöße zur Verschärfung des Abtreibungsgesetzes auf Bundesebene scheiterten bislang. Kanada ist eines der wenigen Länder weltweit, in denen der Schwangerschaftsabbruch nicht durch ein Gesetz geregelt wird. Das Oberste Gericht sprach einen Arzt 1988 frei. Seitdem ist der genaue rechtliche Rahmen unklar.
Australien
In mittlerweile fünf von sechs Bundesstaaten Australiens ist Abtreibung legal. Bis zum Jahr 2018 galt im nordöstlichen Bundesstaat Queensland ein Gesetz aus dem 19. Jahrhundert, das die Abtreibung verbot. Nach Protesten wurde dieses Gesetz gekippt. Ähnlich wie in den USA gibt es in Australien eine Regelung zu sogenannten Sicherheitszonen vor Abtreibungskliniken, in denen Abtreibungsgegner nicht protestieren dürfen. Dadurch sollen Frauen und Familien vor Anfeindungen und Angriffen geschützt werden.
Asien
In Indien sind vor allem Töchter wegender Mitgift-Traditionen unerwünscht und werden häufiger abgetrieben. Nach Schätzungen der Regierung gibt es 63 Millionen Frauen weniger, als es gebensollte, obwohl eine Feststellung des Geschlechts des ungeborenen Kindes per Ultraschall verboten ist. In China befördert die Regierung Schwangerschaftsabbrüche de facto: Wer hier unverheiratet und schwanger ist, braucht eine sogenannte Geburtserlaubnis. Weil diese sehr schwer zu erhalten ist, sehen sich viele unverheiratete Frauenzu einem Abbruch gezwungen.
Afrika
In fast allen afrikanischen Staaten herrscht ein Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen, weswegen zum Beispiel in Ländern wie Äthiopien unter schwierigen Bedingungen abgetrieben wird. Illegale Schwangerschaftsabbrüche sind dort eine häufige Todesursache von Frauen. Südafrika bildet eine von wenigen Ausnahmen: Hier sind Abbrüche etwa seit dem Ende der Apartheid legal. Es gilt eine Fristenregelung. Der Zugang zu sicheren Eingriffen ist jedoch auch dort schwierig.
Lateinamerika
In Süd- und Mittelamerika gelten einige der strengsten Regeln zu Schwangerschaftsabbrüchen weltweit. In Nicaragua ist die Abtreibung beispielsweise unter keinen Umständen erlaubt, selbst wenn die Frau in Lebensgefahr schwebt oder vergewaltigt wurde. In den meisten anderen lateinamerikanischen Ländern darf sie nur vorgenommen werden, wenn das Leben der Frau in Gefahr ist. Erlaubt ist der Schwangerschaftsabbruch nur in Uruguay, Kuba und Guyana.