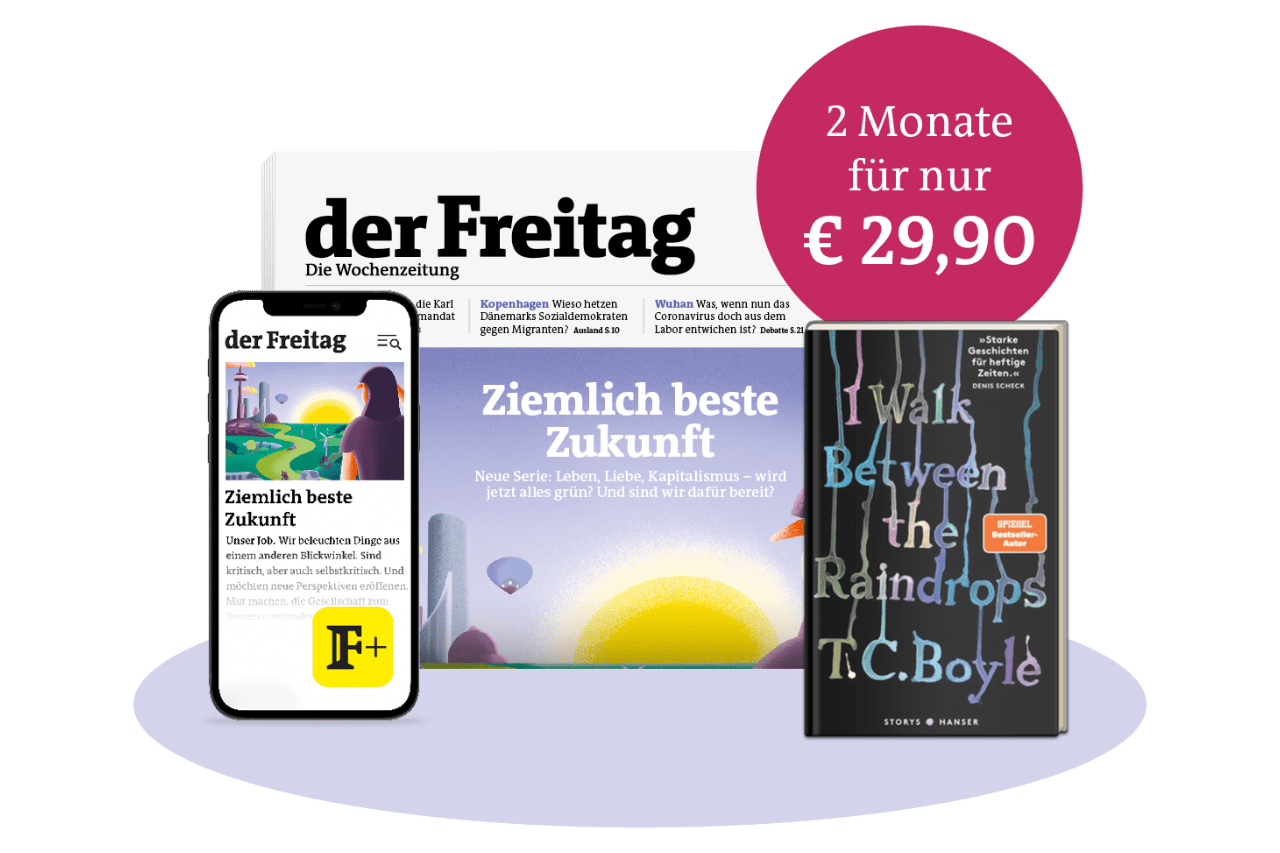„Wenn man Volksverbundenheit will, so darf man die Klugheit des Volkes nicht unterschätzen, muss sein Vertrauen erwidern, es nicht unausgesetzt bevormunden wollen. Nicht durch Aufreizung, insbesondere der Jugend, nicht durch Drohungen gegenüber hilflosen Volksteilen ...“ Auch sollte Wissenschaftlern von Weltruf nicht die Existenz bestritten werden, „weil sie kein Parteibuch besitzen“.
In Deutschland liest man Derartiges 1934 sonst nur in Flugblättern oder eingeschleusten Exilschriften verbotener Parteien. Keine Zeitung würde es wagen, Sätze zu drucken wie: „Kein Volk kann sich den ewigen Aufstand von unten leisten, wenn es vor der Geschichte bestehen will. Einmal muss die Bewegung zu Ende kommen, ein festes soziales Gefüge entstehen, zusammengehalten durch eine unbestrittene Staatsgewalt.“ Die Zustände unter Adolf Hitler so zu beschreiben, das muss man sich leisten können und riskieren wollen. Vizekanzler Franz von Papen glaubt sich dazu imstande, wenn nicht berufen. Am 17. Juni 1934 fallen die zitierten Aussagen während seines Auftritts im süddeutschen Marburg. Der Anlass ist offiziöser Natur und ergibt sich weitab der Reichshauptstadt Berlin mit der 14. Jahresversammlung des Universitätsbundes. Der Berliner Germania-Verlag druckt und verbreitet zuvor gut tausend Exemplare der „Marburger Rede“, der Sender Frankfurt überträgt sie, die Abendausgabe der Frankfurter Zeitung will noch am selben Tag den Wortlaut veröffentlichen, bis ihr Propagandaminister Joseph Goebbels in die Parade fährt.
Wand an Wand mit Hitler
Ausgerechnet von Papen geht auf Kollisionskurs mit der NS-Führung. Der Protegé des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg war einer der beflissensten Arrangeure von Hitlers Machterschleichung am 30. Januar 1933. Seither residiert er in einer personell großzügig ausgestatteten Vizekanzlei im Palais Borsig an der Wilhelmstraße, direkt neben der Reichskanzlei, Wand an Wand mit Hitler. Warum stört einen wie von Papen plötzlich der „ewige(n) Aufstand von unten“, den sein nationalkonservatives Lager bis dahin als „Erneuerung von Volk und Vaterland“ gefeiert hat? Je brachialer der freilich vonstatten ging, desto mehr verloren die Handlanger des Handstreichs gegen die Republik von Weimar an Kontrolle über Hitler.
Im Juni 1934 sitzt von Papen zwar weiter im Reichskabinett, aber die Entscheidungen fallen nicht dort. Und sie fallen ohne ihn. Ob der Wirtschaftspatriarch Alfred Hugenberg und seine (inzwischen aufgelöste) Deutschnationale Volkspartei (DNVP), die paramilitärischen Stahlhelmer, die Deutschen Christen, Monarchisten, die Industriellen – sie alle wollten den Dienstleister Hitler und bekamen den Diktator. Der hat sie nicht enttäuscht, aber entmachtet. Unwiderruflich, wird befürchtet. Hindenburg, bis dato Schirmherr jener Klientel der Kaltgestellten, verdämmert im Frühsommer 1934 schwer krank auf seinem Gut Neudeck in Ostpreußen. Um Hitler in die Schranken zu weisen, fällt er aus.
Bis heute ist nicht geklärt, wann von Papen die „Marburger Rede“ erstmals zu Gesicht bekam, ob er Passagen selbst schrieb oder zumindest redigierte. Fest steht, den Entwurf verfasste Edgar Jung, Vordenker der deutschen Jungkonservativen, von Papens Berater und Ghostwriter. Am 13. Juni 1934 habe Jung in einem Berliner Lokal Gesinnungsfreunden das brisante Manuskript vorgelegt, erinnert sich Edmund Forschbach, der diesen Abend miterlebt hat, in seinem 1984 erschienenen Buch Edgar J. Jung. Ein konservativer Revolutionär. Er dürfe für sich in Anspruch nehmen, schreibt der Autor, „dass ich die ,Marburger Rede‘ als Erster gelesen habe, bevor sie Papen überhaupt zu sehen bekam“. Unterwegs nach Marburg habe der Vizekanzler versucht, Teile der Ansprache zu korrigieren, sei aber darauf hingewiesen worden, dass sie bereits gedruckt und ins Ausland gelangt sei. So blieb alles, wie es war.
Anfang 1934 rumort es in der SA
Edgar Jung hält seinerzeit die Situation offenkundig für günstig, um für die Deutschnationalen verlorenes Terrain zurückzugewinnen, ohne die „nationale Revolution“ infrage zu stellen. Nur eben zu beenden. Seit Anfang 1934 rumort es in den Reihen der Sturmabteilung (SA), die 4,5 Millionen Mitglieder zählt und sich um die Früchte ihrer „revolutionären Tatkraft“ – von Mord und Terror – betrogen fühlt. SA-Stabschef Ernst Röhm will seine braunen Bataillone zum Waffenträger der Nation erhoben sehen. Als Volksmilizen sollen sie der Reichswehr (ab 1935: Wehrmacht) die Privilegien schleifen. Das Land müsse denen gehören, die es von Marxismus und Parteienherrschaft gesäubert hätten, ansonsten sei „eine zweite Revolution“ fällig.
Hitler ist herausgefordert, er muss sich entscheiden zwischen einstiger Kampfzeit und künftiger Kriegszeit. Die Eroberung von mehr „deutschem Lebensraum“ in Europa und die Revanche für Versailles werden mit Röhms Landsknechten nicht zu machen sein, wohl aber mit dessen Todfeinden, den Generälen der Reichswehr, die den SA-Chef als personifizierte Unverschämtheit verachten. Diese Fehde als Machtkampf anzuheizen, das vermag die „Marburger Rede“ perfekt.
Hitler erfährt noch am 17. Juni 1934, dass und wie von Papen aus der Reihe tanzt. Als er gegen Abend vor Anhängern auf dem Schützenplatz in Gera spricht, wissen die freilich nicht, wer gemeint ist, als ihr Idol berstend vor Wut aus der Rolle fällt: „Lächerlich, wenn ein solch kleiner Wurm gegen eine solch gewaltige Erneuerung unseres Volkes ankämpfen will. Lächerlich, wenn ein solcher Zwerg sich einbildet, durch ein paar Redensarten eine gigantische Erneuerung hemmen zu können.“ „Zwerge“ und „Würmer“ wie von Papen und Jung haben sich zu „Redensarten“ erkühnt wie: „Die Vorherrschaft einer einzigen Partei anstelle des mit Recht verschwundenen Mehr-Parteien-Systems erscheint (…) geschichtlich als Übergangszustand, der nur so lange Berechtigung hat, als er die Sicherung des Umbruchs verlangt, und bis die neue personelle Auslese in Funktion tritt.“
Zu den Todgeweihten zählen Kurt von Schleicher
Mit anderen Worten, der NSDAP wird das Machtmonopol bestritten. Das klingt nicht nur danach – das ist Meuterei. Hitler muss handeln, und er tut es. Die „Marburger Rede“ wird zum ultimativen Anstoß, um den Enthauptungsschlag gegen die SA-Führung, aber ebenso konservative Opponenten zu führen. Am 30. Juni 1934 ist es so weit. Zu den Todgeweihten zählen Kurt von Schleicher, Hitlers Vorgänger als Reichskanzler, sein Vertrauter Ferdinand von Bredow, exponierte Katholiken wie Erich Klausner und Jugendbundführer Adalbert Probst, von Papens Pressechef Herbert von Bose, NSDAP-Dissidenten wie Gregor Strasser – mehr als hundert Missliebige, für die es nun kein Pardon mehr gibt. Edgar Jung wird in den Abendstunden des 25. Juni 1934 in seiner Berliner Wohnung verhaftet und taucht nie wieder auf. Es gibt keine deutsche „Bartholomäus-Nacht“, alles geschieht am helllichten Tag. Wenn die Sonne scheint, lässt sich besser erkennen, dass Hitler, die SS und Gestapo unter Heinrich Himmler keine Skrupel kennen, sich der Macht des Dolches zu bedienen. Gemordet wird demonstrativ öffentlich. In der Babelsberger Villa von Schleichers, in den Büros von Bredows, von Boses und Klausners. Die Leichen bleiben liegen, soll sich darum kümmern, wer will. Ernst Röhm, durch Hitler im bayerischen Bad Wiessee persönlich verhaftet, soll sich im Gefängnis München-Stadelheim erschießen und wird erschossen, als er zaudert – da sind viele der höheren SA-Führer schon tot.
Warum 90 Jahre später ein Massaker ins Gedächtnis rufen, das bis heute mit dem irreführenden Etikett „Röhmputsch“ versehen wird? Und dessen Ausmaß verblasst angesichts dessen, was noch kommen soll. Es hat viel mit Selbstbetrug zu tun, wie ein dankbares Bürgertum mit Hitler sympathisiert und doch weiß, dass verbrecherische Inbrunst kein temporäres Phänomen, sondern systemrelevant ist. Sich darüber hinwegzutäuschen, entfällt mit dem 30. Juni 1934 mehr denn je. Der Mord als Mittel staatlicher Politik wildert in den Gefilden der Etablierten. Hitler gebietet als „oberster Gerichtsherr“ über Leben und Tod. Erst jetzt wird die Machterschleichung von 1933 endgültig zur Machtergreifung. Man entledigt sich lästiger Komplizen, die als „Geschwüre unserer inneren Brunnenvergiftung auszubrennen“ waren, verkündet Hitler am 13. Juli 1934 vor dem „Reichstag“. Die „konservativen Revolutionäre“ um Edgar Jung haben die Machtprobe gewagt und nach allen Regeln des Mobs verloren. Kollaborateure, die sich hintergangen fühlen, sind keine Antifaschisten, sondern um sich selbst besorgt, um Prestige und Pfründe. Einer Diktatur kann wenig anhaben, wer nur mehr davon abhaben will – diese Botschaft hat es verdient, zeitlos zu sein.
Und der „Marburger Redner“ Franz von Papen? Dass er den 30. Juni 1934 überlebt, ist allein der Tatsache zu verdanken, dass Hindenburg noch lebt, als die Mordstaffeln ausrücken. Statt ihn als „kleinen Wurm“ zu zertreten, schickt ihn Hitler als Sondergesandten nach Wien. Der Einmarsch von 1938 wirft seine Schatten voraus.