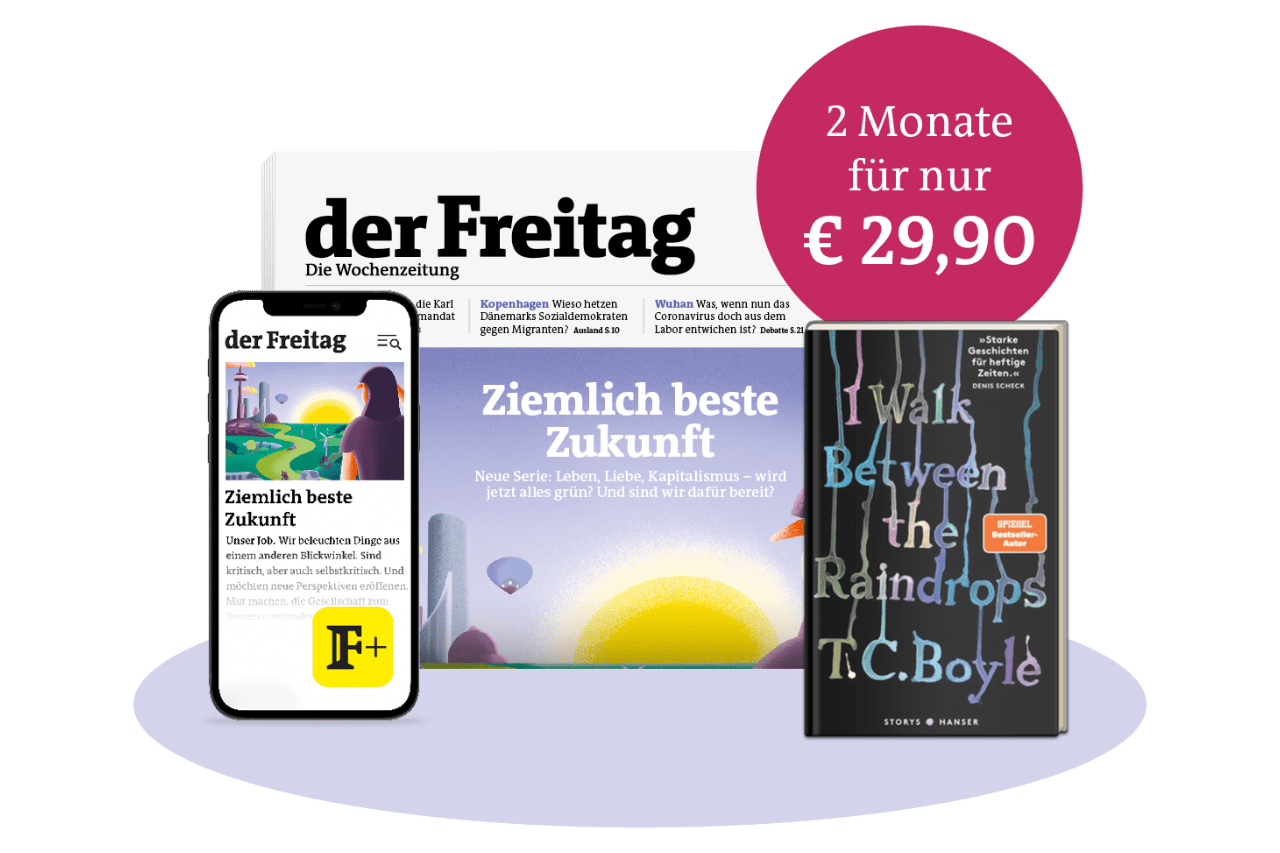Serbiens Regierungschef Aleksandar Vućić war nach Srebrenica gekommen, um sich für das Massaker an 8.000 bosnisch-muslimischen Männern zu entschuldigen. 1995 hatten dort bosnisch-serbische Einheiten Muslime systematisch hingerichtet. Nun aber attackierte die aufgebrachte Menge Vućić, nur mit Mühe gelang ihm die Flucht. Er betonte gleichwohl, die Bemühungen um eine Wiederversöhnung würden fortgesetzt. Gibt es einen Grund, sich über das Ereignis zu wundern? Umso erfreulicher, dass es den Versöhnungsprozess nicht aufhalten kann.
Erörterungsbedüftig bleibt der Umstand, dass nicht alle beteiligten Seiten bereit sind, den Ausdruck „Völkermord“ auf das Massaker vor zwanzig Jahren anzuwenden. Auch Vućić, der zweifellos echte Reue zeigte, mochte es in seine Entschuldigung nicht aufnehmen. Er repräsentiert damit die Haltung der serbischen Bevölkerung. Der Internationale Gerichtshof und das UN-Kriegsverbrechertribunal haben sich längst dafür entschieden, das Massaker Völkermord zu nennen. Viele Einwohner der serbisch umzingelten Stadt Srebrenica hatten sich in das sechs Kilometer entfernte Dorf Potoćari geflüchte. Es lag innerhalb einer von der UNO definierten Schutzzone, eine niederländische UN-Schutztruppe hatte dort ihren Standort. Die bosnisch-serbischen Truppen nahmen ihn trotzdem ein. Sie ließen nur die Evakuierung der Frauen und Kinder zu. Die Männer trieben sie zusammen – und töteten sie.
Zu denen, für die das kein Völkermord ist, gehört neben einigen linken Zeitungen auch Russland. Dessen Vertreter verhinderte in der vorigen Woche im UN-Sicherheitsrat eine entsprechende Resolution. Der Widerstand gegen den Begriff scheint in keinem Fall dadurch motiviert, dass der Tatbestand der Erschießungen etwa nicht mit der Definition des Verbrechens übereinstimmen würde. Wer das Geschehen anders bewertet, argumentiert mit Verbrechen der anderen Beteiligten. Die Verurteilung der bosnischen Serben etwa wird einseitig genannt. Wahr ist, dass im Kampf um Srebrenica auch bosnische Muslime Kriegsverbrechen begangen haben. Auch die Rolle der niederländischen Blauhelme, die nichts getan haben, um die Opfer zu schützen, erscheint bis heute zwielichtig.
Und was soll man erst von den großen westlichen Mächten sagen, die dem von der UNO ausgerufenen Schutz militärischen Nachdruck hätten verleihen können? Nicht umsonst spricht die UN-Konvention gegen den Völkermord schon im Titel von dessen Bestrafung, aber auch Verhütung. Hierzu waren die USA nicht bereit, die sich zwar gerne auf Menschenrechte berufen, wenn es einen Krieg zu rechtfertigen gilt, den sie um geopolitischer Interessen willen führen. Sonst aber rühren sie kaum einen Finger. Bald nach „Srebrenica“ führten sie den völkerrechtswidrigen Krieg an, in dem die Nato half, Serbien die Provinz Kosovo zu entreißen.
Trotzdem, Völkermord bleibt Völkermord. Der Begriff entbindet eine nützliche Dynamik. Diejenigen, welche ihn zu vermeiden suchen, sind umso mehr gezwungen, sich mit eigener schrecklicher Schuld auseinanderzusetzen. So wurde jetzt in Deutschland amtlich anerkannt, dass die Massaker an den Hereros zu Beginn des 20. Jahrhunderts Völkermord waren. Dem war eine Debatte über die Vorsicht derselben Regierung vorausgegangen, den türkischen Völkermord an Armeniern als solchen zu benennen. Das spielte sicher bei der Bewertung des Kriegs der Deutschen gegen die Hereros eine Rolle.