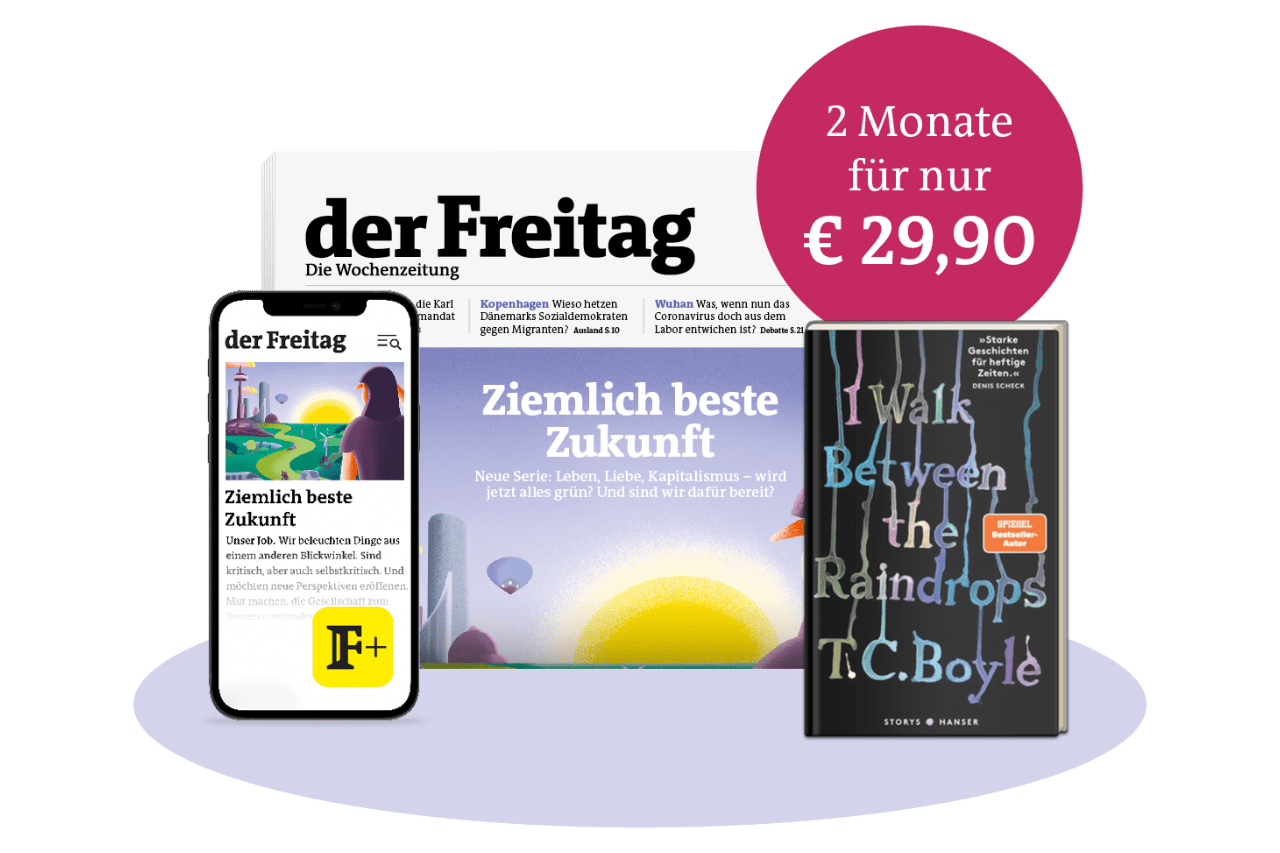Es hätte alles so einfach sein können: Der Bund gönnt eine Milliardenspritze, und schon werden alle Schulen in Deutschland auf Vordermann gebracht, mit Breitbandanschluss ausgestattet, mit Tablets versorgt. Jetzt aber haben die Bundesländer dem jahrelang ausgehandelten Digitalpakt einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Auf dem Weg zur Verwirklichung“ der Ziele des Digitalpakts „dürfen aber nicht zentrale Grundsätze des deutschen Föderalismus über Bord geworfen werden“, schrieben Volker Bouffier, Winfried Kretschmann, Michael Kretschmer, Armin Laschet und Markus Söder in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. „Der Bund kann und muss nicht das Recht bekommen, die Länder in ihren traditionellen Kernkompetenzen zu steuern und zu kontrollieren.“ Sie haben recht.
Denn die von Union, SPD, Grünen und FDP im Bundestag verabschiedete Grundgesetzänderung ist sehr wohl ein Angriff auf den Föderalismus. Bildung ist Ländersache. Wer der Meinung ist, das solle sich ändern, muss offensiv für einen vermeintlich vorteilhaften Bildungszentralismus eintreten und derartiges Ansinnen nicht in letzter Minute zwischen die Zeilen einer Grundgesetzänderung schreiben. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, hat im Deutschlandfunk erklärt, wie sich die nun vom Bundesrat blockierte Grundgesetzänderung konkret auswirken würde: Der Bund könne eigene Lehrer-Fortbildungsinstitute gründen, Einfluss auf die Lehrpläne in Sachen Digitalisierung nehmen oder auch eigene weisungsgebundene Systemadministratoren einstellen.
Hinzu kommt das geplante Finanzierungs-Prozedere, wonach Bund und Länder Projekte zu je 50 Prozent bezahlen. Das könnte dazu führen, dass der Bund Mittel offeriert, zu denen die Länder nur ja oder nein sagen können, was das Haushaltsrecht ihrer Landtage einschränken würde. Vor allem aber fürchten kleine, finanzschwächere Länder wie Sachen-Anhalt, einen 50-Prozent-Anteil nicht stemmen zu können.
Sonderfonds hier, Milliardenspritze dort
Das verweist auf ein grundlegendes Problem: Gerade in den Kommunen fallen die großen, im Alltag spürbaren Probleme unserer Zeit an – vergammelte Schultoiletten, marode Brücken, riesige Defizite an Wohnraum in öffentlichem Eigentum. Und immer wieder folgt, wenn überhaupt, die gleiche Antwort auf diese Probleme: Der Bund setzt Sonderfonds auf und schüttet von oben nach unten Milliarden aus. Das kann in Situationen unter akutem Handlungsdruck, wie der Flüchtlingsunterbringung und -integration um das Jahr 2015 herum, Sinn machen. Im Allgemeinen aber läuft es der förderalen Idee des Konnexitätsprinzips, das „gesonderte Aufkommen von Bund und Ländern für Ausgaben, die sich aus der Wahrnehmung ihrer jeweiligen Aufgaben ergeben“ vorsieht, zuwider.
Eine progressive Antwort auf die in den Ländern und Kommunen virulenten Probleme wäre ein grundlegendes Nachdenken über das Einnahmeaufkommen und dessen Verteilung: Die Erbschaftssteuer kommt direkt den Ländern zu, hier verzichtet die öffentliche Hand aber nach wie vor und unter kräftiger Mitwirkung von CDU- und CSU-Ministerpräsidenten auf eine adäquate Besteuerung. Und um die den Kommunen zufließende Gewerbesteuer hat sich ein irrsinniger Wettbewerb entwickelt, in dem die reichen Gemeinden niedrige Hebesätze ausloben und so noch mehr Unternehmen anziehen, während die armen Gemeinden hohe Sätze brauchen, um ihre Haushalte einigermaßen ins Lot zu bringen. Fern ist letzteres schließlich dort, wo Kommunen unter riesigen Schuldenlasten ächzen und zu eigenständiger Politik ohnehin kaum mehr in der Lage sind. Hier ist ein resolutes Entschuldungsprogramm überfällig, soll dem Verfassungsziel gleichwertiger Lebensverhältnisse und der Beseitigung des Milliarden-Investitionsstaus wieder Priorität zukommen.