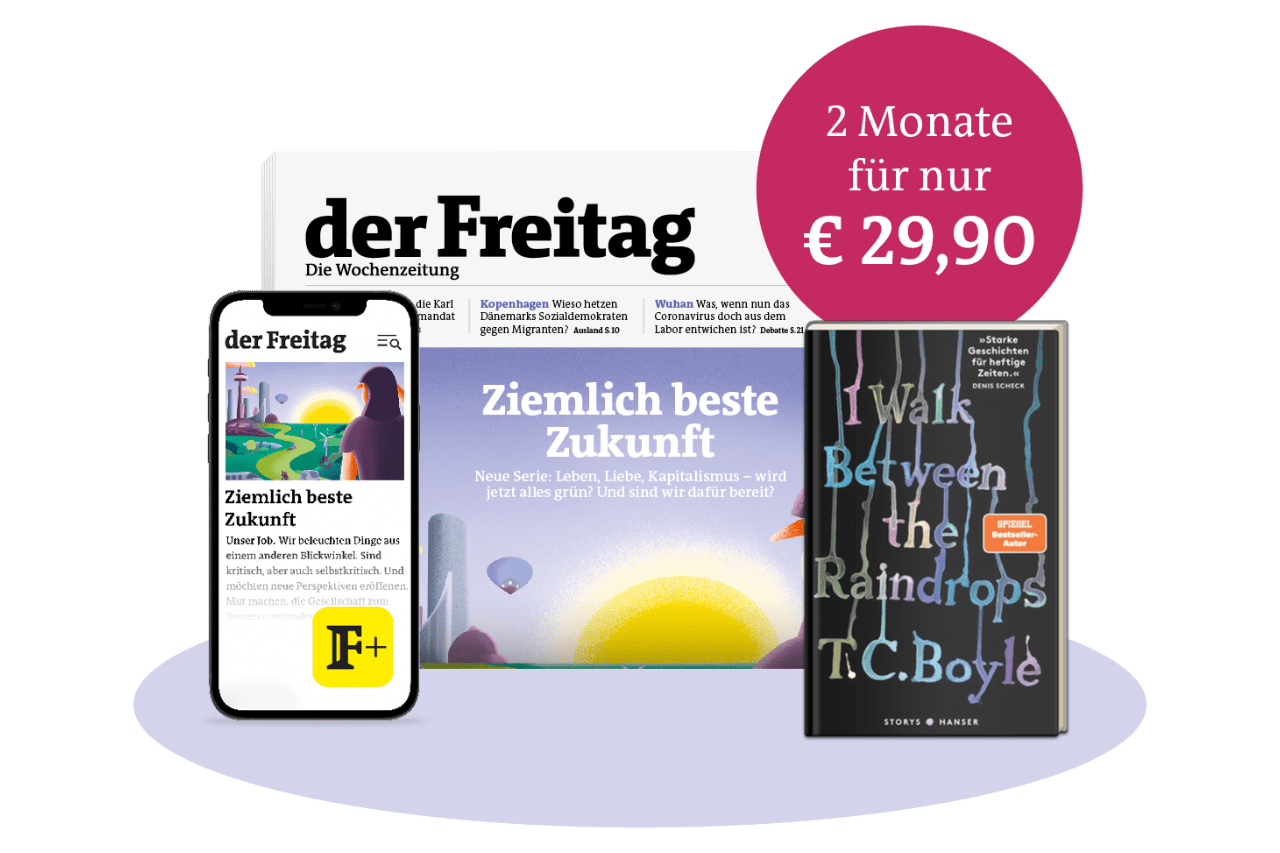Das war zu erwarten, nicht mal eineinhalb Jahre vor der nächsten Bundestagswahl: Olaf Scholz ist für einen höheren Mindestlohn. Erstmal 14, dann 15 Euro sollten es schon sein, hat er jetzt dem Stern gesagt, und verwundern kann das kaum: Erstens hat der heutige Kanzler schon im Wahlkampf 2021 als SPD-Spitzenkandidat mit dem Thema gepunktet (damals forderte er zwölf Euro, die dann auch von der Ampelkoalition beschlossen wurden). Zweitens kann es seiner Partei nicht schaden, wenn ihr wichtigster Mann mal die Mehrheit hinter sich weiß: Gerade hat eine Umfrage 57 Prozent Zustimmung zu einer Lohnuntergrenze von 15 Euro ergeben. Und drittens, nicht zu vergessen: In diesem Fall hat Olaf Scholz gute Argumente.
Die aktuelle Begründung hat der Kanzler jetzt selbst geliefert: Die Mindestlohn-Kommission aus Vertreterinnen und Vertretern der Tarifparteien hat sich mit ihrer jüngsten Festlegung disqualifiziert. Eine Erhöhung von zwölf auf nur 12,41 Euro in diesem und 12,82 Euro im kommenden Jahr hatte die Arbeitgeberseite im Sommer 2023 mit Unterstützung der „neutralen“ Vorsitzenden durchgesetzt, gegen den Widerspruch der Gewerkschaften. Damit hat die Kommission genau das provoziert, was die Kapitalseite eigentlich am meisten scheut: Die Erkenntnis wächst, dass ohne politisches Zutun, also ohne den so verhassten Staat, ein angemessener Mindestlohn nicht durchzusetzen ist.
Was unter „angemessen“ zu verstehen sei, ist natürlich umstritten, aber Olaf Scholz hat weithin anerkannte Kriterien auf seiner Seite: Die EU empfiehlt eine Untergrenze von 60 Prozent des mittleren Einkommens, und das entspricht auch dem Wert, der allgemein als Schwelle zur Armutsgefährdung angesehen wird. Damit läge der Mindestlohn schon jetzt bei mehr als 14 Euro.
Nun ist es eher nicht so, dass Olaf Scholz von einem übertrieben sozialen Gewissen geplagt würde – im selben Atemzug mit seiner Mindestlohn-Forderung schloss er sich den Sparvorgaben seines marktradikalen Finanzministers Christian Lindner (FDP) für den Haushalt 2025 an, die ohne Folgen für die sozialstaatliche Leistungen kaum einzuhalten sein werden. Aber zum einen kostet der Mindestlohn den Staat ja nichts, er spart im Gegenteil Kosten für diejenigen, die ihre Niedriglöhne aufstocken müssen. Zum anderen dürfte der Kanzler sehr genau wissen, welche Rolle dieses Instrument in der „sozialen Marktwirtschaft“ der Gegenwart spielt.
Es gibt keine „Waffengleichheit“ zwischen Kapital und Arbeit
Der Mindestlohn lässt sich als Ersatzteil für ein zentrales Instrument des kooperativen Wirtschaftsmodells beschreiben: die Tarifautonomie. Es mag schon sein, dass die „Waffengleichheit“ zwischen Kapital und Arbeit auch früher mehr Fiktion als Wirklichkeit war. Aber in Zeiten einer hohen Tarifbindung, einer stark organisierten Arbeitnehmerschaft und eines noch begrenzten Drohpotenzials heimischer Unternehmen mit Abwanderung in Niedriglohnländer ließen sich halbwegs angemessene Einkommen für die Mehrheit der Beschäftigten tendenziell noch eher durchsetzen, im Zweifel mit der entsprechenden politischen Begleitmusik.
Seit sich die Politik überparteilich dem neoliberalen Sozialdumping zumindest grundsätzlich angeschlossen hat – Scholz‘ Parteifreund Gerhard Schröder war daran bekanntlich führend beteiligt –, reicht die Tarifautonomie als stabilisierender Faktor der kapitalistisch geprägten Gesellschaft nicht mehr aus: Zu sehr haben die gezielte Förderung des Niedriglohnsektors, Tarifflucht und globale Lohnkonkurrenz die Gewerkschaften geschwächt. Sie haben ja selbst einige Zeit gebraucht, bis sie die Notwendigkeit des gesetzlichen Mindestlohns als Folge ihrer Schwächung im Neoliberalismus erkannten. Noch im Jahr 2005 zitierte der Deutschlandfunk einen hohen IG-Metall-Funktionär mit den Worten: „Man kann nicht auf der einen Seite sagen: Tarifautonomie, der Staat soll sich raushalten aus Lohnverhandlungen, und auf der anderen Seite beim Staat einfordern, er möge einen Mindestlohn festsetzen.“
So reden heute nur noch Unternehmenslobbyisten und ihre Gefolgsleute in FDP oder CDU/CSU. Sie akzeptieren zwar den Mindestlohn, wollen seine Festsetzung aber bei der Kommission belassen, in deren Zusammensetzung ja die Tarifautonomie abgebildet werden soll. Sie tun das, weil sie um die Kräfteverhältnisse zwischen Kapital und Arbeit wissen, die sich in der Entscheidung vom vergangenen Jahr über die Mini-Erhöhung ja deutlich gezeigt haben.
Nein, der Staat kann und soll nicht alles. Aber wenigstens darüber, wo Löhne ihre Unter-, also Ausbeutungsverhältnisse ihre Obergrenze haben, sollte er entscheiden – jedenfalls so lange, wie sich an den Kräfteverhältnissen zwischen Kapital und Arbeit nichts ändert. Das wird leider auch unter einem Kanzler Olaf Scholz nicht geschehen. Aber es ist ja schon mal was, dass er die Verhältnisse wenn schon nicht ändern, so doch lindern will.