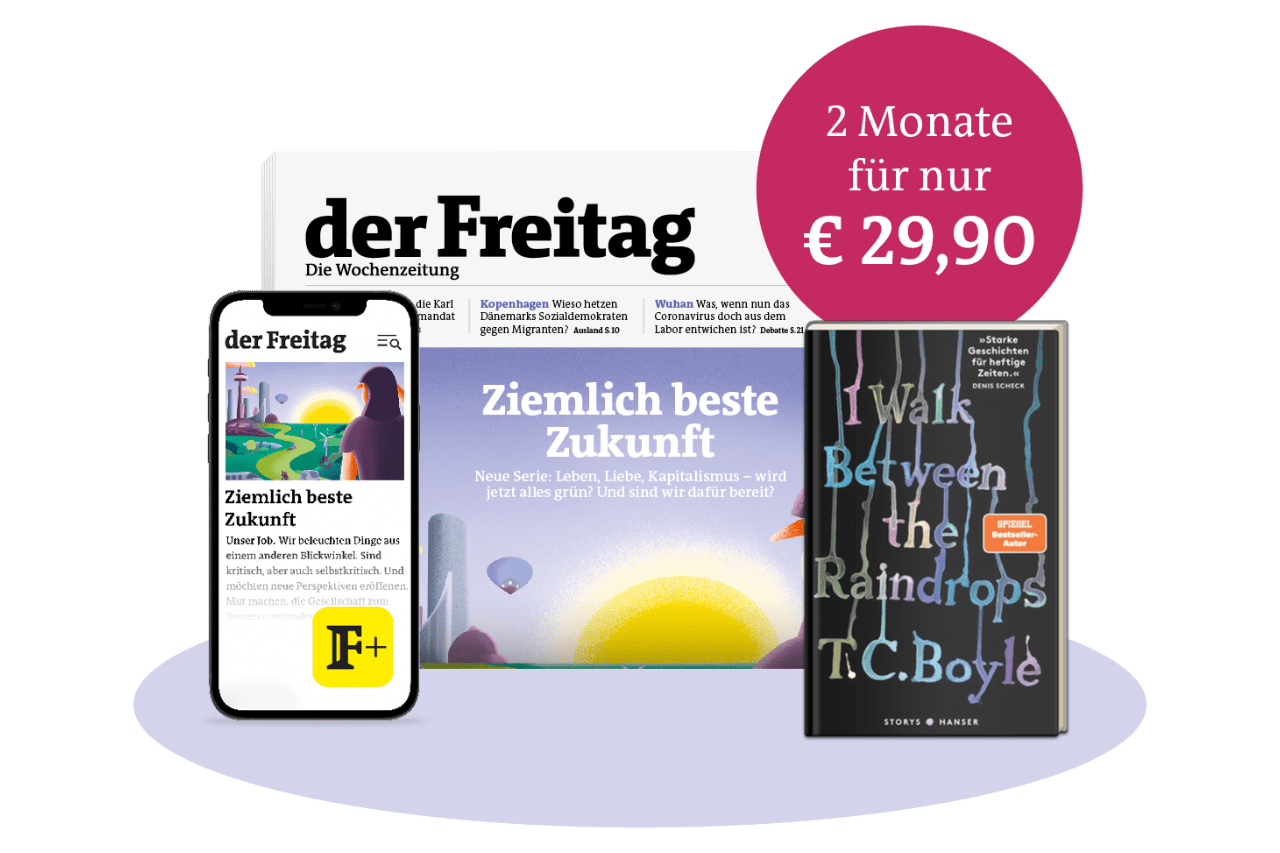Im Winter 2013 ließ ein Zusammenbruch des Polarwirbels eiskalte Luft nach Süden in Richtung des nordamerikanischen Kontinents entweichen. Als Eisstürme, Tornados und Schneestürme über die USA hinwegfegten, twitterte Donald Trump: „Ich bin in Los Angeles und es ist eiskalt.“ Die globale Erwärmung sei „ein totaler und sehr teurer Schwindel!“ Das Ganze erinnerte ein wenig zu sehr an Roland Emmerichs Katastrophenfilm „The Day After Tomorrow“, der damit beginnt, dass die US-Regierung die wissenschaftlichen Bedenken über den Verlust eines riesigen Stücks des antarktischen Schelfeises beiseite schiebt. Die Forscher werden bald eines Besseren belehrt: Innerhalb weniger Tage löst das schmelzende Eis eine Kette verrückter Wetterereignisse aus, die in einem globalen Supersturm gipfeln, der die gesamte nördliche Hemisphäre in eine neue Eiszeit stürzt.
Der Film, der im Sommer 2004 ein Kassenschlager war, wurde von Kritikern und Wissenschaftlern gleichermaßen verspottet. Mitglieder eines Internet-Chatrooms zahlten dem Paläoklimatologen William Hyde angeblich 100 Dollar, um den Film zu sehen. „Dieser Film ist für die Klimawissenschaft das, was Frankenstein für die Herzchirurgie war“, lautete sein Fazit.
Dennoch zeigte eine Reihe von Studien, dass der Film die öffentliche Meinung über die Klimakrise beeinflusste. Zwanzig Jahre nach seinem Erscheinen ist er immer noch ein Unikat: ein Klimakatastrophen-Blockbuster, der alle Grundsätze des Genres einhält und gleichzeitig sein Gemetzel ausdrücklich auf den Treibhauseffekt zurückführt. Also: Was können wir von dem Werk lernen?

Foto: Imago
Im Großen und Ganzen erzählt „The Day After Tomorrow“ die Geschichte des fiktiven Paläoklimatologen Jack (Dennis Quaid) und seines mürrischen jugendlichen Mathe-Wundersohns Sam (Jake Gyllenhaal). Während der Supersturm über New York hereinbricht, überleben Sam und der Rest seines Gefolges mit Mars-Riegeln aus Verkaufsautomaten und der Wärme angezündeter Bücher. In der Zwischenzeit macht sich Jack mühsam auf den Weg zur Rettung, mit rot gefärbter Nase und vor Frost glitzernden Bartstoppeln.
Wie jeder Katastrophenfilm ist auch „The Day After Tomorrow“ gespickt mit Ungenauigkeiten, Klischees und seltsamen Machos (in einer Szene kämpft Gyllenhaal auf einem gefrorenen Geisterschiff gegen Wölfe). Aber wenn überhaupt, dann ist die Absurdität des Films näher an unserer Realität im Jahr 2024 als im Jahr 2004. Schließlich leben wir im Zeitalter des Klimasurrealismus. Heute ist the day after tomorrow, murmeln wir vor uns hin, während wir von alten, mit Milzbrand infizierten Rentierkadavern lesen, die am Polarkreis auftauen.
In diesem Winter-Höllen-Wunderland gibt es Momente, die man fast als gemütlich bezeichnen könnte: Sams Freundin stirbt zwar an einer Sepsis, aber sie verlieben sich auch in Decken eingewickelt am Feuer, während ihre Begleiter alte Gutenberg-Bibeln bewundern und darüber diskutieren, ob man Nietzsche ins Feuer werfen sollte oder nicht.

Foto: Imago
Mit seinen Jedermann-Protagonisten gelingt Emmerich ein perfekter Trick: Er verlagert die Frontlinie der Klimakatastrophe vom Globalen Süden in den Globalen Norden. US-Bürger müssen nach Mexiko fliehen und dort um Asyl betteln. Das mag ein zynisches Mittel sein (das amerikanische Publikum interessiert sich nur für den Tod von Amerikanern), aber es ist auch ein raffiniertes politisches Manöver, das die falsche Botschaft des Universalismus untergräbt, die praktisch überall sonst im Film zu hören ist. In dieser Welt, wie auch in unserer eigenen, sitzen wir nicht „alle im selben Boot.“
Es gibt einen Grund, warum die meisten Hollywood-Regisseure sich von Klimageschichten ferngehalten haben: Die Menschen gehen in Katastrophenfilme nicht nur wegen der Erfahrung des Schreckens, sondern auch, um sich zu entspannen. Alles in allem kann man es Emmerich also nicht verübeln, dass er dem Publikum das Ende gibt, für das es eine Eintrittskarte gekauft hat. Als sich der Sturm gelegt hat, ist das Klima der Erde dank eines praktischen Phänomens, des „Albedo-Effekts“, wieder im Gleichgewicht. Es herrscht Frieden auf der Erde und Sam gewinnt das Mädchen. Für fünf Minuten, während der Abspann läuft, können wir unser Grauen beiseiteschieben.