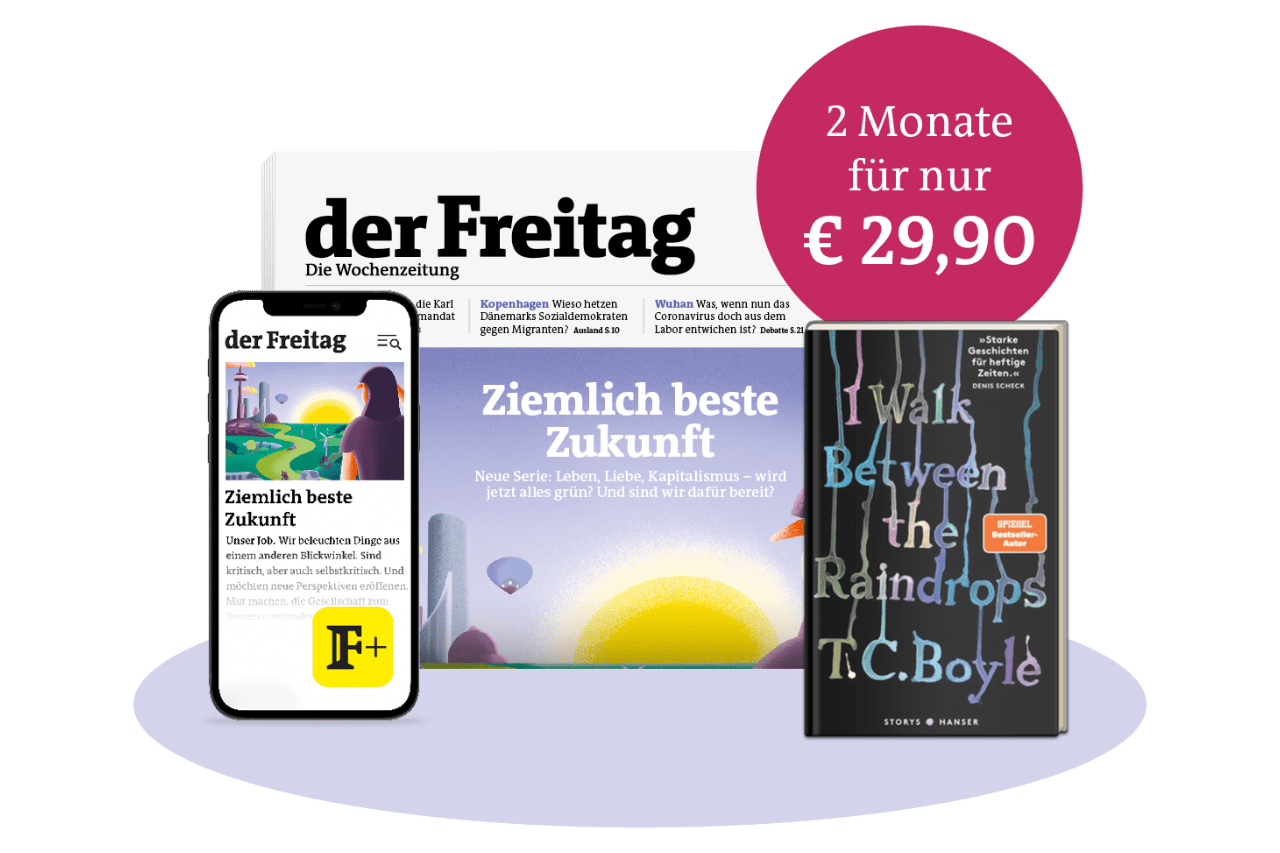In Iserlohn wurde ein 60-jähriger Mann wegen wiederholter sexueller Handlungen mit einem Mädchen zu einer Haftstrafe verurteilt. Ein 48-jähriger Angeklagter erklärt sich vor dem Amtsgericht in Lüdenscheid für schuldig, seine Nichte über Jahre hinweg sexuell missbraucht zu haben. Das Landgericht Dessau-Roßlau bringt einen Sporttrainer für neun Jahre und sechs Monate hinter Gitter, weil er gegen die ihm anvertrauten Mädchen sexuell übergriffig geworden ist. Aus demselben Grund ist ein Klassenlehrer in Gera angeklagt. Und die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat gegen einen katholischen Pfarrer ein Verfahren unter anderem wegen Kinder- und Jugendpornografie eingeleitet.
Es sind aktuelle, zufällig herausgegriffene und justitiabel gewordene Fälle, die sich hinter den Zahlen verbergen, die die polizeiliche Hellfeldstatistik alljährlich veröffentlicht. Über die 16.375 aktenkundig gewordenen Fälle im Jahre 2023 hinaus existiert jedoch ein unbekannt großes Dunkelfeld. Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass bis zu einer Million Kinder und Jugendliche sexualisierte Gewalt erfahren haben und noch erfahren.
Noch viel verbreiteter sind Delikte im Bereich der sogenannten Kinderpornografie. Die in Deutschland verfügbaren Daten sind ungenau, weil die Prävalenzforschung zur Häufigkeit von sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche noch in den Kinderschuhen steckt. Auch das soll sich nun ändern. Nach Jahren der Verzögerung und Hinhaltepolitik hat das Kabinett nun endlich das „Gesetz zur Stärkung der Strukturen gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen“ (Antimissbrauchsbeauftragtengesetz) auf den Weg gebracht. So umständlich der Name, so wichtig und weitreichend der Inhalt.
Worauf Kerstin Claus hofft
Allerdings ließ die dafür verantwortliche Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) die „hohe gesamtgesellschaftliche Relevanz“ des Gesetzes doch recht niedrig hängen, als sie jüngst die Presse zu einem sogenannten Doorstep zusammenrief. Im engen, lediglich mit vier dekorativen Plexiglaswürfeln ausgestatteten Raum drängten sich die Kolleg:innen stehend um die Kameraleute, das Ambiente verhieß eher Schnelldurchlauf und raschen Rauswurf als das zu erwartende Pressegespräch. Das sei ein „wichtiger Tag“, erklärte dennoch die Ministerin und feierte das „gute Gesetz“, das nun alsbald ins parlamentarische Verfahren gehen könne.
Das „gute Gesetz“ beendet zunächst einmal einen lange währenden Missstand. Denn seit 2010, dem Zeitpunkt, als die Fälle sexualisierter Gewalt im Umfeld der katholischen Kirche bekannt wurden und der mit dem Thema befasste Runde Tisch für die Einsetzung einer Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) sorgte, hängt das Amt in der Luft. Zuerst von der ehemaligen Bundesfamilienministerin Christine Bergmann (SPD) bekleidet, biss sich über zehn Jahre Johannes-Wilhelm Rörig die Zähne daran aus, die Institution auf Dauer zu stellen. Seit 2022 macht nun Kerstin Claus (der Freitag 15/2022) Druck auf die Politik, im Rücken den Koalitionsvertrag, in dem ein derartiges Gesetz vereinbart wurde.
Künftig soll die oder der Bundesbeauftragte wie die Wehr- und Polizei- oder der Bundesdatenschutzbeauftragte also eine dauerhafte Einrichtung werden, vom Bundestag in jeder Legislaturperiode bestellt und dem Parlament gegenüber rechenschaftspflichtig. Die Berichtspflicht gegenüber dem Bundestag, so die Unabhängige Beauftragte Kerstin Claus, sei die „politische Säule des Gesetzes“, die es erlaube, das Thema regelmäßig in der öffentlichen Wahrnehmung zu halten und Politiker zu zwingen, sich damit zu befassen. Gleichzeitig hofft sie, durch vertiefende Forschung endlich verlässliche Zahlen zu sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche eruieren zu können. Zu den Aufgaben der Bundesbeauftragten wird es laut Gesetz gehören, für die Belange der Betroffenen einzutreten, Präventionsmaßnahmen vorzuschlagen, die Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs und diesbezügliche Forschung voranzutreiben und Hilfeleistungen zu fördern. Das Amt wird mit zwölf Millionen Euro ausgestattet und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung verpflichtet, die Arbeit im Rahmen von Aufklärungskampagnen zu unterstützen.
Opfer-Hilfe kommt zu kurz
Auch der bei der Bundesbeauftragten angesiedelte Betroffenenrat und die seit 2016 tätige Aufarbeitungskommission, die beide ehrenamtlich arbeiten, werden gesetzlich abgesichert. Während der Betroffenenrat sich insbesondere um die individuelle Aufarbeitung von Missbrauchsgeschehen und die Stärkung der Betroffenen bemüht, erforscht die Aufarbeitungskommission unter anderem Tatkontexte zu sexualisierter Gewalt, indem sie die bislang 2.000 vertraulichen Anhörungen und 760 schriftlichen Berichte auswertet und das Onlineportal geschichten-die-zaehlen.de, in dem Betroffene von ihren Missbrauchserfahrungen berichten, unterhält. Neu ist die Einrichtung eines Forschungszentrums zu sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen.
All dies betrifft die institutionelle Ebene. Doch vielfach beklagen betroffene Menschen, dass es ihnen an konkreten Hilfen mangelt, sowohl im Hinblick auf ihre Rechte als auch der psycho-sozialen Unterstützung bei der Aufarbeitung. Sie fühlen sich alleine gelassen, wenn sie bei Ämtern oder Schulen Akteneinsicht fordern, und haben, wie Claus sagt, oft das Gefühl, jedes Mal das Rad neu erfinden zu müssen.
In dieser Hinsicht erweist sich der Gesetzesentwurf kleinmütiger als erhofft. Zwar wird missbrauchsbetroffenen Menschen nun die Einsicht in die Akten der Jugendämter gewährt, Schulen und andere den Ländern unterstehende Einrichtungen wie Sportvereine – von den Kirchen gar nicht zu reden – bleiben jedoch ausgenommen. Claus hofft hier auf das Vorbild des Bundes, dem Länder und andere Institutionen nacheifern. Doch auf weitergehende unterstützende Begleitung bei der Rekonstruktion ihrer Geschichte, die oft von vielen Hürden verstellt ist, können die Betroffenen nicht hoffen. Gerade einmal 2,5 Millionen lässt der Bund für die individuelle Beratung springen, das reicht allenfalls für die geplanten telefonischen Beratungsstützpunkte.
Auch zu dem vielfach geforderten Hilfefonds für Opfer sexualisierter Gewalt schweigt sich der Gesetzesentwurf aus. Oft benötigen Betroffene spezielle Therapien, die die Krankenkasse nicht bezahlt, oder andere Unterstützungsleistungen. Der bestehende Fonds Sexueller Missbrauch (FSM), der zwischen 2013 und 2023 mit 164 Millionen Euro ausgestattet war, steht jedoch vor dem Aus, nachdem der Bundesrechnungshof das laufende Bewilligungsverfahren moniert und eine zunehmende Finanzierungslücke festgestellt hatte und deshalb die „zügige Abwicklung“ forderte. Dem will das Ministerium erklärtermaßen zwar nachkommen, bis dahin jedoch das Haushaltsrecht außer Kraft setzen, weil für 2024 keine Mittel mehr fließen. Wie es für die Hilfesuchenden danach weitergeht, lässt auch der Gesetzgeber offen. Wieder einmal bleiben ihre unmittelbaren Belange auf der Strecke.
EU gegen Cyberkriminalität
Mit einer neuen Richtlinie begegnet indessen die Europäische Union der Cyberkriminalität in diesem Bereich, um auch den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz Rechnung zu tragen. So sollen KI-generierte Darstellungen, sogenannte Deepfakes, als Missbrauch gelten, außerdem soll das Cybergrooming, die Anbahnung von sexuellen Kontakten mit Kindern, unter Strafe gestellt werden, desgleichen Onlinedienste, die zu diesen Zwecken betrieben werden. EU-weit könnten außerdem verdeckte Ermittler, die mit „Honeyspots“ arbeiten – einschlägige Abbildungen, die potenzielle Täter anlocken –, unterwegs sein. Geplant ist außerdem, Kinder durch eine kindergerechtere Justiz zu schützen.
Nicht zu verwechseln ist diese Richtlinie mit der EU-Verordnung zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern, die unter dem Stichwort „Chatkontrolle“ unter Beschuss geraten ist und in Deutschland zu einer Abschwächung des entsprechenden Gesetzes geführt hat. Interessant dabei: Die EU-Rechtssprache vermeidet nun den verharmlosenden Begriff „Kinderpornografie“ und ersetzt ihn durch „Darstellung sexuellen Missbrauchs von Kindern“. Als wäre der Begriff Missbrauch nicht ebenfalls höchst umstritten.