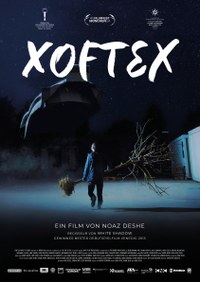Für uns kam er fast schon zu spät. Im katholischen Milieu der sechziger Jahre wurde man, wenn überhaupt, mit Kurt Seelmann aufgeklärt, und eine knallgelbe Provokation namens SexFront hätte die Schwelle unserer Jugendzimmer offiziell kaum überwunden. Während wir uns den Spaß am Sex, den Günter Amendts 1970 erschienene Verführungsschrift mit seinen „pornografischen“ Abbildungen versprach, also praktisch erkämpften, wurde seine Anleitung zum „Schulkampf“ so etwas wie eine Bibel: Kinderkreuzzug oder Beginnt die Revolution an den Schulen (1968) lieferte der sich radikalisierenden Schüler- und Lehrlingsbewegung den Sprit für die beginnende Revolte.
Mehr als andere sozialwissenschaftlich orientierte Forscher ging es dem 1939 in Frankfurt geborenen Amendt um die Verbindung von Theorie und Praxis. Emanzipation war nicht nur „umfassend“ zu denken, sondern realisierbar in der Kritik an den Verhältnissen und der politischen Aktion. Das galt insbesondere für die sexuellen Beziehungen, die in der Leistungsgesellschaft zugerichtet werden. Dort anzusetzen, wo die Menschen noch nicht „verbogen“ sind, bei Kindern und Jugendlichen, war Amendts Interesse, seitdem er aus dem Hörsaal Adornos, gemeinsam mit den SDS-Mitstreitern Reimut Reiche und Martin Dannecker, an das Hamburger Institut für Sexualforschung gewechselt war.
„Sie kamen zu uns ans Institut, um von den Fronten draußen zu berichten“, erinnert sich der Sexualwissenschaftler Volkmar Sigusch. Und sie forderten das Fach heraus, indem sie an die blühende empirische Sozialforschung der Weimarer Republik anknüpften. Günter Amendt promovierte 1970 mit einer Studie über Sexualität bei Jugendlichen in der Drogensubkultur und verwies damit bereits auf sein späteres Interessensfeld.
Bob Dylans Maskenball
Denn spätestens mit dem Menetekel AIDS legte sich der Blues über das der Sexualität überantwortete Emanzipationspotential, insbesondere in der Homosexuellenbewegung, der Amendt diskret angehörte. In Büchern verlegte er sich auf die Kritik an der offiziellen Drogenpolitik, die blind sei für die ökonomischen Bedingungen und politischen Interessen: „Es ist eine Tatsache“, schrieb er 2009 im Freitag, „dass Menschen Drogen nehmen und nichts und niemand sie davon abhalten kann.“ Er erklärte die Prohibition für gescheitert, Abstinenz als gesamtgesellschaftliche Forderung sei „weder durchsetzbar noch akzeptabel“, sondern Ausdruck „totalitären Denkens“.
Insbesondere kritisierte er den widersprüchlichen Umgang mit chemischen Drogen wie LSD auf der einen und Enhancern auf der anderen Seite. Er war allerdings, das lässt sich an seiner Intervention zum Thema Kindesmissbrauch (in der Dezemberausgabe des Merkur) ablesen, nicht grenzenlos permissiv, wie sein unwandelbares 68er-Outfit hätte vermuten lassen. Er wusste um die jeweiligen Schäden, stemmte sich aber gegen die bigotte Heuchelei, die die Welt nur in schwarz und weiß kennt.
Vielleicht hat ihn an Bob Dylan, den er seit den siebziger Jahren kannte und dem er ein Buch gewidmet hat, vor allem der Mann mit den vielen Masken interessiert, über den Amendt anlässlich von Todd Haynes Film I’m not there an dieser Stelle geschrieben hat. Masken spielen im sexuellen und im Drogenrausch eine besondere Rolle. Manchmal folgt aus solchen Fluchten bittere Realität: Günter Amendt fand bei einem Unfall, in den ein offenbar bekiffter Autofahrer verwickelt war, den Tod.