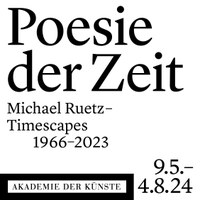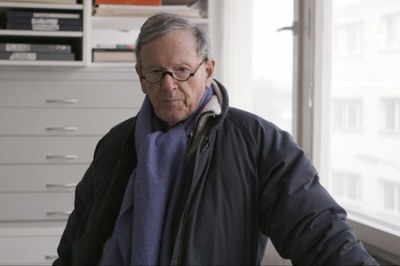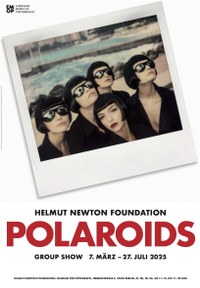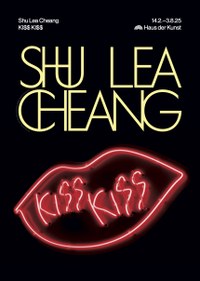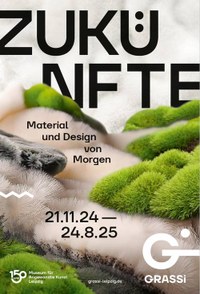Die Kuratorin der Ausstellung Franziska Schmidt, geboren 1972, ist freiberufliche Kunsthistorikerin und Kuratorin für die Fotokunst der Moderne. Zuletzt kuratierte sie Ausstellungen über die Künstlerinnen Helga Paris und Gabriele Stötzer. 2000/2001 war Franziska Schmidt Stipendiatin im Programm „Museumskuratoren für Fotografie“ der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, Essen. Nach beruflichen Stationen in der Galerie Berinson in Berlin, dem Museum für Photographie in Braunschweig und als Fotoexpertin eines Berliner Auktionshauses arbeitet sie seit 2017 als freie Fotohistorikerin, Autorin und Dozentin. Franziska Schmidt ist Mitglied in der DGPh. Ein Text von Franziska Schmidt, Kuratorin der Ausstellung:
„Die Fotografie ist eine perfekte Methode, wenn nicht die einzige, nicht nur das Sichtbare zu erfassen, sondern zugleich das Unsichtbare: die Zeit. Dieses Zitat von Michael Ruetz weist auf eine Fähigkeit der Fotografie hin, über den Augenblick hinausgehend Vergänglichkeit im Bild sichtbar zu machen. So lassen sich mit der Fotografie nicht nur die Spuren der Zeit festhalten, sondern auch ihre Wirkung auf eine Landschaft, einen Stadtraum oder eine Gesellschaft erfassen und damit auf Umweltprozesse, gesellschaftliche Umbrüche oder historische Verläufe verweisen. Diesen Themen hat sich der Fotokünstler Ruetz mehr als ein halbes Jahrhundert verschrieben und neuralgisch-markante Punkte in Deutschland und Europa bereist und erforscht, wie beispielsweise Brielle bei Rotterdam im Westen, Carolinensiel im Norden und Villanders im Brennertal im Süden oder Berlin mit der Mauer im Osten. Zeitgleich mit den Umwälzungen im Osten Deutschlands intensivierte er seine fotografische Arbeit Ende der 1980er-Jahre und erweiterte sein Projekt um Orte wie Leipzig und Dresden. Das sich rasant verändernde Berlin wurde dabei zunehmender zu seinem wichtigsten Schauplatz und zum Mittelpunkt seiner künstlerischen Auseinandersetzungen.
Insbesondere an der Stadtstruktur und -architektur Berlins lassen sich die Transformationen und tiefgreifenden Wandlungen der deutschen Geschichte und Gesellschaft aufschlussreich ablesen. In einer Stadt, die sich kontinuierlich im Werden befindet und niemals einfach nur ist, wie schon Karl Scheffler erkannte. Berlin hat nicht nur den Niedergang des Kaiserreiches und die Folgen zweier Weltkriege durchlebt, sondern auch die Teilung und Wiedervereinigung Deutschlands und den Umbau zur neuen deutschen Hauptstadt erfahren. In Berlin richtete Ruetz seine Fotokamera auf die sich stetig verschmelzenden Gebiete Ost- und Westberlins und auf die dann erwachsende globale Metropole. An den historischen Schnittstellen der Stadt suchte er nach den Spuren der Umbauprozesse der vergangenen Jahrzehnte, die bis in die Gegenwart reichen. Gebäude, Plätze, Straßen und Flächen spiegeln jene historischen und gesellschaftlichen Entwicklungen sowie Verwerfungen und Hoffnungen eindrucksvoll wider und lassen zahlreiche Facetten und reflektierende Zwischenräume erahnen, in denen gelebte und gegenwärtige Zeit ineinanderfließen.
Die mit einer Linhof-Technorama über lange Zeitperioden festgehaltenen Fotografien formen in von Ruetz so bezeichneten Timescape-Sequenzen visuelle Zeitlandschaften. Dabei ist eine einzelne Sequenz in verschiedene Bildphasen unterteilt, die zwar auch als Einzelbilder gelesen werden, aber nur in der Abfolge einen inneren Zusammenhang erkennen lassen können. Jedem Bild werden dabei genaueste Angaben zum Standort der Kamera und Aufnahmezeit zugeordnet. Orte und Blickrichtung wurden mit geografischen Koordinaten festgehalten, jede Aufnahme wurde in ihren Entstehungsbedingungen dokumentiert. Das jüngst zu Ende geführte Timescape Nr. 162 mit dem Brandenburger Tor zum Beispiel entstand in siebzehn Phasen zwischen Montag, dem 4. Februar 1991 um 17:30 Uhr und Montag dem 28.08.2023 um 10:33 Uhr und hat die Aufnahmekoordinaten: N 52° 31.010' E13° 22.779' mit der Blickrichtung: SW 208°. Hingegen wurde das älteste entstandene Timescape Nr. 1077 vom Gendarmenmarkt, das nur zwei Phasen beinhaltet, am Montag, den 11.04.1966 um 11:40 Uhr sowie am Dienstag, den 11.04.2002 um 11:40 Uhr aufgenommen und trägt folgende Angaben: N 52° 30.711' E 13° 23.611' und NW 323°. Auf diesem künstlerischen Konzept und Ansatz basierend, gleich einer wissenschaftlichen Methodik, sind alle Timescape-Sequenzen entstanden. Die fotografische Versuchsanordnung ist dabei stets identisch: derselbe Standort und dieselbe Position, fast immer dieselbe Optik, immer in Schwarzweiß und parallel in Farbe, immer derselbe Blick und dieselbe Sichtachse. Lediglich die Zeitintervalle der Bildphasen sind flexibel gehalten und können differieren. Die Standpunkte wurden zu Beginn der Entstehung einer ganzen Sequenz entweder im Stadtraum vor Ort markiert oder sind anhand von dauerhaften Merkmalen wie Häusern, Laternen, Kanaldeckeln, Inschriften oder anderen Details in eigens dafür erstellten Arbeitsbildern und Aufzeichnungen mit Peilung und Entfernung protokolliert.
Ruetz hat ungefähr 180 Beobachtungspunkte in und um Berlin eingerichtet, von denen sich allein rund 140 im Stadtzentrum befinden. Die Anzahl der Aufnahmen an einem Ort und pro Timescape umfasst in der Regel zwischen drei bis vierundzwanzig Einzelbilder. In der Abfolge verdichten sich mindestens sechs Bildphasen wie in einem Zeitraffer zu extrem kurzen Filmen über unendlich lange Zeiträume. Insbesondere Orte, die einst Schauplätze der Macht oder von historischer Relevanz waren, wie der Potsdamer Platz, das Brandenburger Tor, der Schlossplatz, Gendarmenmarkt oder das Regierungsviertel, haben seit 1989/1990 eine rasante Metamorphose erfahren. Gebäude und Blickachsen verschwinden oder entstehen neu, Straßen werden zurückgeführt, angepasst oder anders benannt, Plätze radikal umgestaltet, freie Flächen verbaut und verdichtet sowie Brachen wiederbelebt. Aus dem Marx-Engels-Platz wird der Schlossplatz, aus dem Niemandsland am Potsdamer Platz steigen Hochhäuser empor, auf dem ehemaligen innerstädtischen Mauerstreifen entstehen neue Wohn- und Geschäftsviertel. Jede einzelne Sequenz veranschaulicht auf geradezu magische Weise den Wandel von Raum und Zeit. Im Beispiel von Timescape Nr. 352 wird der Blick zunächst über einen weiten Parkplatz bis hin zum Außenministerium der DDR freigegeben, das dann verstellt, verhüllt und abgerissen wird, worauf sich eine veränderte Sicht auf die Friedrichswerdersche Kirche eröffnet, deren Umgebung sich im Laufe der Jahre erneut zu wandeln beginnt. Hier verschwindet das Symbol eines vergangenen politischen Systems aus dem Stadtbild und also auch aus dem allgemeinen Bewusstsein. In Timescape Nr. 102, 104 und 119 hingegen entsteht wie aus dem Nichts jenseits des Spreekanals das großflächig angelegte Regierungsviertel, aus mehreren Perspektiven betrachtet. Das neue politische System wird etabliert. Andere Bereiche an den Rändern der Stadt hingegen beginnt die Natur sich zurück zu erobern, wie in Timescape Nr. 423 mit Albrechts Teerofen im Ortsteil Wannsee, wo eine ehemalige Betonautobahn erst von einem Bäumchen besetzt wurde, um schließlich Büschen und Wiesen zu weichen.
Ruetz’ Berlinaufnahmen erzählen davon, wie Architektur unsere Lebensräume aus- und umgestalten kann und damit eine Deutungshoheit über unsere Wahrnehmung erlangt. Hier offenbart sich die sichtbare Wirkung der Zeit auf das Stadtbild, welches den historischen Umbrüchen sowie dem Wechsel der gesellschaftlichen Systeme folgt. Vor dem politischen Hintergrund der architektonischen Landschaften, unter anderem durch die Wiedervereinigung Deutschlands in neues Leben getaucht, lässt sich durchaus auch ein historisches Ausmaß für die gesamte Landschaft Deutschlands ablesen, was Ruetz als ‚Historiographie der Gegenwart‘ bezeichnet hat. Obwohl sein Bildinventar das Wirken der Zeit sichtbar macht, ist das Zeitphänomen jedoch selbst nicht direkt im Bild zu sehen. Vielmehr blicken wir hier auf visuelle Landschaften der verstrichenen Zeit. Ruetz thematisiert nicht den Stillstand, sondern den Wandel, und vergegenwärtigt den Prozess unaufhaltsamer Veränderungen am immer gleichen Motiv, der sich mal langsamer, mal heftiger vollzieht, wie Klaus Honnef treffend ausführte.
Den städtischen Prozessen werden die einer vom Menschen geprägten Landschaft gegenübergestellt. In Timescape Nr. 817, im Süden entstanden, hat Ruetz zwischen 1989 und 2012 immer wieder denselben Landschaftsausschnitt aufgenommen. Hier ändert sich nicht das Detail im Bild, sondern das Wetter und die Jahreszeiten geben jedem einzelnen Motiv der 2.720 Aufnahmen umfassenden Serie ein ganz individuelles Aussehen und eine ganz eigene Stimmung. Dieses Teilprojekt der Timescapes hat Ruetz Die absolute Landschaft genannt, die sich noch einmal sehr eindrücklich mit dem Licht und der Zeit und dem Einwirken der Naturkräfte auf einen Landstrich auseinandersetzt.
Im Zerlegen eines Stadt-, auch Kultur- oder Landschaftsraums in verschiedene zeitliche Ebenen entstehen kaleidoskopartige Bilduniversen, die neue Perspektiven eröffnen. Momente und Details werden immer wieder anders mit einem sich ständig neu ordnenden Bildraumgefüge in der ihr jeweils eigenen Grundessenz erfasst. Gleichzeitig bilden einzelne Details oder bestimmte Blickachsen im Abtasten eines Bereichs oder einer Umgebung sogenannte Zeitkonstanten, die sich unverändert durch alle Aufnahmen eines Timescapes ziehen. In dem andauernden Wandel von bekannten und weniger bekannten Orten und Plätzen, im Eintauchen in neue Stimmungen und Bestimmungen, im Wechsel von Licht und Farben erfährt die Zeit eine ganz eigene Entfaltung. Die Aufnahmen von Ruetz erschaffen aus dem Stadtraum, nun in einen Bildrahmen übersetzt, eine ganz eigene bildsinnliche Erfahrung. Der Betrachter wird auf eine ästhetische und emotionale Reise mitgenommen, die auf poetische Weise die Wirkung der Zeit erlebbar macht.
Die Timescapes, Mitte der 1960er-Jahren begonnen, finden im Jahr 2023 ihren endgültigen Abschluss. Die ursprünglich geplanten 600 Standpunkte haben sich aus projektbedingten Gründen auf etwa 360 Orte verdichtet. Insgesamt sind abertausende Aufnahmen entstanden. Vor uns liegt das Ergebnis eines in dieser Form einzigartigen fotografischen Großprojektes – ein visuelles Archiv der Zeitzeugenschaft deutscher Historie und landschaftlicher Metamorphose. Die Fotografie fungiert als Instrument der Geschichts- und Wissens- oder auch Zustands(be)schreibung und ist zugleich Kunst, wobei Handhabung, technische Präzision und ästhetische Wirkung ineinander verschmelzen.
Der Künstler Ruetz verhandelt Fotografie neu, indem er sie zum künstlerischen Mittel für seine Werkreihe über die Auseinandersetzung mit Licht und Zeit bestimmt. Das Licht ist das Medium der Zeit: Es macht sie sichtbar, fühlbar und erkennbar, formulierte Ruetz dazu. Das Prinzip seiner Timescapes, in denen sich Stadt- und Zeitgeschichte visuell anreichert, liegt in der seriellen Abfolge zeitlicher Zustände begründet, wie auch in der konzeptuellen Arbeitsweise, die einer wissenschaftlichen Versuchsanordnung gleicht. In den einzelnen Sequenzen verdichten sich Jahrzehnte zu Minuten und es entstehen unendlich kurze Filme über unendlich lange Zeit. Parallel zu seiner fotografischen Arbeit analysierte und reflektierte Ruetz die künstlerische und philosophische Dimension wie auch das Prinzip seiner Arbeit in zahlreichen Texten und Notaten. Kaum ein anderer Bildkünstler [...] hat sich ausschließlicher und kompromissloser mit dem Problem der Zeit beschäftigt als Michael Ruetz, konstatierte Klaus Honnef dazu. Und wie folgerte der Künstler selbst: Was ist Zeit? Ein Nichts, ein Alles.“