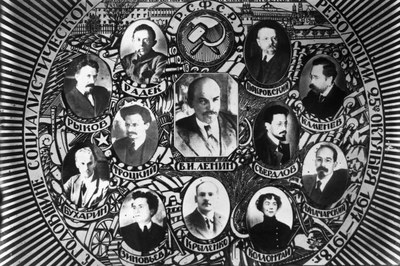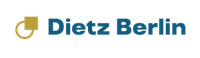Alexandra Kollontai – in den Widersprüchen des Lebens
»Schon in ganz jungen Jahren war es mir bewusst, dass ich mein Leben unter keinen Umständen nach dem gegebenen Muster gestalten dürfe, und dass ich, um die wahre Blickrichtung meines Lebens erkennen zu können, über mich selbst hinauswachsen müsse.« In der Tat verlief Alexandra Kollontais Leben nicht nach einem vorgegebenen Muster. Schon mit Anfang 20 begann sie, eigene Wege zu gehen – fernab der standesüblichen Gepflogenheiten. Auch später forderte Kollontai ihre Genossinnen und Genossen mit neuen Lebensentwürfen und fortschrittlichen Ideen zu Mutterschaft, Ehe und Liebe heraus. Gleichzeitig waren die äußeren Umstände ihres Lebens nie beständig. Kollontai erlebte in Russland zwei Revolutionen und zwei Weltkriege mit. Gegen den Ersten Weltkrieg kämpfte sie aus dem Exil heraus und während des Zweiten Weltkriegs war sie Diplomatin in Schweden. Sie war Teil der ersten siegreichen sozialistischen Revolution in Russland und spielte in ihr eine bedeutsame Rolle. Sie war die erste Frau, die nach dem Sieg der Bolschewiki im Oktober 1917 ein Ministeramt übernahm. Es war eine Zeit, in der »neue Wege der Liebe« und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens erprobt wurden, von denen Kollontai nicht unberührt blieb.
Zweifelsohne gehört Alexandra Kollontai mit Rosa Luxemburg und Clara Zetkin zu den bedeutendsten Revolutionärinnen des 20. Jahrhunderts. Dennoch ist sie hierzulande längst nicht so bekannt wie ihre politischen Freundinnen. Zwischenzeitlich geriet sie in Vergessenheit und wurde immer dann wiederentdeckt, wenn die Frage nach dem »guten Leben« auftauchte. So in der Bundesrepublik Deutschland in den 1970er-Jahren im Zusammenhang mit dem Erstarken der Frauenbewegung. In der damaligen DDR waren es vor allem Kollontais schriftstellerische und autobiografische Texte, die veröffentlicht wurden.
In der Tat hat Kollontai viele Dokumente und Aufzeichnungen über ihr bewegtes Leben hinterlassen, um den nachfolgenden Generationen einen Einblick in ihre Arbeit, ihre Gedankenwelt und in die politischen Zusammenhänge jener Zeit zu geben. Ihre Aufzeichnungen hat sie oftmals nachträglich niedergeschrieben, manche Einträge später noch bearbeitet, einige der von ihr geschilderten Begegnungen sind frei erfunden. Dennoch sind sie – insbesondere »Mein Leben in der Diplomatie« – wichtige Zeitzeugnisse. Kollontai verfasste auch wissenschaftliche und politische Texte, beispielsweise zur Frauenfrage, zur Lage der Arbeiterinnen und Arbeiter, über die Entstehung und Entwicklung des Kapitalismus in Finnland und die Geschichte des zaristischen Russlands. Sie agitierte gegen den Krieg und reiste durch Europa und Amerika, um das Proletariat gegen den Ersten Weltkrieg zu mobilisieren. Alexandra Kollontai schrieb ebenso literarische – ja, feministische – Erzählungen über die »neue Frau« und über die Liebe in Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche. Angesichts der Tatsache, dass sie sich selbst als eine nur mittelmäßige Schriftstellerin bezeichnete, ist die Liste ihrer Schriften lang.
Kollontai ist nach wie vor aktuell, was ihren Mut und ihre Weitsicht in Bezug auf die Fragen der Liebe und des menschlichen Zusammenlebens betrifft. Bis heute haben sich ihre Ideen nicht ansatzweise durchgesetzt, sind deshalb noch immer Zukunft. Faszinierend, wie Kollontai in ihren autobiografischen Schriften und schriftstellerischen Texten aufzeigt, dass jede revolutionäre Veränderung auch eine Veränderung des eigenen Selbst und der zwischenmenschlichen Beziehungen mit sich bringt. Kollontai war radikal, forderte, neue Wege zu gehen und gewohnte Pfade zu verlassen – und verortete die schöpferische Kraft des Wandels historisch bei den Frauen und der Arbeiterklasse. Gleichzeitig verschwieg sie nicht, wie schmerzhaft jeder Veränderungsprozess sein kann, weil er immer auch Abschied von Gewohntem bedeutet.
Das Ansinnen dieses Buches ist es, Kollontais Leben und ihre Positionen darzustellen, sie nicht allein vom heutigen Standpunkt aus zu bewerten, sondern einzubetten in den historischen Kontext. Damit soll nichts beschönigt werden. So sind etwa ihre Auffassung, Menschen mit Erbkrankheiten sollten sich nicht fortpflanzen, oder ihre Rede von »geschlechtlicher Zuchtwahl im Interesse der Rasse«, indiskutabel, auch ungeachtet dessen, dass dieser eugenische Rassismus ein trauriges Zeugnis ihrer Zeit ist. Auch die Brüche in ihrer Biografie sind zu thematisieren. Denn es gibt sie, genauso wie es viele offene Fragen gibt. Ihre Haltung zum »Großen Terror« der Stalin-Zeit beispielsweise, durch den Hunderttausende den Tod fanden oder im Gulag verschwanden, ist undurchsichtig. Alexandra Kollontai hätte die Ermordung so vieler Menschen eigentlich als prinzipielle Gegnerin der Todesstrafe scharf kritisieren müssen, doch blendete sie diese Jahre aus ihrer kontinuierlichen Berichterstattung aus. Kollontai hat diese Zeit überlebt, spurlos an ihr vorbeigegangen ist sie nicht. Ihre Aufzeichnungen und privaten Briefe belegen, dass sie unter den Verfolgungen und Repressalien litt. Sie sorgte sich um das Schicksal naher Freundinnen und Freunde, vor allem um das ihrer Familie.
Im Februar 1938 schrieb Alexandra Kollontai an ihre langjährige Freundin Soja Schadurskaja: »Der Eindruck, den man von einem Menschen hat, wird immer unvollkommen sein und ihn nicht wirklich widerspiegeln. Das ist besonders dann der Fall, wenn Jahre ins Land gegangen sind, wenn sich Legenden um ihn gebildet haben und Geschichten über ihn erzählt werden. Alle Seiten seines Charakters werden – in Abhängigkeit von den Umständen – entweder überhöht oder untertrieben. Ich habe viel darüber nachgedacht. Ich hatte immer den Wunsch, als die zu gelten, die ich tatsächlich bin, und geschätzt zu werden für das, was ich wirklich geleistet habe. Das ist natürlich schwer, weil jeder Mensch den anderen aus seinem subjektiven Empfinden begreift.«
In diesem Sinne geht es nicht darum, Alexandra Kollontai als jene darzustellen, die sie »tatsächlich« war, als sie vielmehr für das zu schätzen, was sie hinterlassen hat. Wie zu zeigen sein wird, war sie eine unglaublich starke und leidenschaftliche Frau mit einem hohen Anspruch an sich selbst, deren persönliche Lebensphilosophie und politischen Aktivitäten untrennbar mit ihren schriftlichen Werken verbunden waren.
[...]