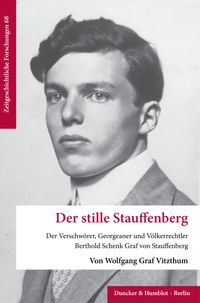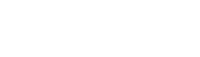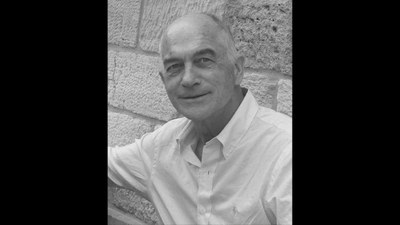I. Prolog
„Stauffenberg“. Vor zwei Jahrzehnten fiel der Name mehrfach im Friedenspalast in Den Haag. Die Namensnennung bezog sich auf den Völkerrechtler Berthold Schenk Graf von Stauffenberg (1905–1944), nicht auf den Althistoriker Alexander Stauffenberg (1905–1964), seinen Zwillingsbruder [1]. Ebenso wenig ging es im Haag um ihren jüngeren Bruder, den Oberst i. G. Claus Stauffenberg (1907–1944)[2]. In ihrer Jugend, im Jahr 1923, gerieten die drei Brüder in den Bannkreis des Dichters Stefan George (1868–1933) – ein früher lebensbestimmender Einfluss. Im Widerstand gegen die NS-Diktatur kämpften Claus und Berthold Stauffenberg seit Herbst 1942 Rücken an Rücken. Ihren Mut bezahlten sie mit dem Leben. Alexander Stauffenberg, in die Attentats- und Staatsstreichpläne der Brüder nicht eingeweiht, überlebte Krieg und Haft.
Rechtsfälle aus dem 1991 einsetzenden blutigen Zerfall Jugoslawiens, des nach dem Ersten Weltkrieg gegründeten multiethnischen und -religiösen Balkanstaates, bildeten den Kontext, in dem sich Parteien vor dem Internationalen Gerichtshof mehrfach auf Berthold Stauffenberg beriefen – auf seinen Kommentar zu Statut und Verfahrensordnung des Ständigen Internationalen Gerichtshofs[3].
Die Rechtsordnung des heutigen, ebenfalls im Haager Friedenspalast angesiedelten Internationalen Gerichtshofs, des Hauptrechtsprechungsorgans der Vereinten Nationen, orientiert sich weitestgehend an den normativen Grundlagen jenes Funktionsvorgängers aus der Zwischenkriegszeit. Insofern werden Berthold Stauffenbergs 1934 publizierten „Interpreta tionselemente“ weiterhin konsultiert. Sie dürfen im Handapparat keines internationalen Richters fehlen.
Wem gelingt mit 29 Jahren ein solcher Wurf, wem gelingt er überhaupt? Werk und Autor genießen unter Völkerrechtlern weiterhin hohes Ansehen. Der internationale Großkommentar zur Charta der Vereinten Nationen zitiert Stauffenbergs Magnum opusfünfmal[4]. Die ähnlich bedeutende, doppelt so umfangreiche Erläuterung des Statuts des Internationalen Gerichtshofes bezieht sich 62-mal affirmativ auf Stauffenberg[5]. Nobel stellt sich dieser aktuelle Kommentar in die Tradition jenes früheren Werkes, „written in 1934by just one person, Berthold Schenk Graf von Stauffenberg – who was trying to uphold international law at a time when the authorities of his country began to undermine it“[6].
Nicht als objektiver, exeptioneller Völkerrechtler, wohl aber als Stefan Georges Freund und Nacherbe sowie als stiller und opferbereiter Verschwörer gegen Hitler ist Berthold Stauffenberg eine Gestalt im Schatten. Weder die umfangreiche Literatur über des Dichters Werk, Weltsicht und Wirkung noch die unzähligen Arbeiten über Claus Stauffenberg, den mitreißenden Zwanzigsten-Juli-Attentäter, beleuchten den ältesten Stauffenberg-Bruder hinreichend. Anders als sein Bruder Claus hat der Völkerrechtler, George-Adlatus und Widerstandskämpfer Berthold Stauffenberg noch keinen Platz im kollektiven Gedächtnis der Deutschen gefunden.
Claus Stauffenberg war Berthold, seinem ältesten Bruder, eng verbunden – und umgekehrt. Dem im Frühjahr 1943 im Fronteinsatz in Tunesien lebensgefährlich verwundeten Jüngeren half der Ältere in dreifacher Hinsicht: Er nahm den Kriegsversehrten im Spätsommer 1943 in seine Wohnung (Tristanstraße 8, Berlin-Wannsee) auf, die damit zu einem wichtigen Zufluchts- und Beratungsort der zivil-militärischen Konspiration, der die beiden Stauffenbergs seit einem Jahr angehörten, wurde; zweitens überarbeitete Berthold Stauffenberg, den jüngeren Bruder entlastend und bestärkend, juristisch professionell mehrfach die umfangreichen geheimen Umsturztexte; vor allem blieb er, drittens, dem späteren Attentäter und ihrem gemeinsamen Denken und Planen selbstlos nahe und treu: als der vertrauteste Mitverschworene, der den seit Sommer 1943 zur zentralen tatbereiten Persönlichkeit des Widerstandes werdenden Bruder vor etwaigen Zweifeln und denkbarem Überengagement schirmte.
Die rückhaltbietende Wirkung dieser brüderlichen Verbindung ist aus Zwanziger Juli-Perspektive kaum zu überschätzen. Berthold Stauffenberg war auch in der Verschwörung nicht Claus’ Anhängsel, sondern sein wichtigster Verbündeter, sein Vertrauter, sein Alter Ego. Es war eine Brüderschaft auf Augenhöhe. Auch daran erinnert nachfolgende Studie. Sie rückt den Völkerrechtler und George-Anhänger, der als Widerständler zusammen mit Claus, seinem jüngsten Bruder, das Höchste für Vaterland, Recht und Freiheit wagte, ins Licht – soweit es die schmale Quellenbasis erlaubt.
Hinsichtlich der einschlägigen Literatur ist zunächst das Pionierwerk zu nennen, das AlexanderMeyer vor einem Vierteljahrhundert BertholdStauffenberggewidmet hat[7]. Der Doktorand der Tübinger Juristenfakultät zeichnete ein auf die Rechtsfragen konzentriertes, detailliertes Lebensbild. Über Alexander, den jüngeren Zwillingsbruder der Stauffenbergs, veröffentlichte Karl Christ im Jahr 2008 ein historiographisch-biographisches Portrait, das auch Licht auf Berthold und Claus Stauffenberg8 wirft. Alexander Stauffenberg, ein früher Kritiker des NS-Regimes, an der Konspiration aber nicht beteiligt, wurde wie die meisten Mitglieder der Familie nach dem Zwanzigsten Juli als „Sippenhäftling“ durch die berüchtigten Gefängnisse und Konzentrationslager des „Dritten Reiches“ geschleift. Wie seine Verwandten, darunter die Kinder seiner ermordeten Brüder, überlebte er Gefangenschaft und Kriegsende. 1948 in München zum Ordinarius für Alte Geschichte ernannt, bewährte er sich auch als kritischer Vertreter seines Faches und wachsamer konzessionsloser Zeitgenosse der jungen Bundesrepublik Deutschland.
Claus Stauffenberg war noch in der Nacht des Attentats standgerichtlich erschossen worden, zusammen mit seinen vier nächsten Mitstreitern. Berthold Stauffenberg, früher und zunächst intensiver als Claus in Kontakt mit der zivil-militärischen Opposition, wurde am 10. August 1944 vom Volksgerichtshof des Hoch- und Landesverrats für schuldig befunden, verurteilt und noch am selben Tag in Berlin-Plötzensee hingerichtet – erdrosselt am Fleischerhaken.
Von Berthold Stauffenberg, von dieser bisher wenig beachteten zeithistorischen Gestalt bleibt ein Gesamtbild zu zeichnen. Dieser Aufgabe widmet sich unsere Untersuchung. Vor Alexander Meyer hatten zwei juristische Kollegen Berthold Stauffenbergs (Alexander Makarov, Helmut Strebel), zwei seiner ehemaligen Schulkameraden (Theodor Pfizer, Eberhard Zeller) sowie ein Zeit- und ein Kunsthistoriker (Peter Hoffmann, Ludwig Thormaehlen) versucht, Interesse für diesen Stauffenberg zu wecken[9].
Peter Hoffmanns dicht belegte, fakten- und facettenreiche Darstellung „Claus Schenk Graf von Stauffenberg und seine Brüder“ (Stuttgart 1992), ragt aus dieser Literatur besonders eindrucksvoll heraus. Der deutsch-kanadische Historiker Hoffmann hat sein Schlüsselwerk unter dem Titel „Claus Schenk Graf von Stauffenberg – Die Biographie“ (München 2012) aktualisiert und erweitert. Dieses Lebensbild und das ähnlich perspek tivenreiche und feinsinnige Werk von Dr. med. Eberhard Zeller, „Geist der Freiheit. Der Zwanzigste Juli“ (5. Aufl. München 1965), später unter dem Titel „Oberst Claus Graf Stauffenberg“ (Paderborn 1994) souverän fortgeführt, lagen nachfolgender Studie zugrunde. Auch der Verfasser ging gelegentlich auf Berthold Stauffenberg ein, erstmals 1996 in „Zeugen des Widerstands“ (Hg. Joachim Mehlhausen).
Wegen seiner herausragenden Personen- und Rechtskenntnisse, seiner frühen und dauerhaften Kontakten zu Gegnern der Hitler-Diktatur und seiner brüderlichen Verbundenheit mit dem späteren Attentäter10 war Berthold Stauffenberg wichtig für den Versuch, Deutschland von der Tyrannei zu befreien und eine neue staatlich-gesellschaftliche Ordnung aufzurichten. Entschlossen, sich dem Gewaltregime, dessen „Grundideen“ er und sein Bruder Claus anfangs – wie so viele – „zum größten Teil durchaus bejaht“ hatten[11], letztlich mit Gewalt entgegenzustellen, begingen sie Hochverrat. Sie wussten, worauf sie sich einließen. Anders als die große Mehrheit der Deutschen, die dem „Führer“ bis zum Untergang die Treue hielt, engagierten sich Berthold und Claus Stauffenberg seit Herbst 1942 im Zentrum des deutschen zivil-militärischen Widerstands. Das vom Regime missbrauchte Recht auch seinerseits zu brechen, nahm der Völkerrechtler dabei ebenso in Kauf wie den Opfergang vor Freislers Blutgericht.
–––––––––––––––––––––––––––––––––
1 K. Christ, Der andere Stauffenberg, München 2008. Erinnerungswürdig ist auch Alexander Stauffenbergs Forschung über die Germanen im römischen Reich, seine Übersetzung von Odyssee-Gesängen und sein Epos „Der Tod des Meisters“.
2 P. Hoffmann, Claus Schenk Graf von Stauffenberg, München 2007; ders., Widerstand – Staatsstreich – Attentat, München 1969, S. 371 ff., 466 ff. (ein monumentales Werk); ders., Claus Graf Stauffenberg und Stefan George, Jahrbuch der Schillergesellschaft 12 (1968), S. 520 ff.; Th. Karlauf, Stauffenberg, München 2019. Die Prägung durch George betonen besonders K. J. Partsch, Stauffenberg, Europa-Archiv 1950, S. 3196 ff.; E. Zeller, Geist der Freiheit, 5. Aufl. München 1965; ders., Oberst Claus Graf Stauffenberg, Paderborn u. a. 1994, S. 47 ff.
3 Statut et Règlement de la Cour Permanente de Justice International, Berlin 1934, Hg. Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, „bearbeitet von Berthold Schenk Graf von Stauffenberg“ (Vorwort).
4 B. Simma u. a. (Hg.), The Charter of the United Nations, 3. Aufl. Oxford 2012. Zitiert wird auch ein Aufsatz von Berthold Stauffenberg.
5 A. Zimmermann u. a. (Hg.), The Statute of the International Court of Justice, 3. Aufl. Oxford 2019, S. VII.
6 Das StGA birgt fünf unveröffentlichte, undatierte Manuskripte: „Die friedliche Erledigung internationaler Streitfälle“, 8 Bl.; „Die Vereinigten Staaten und der Ständige Internationale Gerichtshof“, 10 Bl.; „Staatsangehörigkeitsfragen vor internationalen Gerichten“, 14 Bl.; dasselbe, 26 Bl.; „Die Inkraftsetzung des revidierten Statuts des Ständigen Internationalen Gerichtshofs“, 8 Bl. Diese Entwürfe sowie die Buchanzeigen (ZaöRV 1934, S. 457 f., 763 f.; 1935, S. 215, 220 f., 436, 954 f., letztere ein veritabler Verriss) sind nüchtern-positivistisch gehalten. – Trotz künstlerischer Neigungen mied der Jurist, anders als sein Bruder Alexander, jeglichen Anflug des Poetischen, vgl. W. Graf Vitzthum, Rechts- und Staatswissenschaften aus dem Geiste Stefan Georges?, in:B. Böschenstein u. a. (Hg.), Wissenschaftler im George-Kreis, Berlin/New York, 2005, S. 83 ff., 108 ff. – Das StGA birgt auch umfangreiche Unterlagen von Mitgliedern des George-Kreises. Eine „Auswahl aus seinen (des George-Kreises) Schriften“ bringt G. P. Landmann (Hg.), Der George-Kreis, Stuttgart 1980.
7 A. Meyer,Berthold Schenk Graf von Stauffenberg, Berlin 2001. Der jüngere Kollege H. Strebel rettete unmittelbar nach dem 20.7.1944 zusammen mit Ellinor von Puttkamer Stauffenbergs Unterlagen im Institut, F. Hofmann, Helmut Strebel (1911–1992), Baden-Baden 2010, S. 2 ff.
8 K. Christ, Der andere Stauffenberg (o. Anm. 1), S. 27 ff., 45 ff.; J. Salzig, Sippenhaft als Repressionsmaßnahme des Regimes, Augsburg 2015, S. 278 ff., 282 ff., 291 ff.
9 A. N. Makarov, Berthold Schenk Graf von Stauffenberg, FW 1947, S. 360 ff.; H. Strebel, In Memoriam: Berthold Schenk Graf von Stauffenberg, ZaöRV 1950/51, S. 14 ff.; Th. Pfizer, Die Brüder Stauffenberg, in:E. Boehringer/W. Hoffmann (Hg.), Freundesgabe für Robert Boehringer, Tübingen 1957, S. 487 ff.; L. Thormaehlen, Die Grafen Stauffenberg, ebd., S. 685 ff.
10 Nach der partiellen Heilung seiner schweren Kriegsverletzungen (er verlor eine Hand, ein Auge und zwei Finger) zog Claus Stauffenberg, nach Berlin kommandiert, zu seinem Bruder. Später kam dort, in Wannsee, auch der ausgebombte Mitverschworene Oberst i. G. Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim (1905–44) unter.
11 „Spiegelbild einer Verschwörung“, Hg. H.-A. Jacobsen, I. Bd., Stuttgart 1984, S. 447 f. (nachfolgend zitiert: Kaltenbrunner-Berichte). „Die Grundideen des Nationalsozialismus sind aber in der Durchführung durch das Regime fast alle in ihr Gegenteil verkehrt worden“, B. Stauffenberg, ebd., S. 448, 325 ff. Zum begrenzten Quellenwert dieser Berichte ebd., S. XI ff. Das NS-Regime war von Anfang an verbrecherisch.