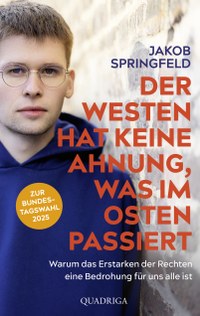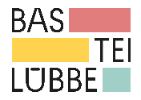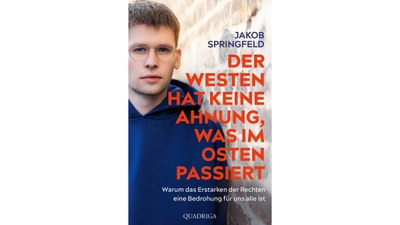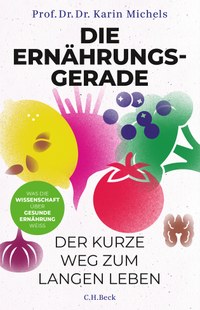Ja, der Osten hat ein Problem
Ich habe gerade geheult. Aber eigentlich bin ich wütend. Ich bin wütend wegen dem, was ich erlebe, was ich jeden beschissenen Tag erzählt bekomme. Wegen der Nachrichtenlage. Ich möchte der motivierte, gelassene, lächelnde und an Veränderung glaubende Typ bleiben, der ich bin. Aber: Bin ich dieser Typ überhaupt noch? Oder bete ich mir ein Mantra vor, an das ich eigentlich selbst kaum noch glaube?
Je mehr ich versuche, meine Gefühle in Worte zu fassen, desto deutlicher merke ich, dass das kaum möglich ist. Ich kann das, was ich erlebe, kaum beschreiben. Es fühlt sich manchmal so an, als würde die Welt über meinem Kopf zusammenbrechen. Und wenn ich ehrlich bin, dann tut sie das vielleicht auch. So kommt es mir zumindest vor. So kommt es mir vor, wenn ich bei meiner Lesung in Greiz davon höre, wie Kommunalpolitiker:innen bedroht werden. Marcel, Aktivist und Stadtrat in Greiz, berichtet mir:
»In der Stadt, nicht weit von meinem Wohnort ist, vor einiger Zeit dieses Graffito aufgetaucht. Der Schriftzug prangte groß auf der Fläche von sechs Garagentoren, und darauf stand: MARCEL BUHLMANN TÖTEN! Daneben ein Hakenkreuz, SS-Runen.« Und Marcel erzählt weiter, dass er mit seiner Freundin einen Koffer packen möchte. Einen Koffer für den Notfall. Denn er sieht die Möglichkeit, dass die AfD in Thüringen nicht nur stärkste Kraft wird, sondern sogar an die Regierung kommen könnte. Schon im Frühsommer 2023 hält Marcel das, was bei den Landtagswahlen im September 2024 dann tatsächlich eintreten sollte, für sehr wahrscheinlich. Die AfD wird mit Abstand stärkste Kraft. Und das, obwohl man den Chef der AfD in Thüringen sogar laut Gerichtsurteil als »Faschisten« bezeichnen darf. Marcel packt mindestens gedanklich seinen Koffer.
Weil er Angst hat und meint, dass er seinen Reisepass wieder herauskramen muss, damit er im Notfall schnell abhauen kann. Weil im Ernstfall alles sehr schnell gehen kann, sehr gefährlich werden würde.
Auch in mir tickt die Uhr der Angst. Nur war Marcel der Erste, der in meinem näheren Umfeld so klar darüber spricht. Ich denke mir, dass ich noch nicht so weit bin. Ich möchte mich dem Gedanken an Flucht nicht aussetzen. Doch sogar mein Papa meinte letztens, dass er sich Sorgen macht: »Ich hoffe, dass Aktivisten wie du nicht irgendwann unter neuen Gesetzen zu leiden haben ...« Und ich verstehe diese Angst, denn ich habe sie selbst. Zumal diese Ängste auch von Jugendlichen im Alter von fünfzehn, sechzehn Jahren bei meinen Lesungen immer und immer wieder bestätigt werden.
Heute Lesung in Zwickau. Sogar zwei Lesungen. Lesungen an einer Schule. Mehrere Kids erzählen mir, dass es wieder okay sei, Neonazi zu sein: »Die meisten machen da nur mit, weil’s cool ist. Die wissen gar nicht, was dahintersteht.« Ein Junge mit Migrationsgeschichte sagt: »Das Leben muss ja weitergehen, aber ich habe echt Schiss. Allein laufe ich hier nicht durch Zwickaus Innenstadt. Wir sind ja schon richtig lange hier, aber wegen meines Aussehens bekomme ich seit 2014/15 immer wieder Stress.«
Viele berichten mir, dass sie Neonazis persönlich kennen oder in ihrem Freundeskreis haben. Es ist normal geworden, rechts zu sein. Es ist normal geworden, AfD zu wählen. Es ist normal geworden, Neonazi zu sein.
Zeitsprung, knapp zwanzig Jahre zurück. Die Fußballweltmeisterschaft in Deutschland stand vor der Tür. »Die Welt zu Gast bei Freunden«, lautete das Motto damals. Natürlich kann ich mich nicht daran erinnern, im Sommer 2006 war ich gerade einmal vier Jahre alt. Doch für viele ist das »Sommermärchen« nach wie vor sehr präsent. Für zahlreiche Ostdeutsche auch noch aus einem Grund, der nichts mit Fußball zu tun hat. Uwe-Karsten Heye, ehemaliger Regierungssprecher von Bundeskanzler Gerhard Schröder und zu diesem Zeitpunkt Chefredakteur der SPD-Parteizeitung Vorwärts, äußerte sich drei Wochen vor Beginn der WM besorgt: »Ich sehe No-go-Areas vornehmlich im Osten Deutschlands. Das hat aber mit der Geschichte der alten DDR zu tun.« Und weiter: »Es gibt kleine und mittlere Städte in Brandenburg und anderswo, wo ich keinem, der eine andere Hautfarbe hat, raten würde, hinzugehen. Er würde sie möglicherweise lebend nicht mehr verlassen.«[1] Die Reaktionen fielen heftig aus. Politiker:innen empörten sich, solche Aussagen seien rufschädigend und stigmatisierend. Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck (ebenfalls SPD) warf Heye die »Verunglimpfung ganzer Regionen in Brandenburg«[2] vor. Jörg Schönbohm, Innenminister des Landes, sprach von einer »unglaublichen Entgleisung«.3 Heye selbst hatte der Politik »Bagatellisierungen« vorgeworfen – unvergessen der legendär idiotische Satz des langjährigen sächsischen CDU-Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf: »Die Sachsen sind immun gegen Rechtsextremismus.«[4] Hohe Wellen schlug dann auch noch Heyes Begründung: »Die DDR hat sich, ohne dass sie sich in der Sache auch nur irgendwie mit dem Nationalsozialismus und der braunen Zeit auseinandergesetzt hätte, von vornherein als antifaschistischen Staat begriffen. [...] Jeder, der sich zu diesem Staat bekannt hat, war auch schon Antifaschist.«[5]
Viele störten sich an der typisch lehrerhaften Lektion von westdeutscher Warte aus. Allzu oft mussten und müssen Ostdeutsche sich ihr Leben und die DDR vom Westen erklären lassen. Dabei ist Heye alles andere als ein polemischer Scharfmacher, sondern bis heute ein Kämpfer gegen die extreme Rechte. Im Jahr 2000 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern des Vereins »Gesicht zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland«, in dem er dann lange Zeit als Vorstandsvorsitzender tätig war.
Zurück in die Gegenwart. Noch mal Fußball. »Mein« Verein, der FSV Zwickau, muss sich nach dem schmerzvollen Abstieg aus der 3. Liga 2023 in der Regionalliga Ost abmühen. Erneut liegt ein großes Fußballturnier in Deutschland hinter uns, die Europameisterschaft. Zwei Teams hatten sogar ihr Quartier während der EM in Ostdeutschland aufgeschlagen: die englischen Promifußballer im thüringischen Blankenhain und die kroatische Nationalmannschaft in Neuruppin, Brandenburg. An No-go-Areas hat man sich gewöhnt, auch wenn kaum darüber gesprochen wird, und die Stimmungslage, die Themen, die die Gesellschaft bewegen, erinnern erschreckend an damals.
So gehörten zu den meistverkauften Büchern des Jahres 2023 Dirk Oschmanns umstrittene Abrechnung Der Osten: eine westdeutsche Erfindung. Wie die Konstruktion des Ostens unsere Gesellschaft spaltet sowie Anne Rabes vielfach preisgekrönter Roman Die Möglichkeit von Glück, in dem die kurz vor dem Mauerfall geborene Protagonistin Stine schonungslos innerfamiliäre Gewalt, Sprachlosigkeit und Traumata schildert und bearbeitet, die für sie auch in den autoritären und brutalen Strukturen der SED-Diktatur begründet liegen. Oschmann will in seinem Buch, das in zensierter (!) Form auch auf Russisch erschien[6], nachweisen, dass »der Osten« quasi ein westdeutsch dominiertes Konstrukt sei, das zu einer Stereotypisierung und verstetigten Benachteiligung der Ostdeutschen führte und nach wie vor führt. Anne Rabe hingegen zeigt mit dem Finger nicht nach Westen, sondern unternimmt in ihrem Roman eine genaue und schonungslose Untersuchung der Geschichte von Gewalt als ein identitätsstiftendes Merkmal Ostdeutschlands. Verkürzt gesagt, schreibt Oschmann den Ostdeutschen eine kollektive Opferrolle zu, während Rabe das Individuum ins Zentrum rückt, das befähigt ist, selbstbestimmt zu handeln. Diese Fähigkeit kann im Guten wie im Schlechten zum Einsatz kommen. Zwei äußerst unterschiedliche, teils gegensätzliche Herangehensweisen, auf ostdeutsche Geschichte vor und nach dem Mauerfall zu blicken.
Was viele Anfang der 1990er-Jahre für undenkbar hielten, ist heute ein Faktum: Knapp 35 Jahre nach der Wiedervereinigung gibt es nach wie vor Verständigungsschwierigkeiten zwischen Ost und West. Der in Dresden geborene Schriftsteller Ingo Schulze klagt: »Im innerdeutschen Verhältnis ist die westdeutsche Sozialisation aber der Goldstandard – also das, was eigentlich als Bezugspunkt gilt.«[7] Sabine Rennefanz kritisiert in ihrer Spiegel-Kolumne Frank-Walter Steinmeiers Buch
Wir. Der Bundespräsident, schreibt sie, »unterschlägt, dass es bis heute keine gemeinsame Erzählung für die Wiedervereinigung gibt. Als richtige, als eigentliche deutsche Geschichte gilt die Geschichte der Bundesrepublik, die Geschichte der DDR ist ein Exkurs, Regionalgeschichte, etwas für Experten.« Wie toll sei es doch, so Steinmeier, dass die Grundrechte nun in ganz Deutschland garantiert sind. Sicher, toll ist das wirklich, aber für Rennefanz klingt das so: »Was wollt ihr eigentlich noch, ihr Undankbaren!« [8]
Zunächst erfreut entdeckte ich im Programm des Berli- ner Theatertreffens 2024 eine Diskussionsveranstaltung mit dem Titel: »Was tun? Vom Umgang mit neurechten Kulturkämpfen«.9 Einigermaßen fassungslos war ich allerdings, als ich unter den Teilnehmenden keine:n einzige:n ostdeutsche:n Kulturschaffende:n entdecken konnte. Leute, wenn jemand eine Expertise zu neurechten Kulturkämpfen hat, dann doch wohl wir! Ich will der Veranstaltung keinesfalls die Sinnhaftigkeit absprechen: Ich finde es gut, dass auf einem Theaterfestival darüber gesprochen wird. Aber hier diskutierten unter anderem die Intendantin des Hamburger Kulturorts Kampnagel, die polnische Kuratorin Joanna Warsza und der erfolgreiche Regisseur Oliver Frljić, der zum Leitungsteam des Maxim Gorki Theaters in Berlin gehört. Warsza und Frljić berichteten aus ihren Heimatländern Polen und Kroatien über die schwierige Situation für Theatermacher:innen oder Kulturschaffende, die sich häufig Zensurversuchen und ernsthaften Bedrohungen ausgesetzt sehen.
Aber warum in die Ferne schweifen? Haben die Organisator:innen einer solchen Veranstaltung denn keine Ahnung, wollen die nicht erfahren, was im Osten dieses Landes passiert, wie dieses Thema ostdeutsche Kultureinrichtungen tagtäglich beschäftigt? Hier tobt nämlich schon längst der Kulturkampf. Es wäre äußerst interessant gewesen – auch und gerade für die Berliner Kulturbubble –, Intendant:innen oder Schauspieler:innen aus Zwickau, Bautzen oder Bitterfeld-Wolfen zuzuhören, welche Erfahrungen sie machen.
»Neurechte Kulturkämpfe« sind mittlerweile natürlich auch ein westdeutsches Problem – weshalb es gut ist, dass darüber auch diskutiert wird. Was ich nur so ätzend finde, ist, dass durch die Teilnehmenden der Eindruck entsteht, dass irgendwo im schicken Berlin 2024 das Problem gelöst werden soll, mit dem wir Ossis schon ewig konfrontiert sind, während unseren Warnungen oft nicht wirklich Beachtung geschenkt wurde. Es ist richtig, dass das nicht »nur« als ostdeutsches Problem gesehen wird, aber es ist peinlich, dass wir nicht mit einbezogen werden und dass der Eindruck entsteht, dass es erst diskussionswürdig ist, wenn der rechte Kulturkampf auch in Westdeutschland richtig spürbar wird.