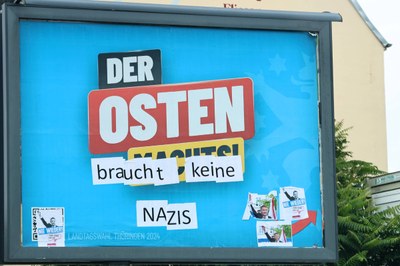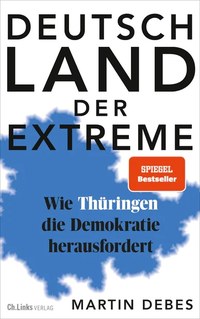Zu diesem Buch
Im September 2024, ein Jahr vor der Bundestagswahl, werden in Ostdeutschland drei Landtage gewählt. Die Ost-Wahlen, so heißt es immer wieder, könnten zum bislang größten Härtetest der bundesrepublikanischen Demokratie werden. Ich stimme dieser Vorhersage grundsätzlich zu. Nie seit 1945 war die offene Gesellschaft von ihren Feinden so bedroht wie heute.
Dennoch erhebe ich Einwand: Ostdeutschland ist kein homogenes Gebiet. Es ist auch kein bloßes Beitrittsgebiet und schon gar keine »frühere DDR«. Bei den so bezeichneten Ost-Wahlen handelt es sich um freie, gleiche und geheime Abstimmungen über die Parlamente von drei geschichtsträchtigen Ländern, von Sachsen, von Brandenburg – und von Thüringen. Diese sind auch keine neuen Länder, sondern im Gegensatz zu einigen angeblich alten Ländern sehr alt. Ohne ihr Erbe ist das Deutschland, in dem wir heute gemeinsam leben, nicht vorstellbar.
Politisch gibt es große Unterschiede zwischen den ostdeutschen Bundesländern. Allein schon bei diesen drei von ihnen: Das frühere preußische Kernland Brandenburg wird durch seine Lage zwischen Berlin und Polen bestimmt und seit 1990 durchgängig von der SPD regiert. Das einstige Königreich Sachsen, das in der Neuzeit nur CDU-Ministerpräsidenten kannte, ist nicht nur deutlich größer als die anderen beiden Länder, sondern hat auch mit Dresden und Leipzig zwei Metropolregionen vorzuweisen.
Und Thüringen? Hier, wo gerade einmal drei Prozent der deutschen Bevölkerung leben, lassen sich inzwischen nahezu alle wichtigen Konfliktlinien der Bundesrepublik nachvollziehen. Die örtlichen Protagonisten Bodo Ramelow, Björn Höcke oder Thomas Kemmerich kennen weit mehr Menschen als die Namen der Regierungschefs größerer und reicherer Länder wie Hessen oder Niedersachsen.
Warum ist das so? Und was lässt sich daraus ableiten? Diesen Fragen gehe ich in diesem Buch nach, nicht als Historiker oder Politikwissenschaftler, sondern als Journalist und als gebürtiger Thüringer, dessen Vorfahren schon in diesem Land lebten, als Bauern, Pfarrer und Ärzte. Es ist der Versuch, Erklärungen dafür zu finden, wie Thüringen zu einem Testfall für die bundesrepublikanische Demokratie werden konnte.
Ich danke allen, die mir auf diesem Weg halfen, vor allem aber meiner Familie. Ich danke Maike Nedo für ihr Lektorat, Jürgen John für seinen Rat sowie Frauke Adrians, Henry Bernhard, Carmen Fiedler, Urte Lemke, René Lindenberg, Torsten Oppelland und Elmar Otto für die Durchsicht des Textes.
Martin Debes, Erfurt, 29. Januar 2024
Prolog
Erfurt, 29. April 2023. »Höcke! Höcke! Höcke!« Die Menge skandiert den Namen des Thüringer AfD-Vorsitzenden. Trommeln geben den Takt vor. Etwa 1000 Männer und auch einige Frauen stehen versammelt im Karree, das gesäumt ist von Absperrgittern und einer Hundertschaft hochgerüsteter Polizisten.
Das hintere Drittel des Platzes vor dem Theater ist nahezu leer. Es sind längst nicht so viele Teilnehmer gekommen, wie die Thüringer AfD erhofft und angemeldet hatte. Doch immerhin, vor der Bühne ballen sich die Menschen. Sie sind mit ihren Flaggen, auf denen die Friedenstaube oder die Aufschrift »Widerstand« zu sehen ist, von der Staatskanzlei hierhergezogen und wollen jetzt den Mann sehen, nach dem sie so laut rufen.
Plötzlich steht er auf der Bühne. Björn Höcke reißt beide Arme schräg nach oben, sodass sie ein V bilden. Er trägt seine kundgebungsbewährte Kombination: dunkelblaues Jackett, Jeans, weißes Hemd. Sein Körper ist von vielen Joggingläufen trainiert. Der ergraute Seitenscheitel sitzt.
Höcke ist inzwischen jenseits der 50. Zehn Jahre hat er in der AfD verbracht. Obwohl er auf Bundesebene nie eine Funktion besaß, führt er die Partei inzwischen von hinten. Er sorgte mit dafür, die einstigen Vorsitzenden Bernd Lucke, Frauke Petry und Jörg Meuthen politisch zu erledigen. Und er dominierte auf den jüngeren Bundesparteitagen die Abstimmungen über Personal und Anträge.
Das weiß auch Alice Weidel. Die Vorsitzende der Bundespartei ist an diesem trüben Frühlingstag nach Erfurt gereist, um Höcke ihre Referenz zu erweisen. Einst stimmte sie für seinen Parteiausschluss. Doch ab 2018 begann sie, sich mit ihm zu arrangieren. Sie hatte begriffen, dass auch sie eine Konfrontation mit dem Rechtsextremisten politisch nicht überleben würde.
Das Zweckbündnis vermittelte Götz Kubitschek. Der Gründer des sogenannten Instituts für Staatspolitik, das vom Verfassungsschutz beobachtet wird, ist auch in Erfurt auf dem Theaterplatz, und sieht, wie Weidel auf der Bühne Höcke in den Arm nimmt. Die Frau, die für die Investmentbank Goldman-Sachs arbeitete, die in einer lesbischen Lebensgemeinschaft mit einer in Sri Lanka geborenen Partnerin lebt und in der Partei als »Globalistin« beschimpft wird – und die Frau, die, wenn es ihr opportun erscheint, gegen »Kopftuchmädchen«, »alimentierte Messermänner« oder »sonstige Taugenichtse« polemisiert.1
Die Machtbalance zwischen Weidel und Höcke ist ungewöhnlich: Die Vorsitzende der Bundespartei braucht den Landesvorsitzenden mehr als er sie benötigt. Denn im Gegensatz zu ihr besitzt Höcke eine stabile Operationsbasis: Thüringen. Hier führt er seit 2013 die AfD und leitet seit 2014 die Fraktion im Landtag. Hier gründete er sein Netzwerk »Flügel«, mit dem er die Partei immer weiter nach rechts drängte. Und hier sehen Umfragen seine Landespartei als deutlich stärkste Kraft.
»Die Voraussetzungen sind in Thüringen besonders gut«, ruft Höcke. In Erfurt habe »das Kartell« der »Altparteien« seine »ganze Machtgier« gezeigt, als es 2020 die Wahl des Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich »rückgängig gemacht« und später die versprochene Neuwahl abgesagt habe. Das Vertrauen in das überkommene System sei deshalb hier besonders niedrig. Höckes Ziel: Er will Ministerpräsident werden. Nach der Landtagswahl am 1. September 2024 soll die AfD die Landesregierung anführen: »Wir operieren in einer auf Jahre angelegten politischen Strategie. Wir werden regieren, und wir werden gestalten und werden die Zukunft erstreiten. Und wir fangen hier in Thüringen, hier in unserer blauen Hochburg, damit an.«
Wahrscheinlich ist das nicht. Denn dafür benötigte die AfD die absolute Sitzmehrheit im Parlament. Völlig ausgeschlossen ist das Szenario aber auch nicht mehr. Zumal: In der CDU hat längst wieder die Debatte darüber begonnen, ob AfD-Stimmen zumindest billigend in Kauf genommen werden könnten, um die linke Regierung abzulösen. Diese Überlegungen erinnern an eine Konstellation, die vor einem Jahrhundert in Weimar ihre unrühmliche Premiere hatte: eine konservative Landesregierung, toleriert von einer Tarnorganisation der verbotenen NSDAP.
Vor 100 Jahren
Doch warum Thüringen? Was ist besonders an dem Land, in dem viele Menschen vor allem Fichtenwälder und Bratwurst-Grillstätten vermuten? Die Antwort: sehr viel.
Thüringen ist das Land, in dem Bach geboren wurde und Luther das Neue Testament übersetzte. Das Land, in dem Goethe und Schiller ihre größten Werke schrieben, in dem die Frühromantiker wirkten und das Bauhaus entstand. Das Land, in dem SPD und Urburschenschaft gegründet wurden, in dem sich die erste deutsche Republik konstituierte und sich eine Verfassung gab.
Thüringen ist aber auch das Land, in dem 1924 – also genau vor 100 Jahren – Bürgerliche erstmals Rechtsextremisten an der Macht beteiligten. Das Land, das Hitler zu seinem Mustergau umbauen ließ. Das Land, das die Öfen für die Krematorien in Ausschwitz produzierte.
Und Thüringen ist das Land, in dem mit Bodo Ramelow der einzige linke Ministerpräsident an der Spitze der einzigen Minderheitsregierung Deutschlands steht. Das Land, in dem mit Björn Höcke der radikalste und wirkmächtigste AfD-Politiker agiert. Das Land, aus dem der Nationalsozialistische Untergrund (NSU) kam.
Nirgendwo sonst in der Bundesrepublik besetzen Linke und AfD gemeinsam die Mehrheit der Parlamentssitze. Nirgendwo anders wählten Rechtsextreme einen Ministerpräsidenten und kam der erste AfD-Landrat ins Amt. Und nirgendwo anders hat sich die Politik seit 2019 derart selbst blockiert. In der Folge ist das Ansehen der Landesregierung, die Zufriedenheit der Menschen mit der Praxis der Demokratie und das Vertrauen in staatliche Institutionen besonders stark gesunken.2
Wie wurde Thüringen zu einem Land der Extreme? Wieso stehen in Thüringen derart viele Belege der Schöpfung von Hochkultur und demokratischen Werten direkt neben den Mahnmalen, die von den Versuchen ihrer Zerstörung zeugen?
Die Gründe reichen weit in die Geschichte zurück. Sie wurzeln im fruchtbaren Erbe der kleinstaatlichen Residenzen, aber auch in den Verwerfungen und Verbrechen des 20. Jahrhunderts. Sie basieren auf mangelnder westlicher Demokratieerfahrung, den Traumata historischer Transformationen und der Enttäuschung, mit den eigenen, womöglich illusorischen Vorstellungen einer solidarischen, konsensualen, aber doch freien Gesellschaft nicht gesehen zu werden.
Am Anfang stand die Kulturlandschaft zwischen Vogtland, Rhön und Eichsfeld, die seit dem frühen Mittelalter Thüringen heißt. Darüber schichteten sich die Sedimente der neueren Geschichte. Die kulturelle Vielfalt der Miniaturfürstentümer, die bis ins 20. Jahrhundert überdauerten. Die Industrialisierung mit Zeiss, Schott und den Eisenacher Motorenwerken. Die Wirren der Republik, der Weimar ihren Namen gab. Die Schrecken von Naziherrschaft und Krieg. Die Unterdrückung durch die Sowjets und die Repression des DDR-Systems. Das Glücksgefühl der Selbstermächtigung von 1989. Der Wiederaufbau beim gleichzeitigen Durchstehen von Deindustrialisierung und Massenarbeitslosigkeit. Die Folgen des Skiunfalls eines Ministerpräsidenten und das Versagen bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus. Das politische Unvermögen ab dem Jahr 2019, eine Mehrheit zu bilden. Der Schock der Kemmerich-Wahl und der lärmende Stillstand seither.
Mehr als ein Drittel der Thüringer Bevölkerung hegt das Gefühl von Zweitklassigkeit.3 Dieses Drittel findet sich insbesondere in jenen Regionen, die einst wirtschaftliche oder kulturelle Bedeutung besaßen, aber jetzt als strukturschwach und abgehängt gelten. Hier ist das Gefühl des Abstiegs besonders stark – und korreliert mit Wahlerfolgen von Rechtspopulisten. Dieser Zusammenhang wurde in einer Studie der Universität Jena belegt.4
Sowieso mangelt es nicht an wissenschaftlichen Deutungen. So wird etwa mit dem Begriff der Deprivation das Gefühl von Entbehrung, Verlust und Benachteiligung zusammengefasst. Die Reaktanz wiederum beschreibt, wie Menschen, die ein »übergriffiges System« erlebten, auf tatsächlichen oder auch nur vermeintlichen Freiheitsentzug reagieren.5 Aus Sicht des Soziologen Raj Kollmorgen wirken die »alten Populismen und Protestkulturen« der DDR ebenso nach wie die »damals eingeübte Gleichzeitigkeit von harter Staatskritik und paternalistischer Staatsnähe«.6
Die Krise Thüringens ist damit auch eine Krise der Eliten. Viele Leistungsträger verließen während der Zeit der DDR und in den ersten Jahren der Transformation das Land. Oder sie waren – oder galten als – vom alten System korrumpiert. Sie wurden nach der Wiedervereinigung mehrheitlich ersetzt durch Westdeutsche, die heute nahezu alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens dominieren. Viele hätten es im westdeutschen Wettbewerb nur schwerlich auf diese Position geschafft. Doch im Osten besaßen sie die passende Ausbildung, das richtige Netzwerk und vor allem: das nötige Selbstbewusstsein. Ihnen half, dass sich die Einheimischen oft selbst klein machten oder am Ende die Verantwortung scheuten.
Wettbewerb der Westdeutschen
Im Ergebnis ist das Personaltableau an der Spitze in Thüringen besonders schmal – und stammen die meisten der Thüringer Spitzenbeamten, Richter, Rektoren, Intendanten oder Vorstandschefs aus der alten Bundesrepublik. Auch die Mehrzahl der Spitzenkandidaten, die zur Landtagswahl 2024 in Thüringen antreten werden, kommt aus Westdeutschland. Sie wurden in Aachen, Osterholz-Scharmbeck oder in Singen in Baden-Württemberg geboren.
Höcke stammt aus Nordrhein-Westfalen und arbeitete bis zu seinem Einstieg in die Politik als Lehrer in Hessen. Seit 2008 lebt er mit seiner Familie im nordwestlichen Zipfel des Landes, das er mit größtmöglichem Pathos vereinnahmt und von dem aus er seine Mission der Rettung Deutschlands verfolgt. Die Thüringer seien »ein besonders heimatliebendes Völkchen«, ruft er über den Erfurter Theaterplatz. »Das ist eine Basis, auf der wir aufbauen können, ein Fundament, auf dem wir stehen können.«
Tatsächlich fühlen sich 90 Prozent der Thüringer mit ihrem Land, aber auch mit ihrer Region und ihrer Gemeinde »stark verbunden«.7 Jeder Zweite bezeichnet die Verbindung sogar als »sehr stark«. Gleichzeitig, und darauf setzt die AfD erst recht, wächst insbesondere in den ländlichen Gebieten das Gefühl, herabgesetzt und abgewertet zu werden, abgehängt zu sein. Knapp 70 Prozent stimmten der Aussage zu: »Die Politiker in Berlin interessieren sich nicht für die Region, in der ich lebe.«
Dies liegt auch daran, dass Thüringen immer kleiner wird. Die Zahl der Einwohner sank mit der Abwanderung und einknickenden Geburtenzahlen seit 1990 um knapp eine halbe Million auf 2,1 Millionen. Trotz der Zuwanderung von Migranten und Kriegsflüchtlingen wird für das Jahr 2042 nur noch mit gut 1,93 Millionen Einwohnern gerechnet.8 Die Zahl der Geburten ist auf den tiefsten Stand seit 1995 gefallen, der Sterbefallüberschuss befindet sich auf Rekordniveau. Zentrale Ursache ist laut Statistikern der »generelle Rückgang der Zahl der Frauen im gebärfähigen Alter«.9
Die Lebenserwartung sank zuletzt auf das Niveau von 2012.10 Gleichzeitig ist der Thüringer Durchschnittsmensch überdurchschnittlich alt – und unterdurchschnittlich vermögend. Die Erbschaften liegen 50 000 Euro unter dem bundesweiten Median.11 Das Thüringer Lohnniveau ist das zweitniedrigste in Deutschland.12 28 Prozent der Beschäftigten bekommen einen Stundenlohn von unter 14 Euro.13 Die Senioren erhalten im Ländervergleich am wenigsten Rente.14
Diese offensichtliche Schlechterstellung sorgt unter anderem dafür, dass Höckes deutschtümelnder »Sozialer Patriotismus«, dessen Fundament die Xenophobie ist, auch bei Menschen ohne gefestigte rechtsextremistische Ansichten stärker als anderswo verfängt. Dabei ist Thüringen auf Zuwanderung angewiesen. Bis 2035 werden 385 000 Menschen aus dem Arbeitsleben ausscheiden. Und höchstens 247 000 Stellen können nach Berechnungen des Dresdner ifo Instituts durch Jüngere, Arbeitslose oder bisherige Pendler besetzt werden.15 Die Personallücke beträgt 140 000 Menschen.
Doch natürlich speist sich der Erfolg der AfD, die auch in Westdeutschland Umfragewerte von bis zu 20 Prozent erzielt, aus vielen trüben Quellen, die keineswegs in Thüringen entspringen. Die globalen Herausforderungen von Digitalisierung und Klimawandel, Massenflucht, Pandemie und Kriegen erzeugen einen permanenten Veränderungsdruck und führen zu Erschöpfung, Ablehnung, Protest – und bei einer Minderheit zu Revisionismus und Extremismus. Nebenbei etabliert sich eine neue »Weltunordnung«,16 in der China nach der Vorherrschaft strebt und Russland nach seiner alten imperialen Dominanz über Osteuropa. Der Multilateralismus befindet sich in der Krise, derweil der Nationalismus zurückkehrt, einschließlich Eroberungskriegen und Aufrüstung. Das westliche Demokratiemodell gerät zunehmend unter Druck, rechtspopulistische oder gar rechtsextreme Bewegungen gewinnen an Stärke. Ob nun der vierfach angeklagte Donald Trump, der 2024 in den USA um seine Wiederwahl kämpft, Viktor Orban, der in Ungarn an seiner »illiberalen Demokratie« baut, die frühere Mussolini-Verehrerin Giorgia Meloni, die Italien mit einem extrem rechten Bündnis regiert: Bis auf wenige Ausnahmen wie zuletzt in Polen erscheint der Trend eindeutig.
AfD und Agonie
Thüringen ordnet sich in diese Entwicklung ein – ist ihr aber, zumindest, was Deutschland betrifft, auch deutlich voraus. Hier sieht sich die AfD als Avantgarde. Hier setzt sie auf die Erosion der sogenannten Brandmauer, die alle anderen Parteien um sie herum errichtet haben. Und hier zeigen die gemeinsamen Abstimmungen von CDU und FDP mit der AfD im Landtag die Versuche, sich aus einem strategischen Dilemma zu befreien, in dem man sich seit der Wahl 2019 und dem Kemmerich-Interregnum befindet.
Bislang allerdings bleibt die Union gefangen: Auf der einen Seite sieht sie sich genötigt, die linke Minderheitskoalition eingeschränkt zu dulden, um Thüringen nicht in eine neuerliche Staatskrise zu stürzen. Auf der anderen Seite muss sie konservatives Profil zeigen, um sich von Rot-Rot-Grün abzugrenzen und der AfD nicht zu viel Terrain zu überlassen. Doch in welche Richtung sich die CDU in Thüringen auch bewegt: Immer tangiert sie den Abgrenzungsbeschluss der Bundespartei. Die AfD hat gelernt, jede Gelegenheit zur Mehrheit für sich zu nutzen – und sei es, indem sie Rot-Rot-Grün stützt.
Das Ergebnis dieser Konstellation ist quälende Agonie. Nur das Allernötigste – Landeshaushalte, Hilfspakete, Staatsverträge – findet nach nervenaufreibend langem Streit eine Mehrheit. Währenddessen ist die Funktionsfähigkeit essenzieller parlamentarischer Gremien wie dem Richterwahlausschuss oder der Kontrollkommission für den Verfassungsschutz chronisch gefährdet.
Die schiere Anwesenheit einer starken extremistischen Partei führt dazu, dass sich das parlamentarische System zunehmend selbst blockiert. Die Situation vergiftet das politische Klima, beschädigt das Landesimage und bremst Investitionen aus. Das Wirtschaftswachstum stagniert, das Land verliert in den Bildungsrankings Positionen – und das Vertrauen in Regierungen und Demokratie sinkt. Dass die Staatsanwaltschaft Erfurt ein Untreue-Ermittlungsverfahren gegen die Landesregierung einleitete, dass der CDU-Landeschef unter dem Verdacht der Bestechlichkeit stand, dass sich die grüne Vize-Ministerpräsidentin trickreich einen lukrativen Lobby-Job sicherte, kostete zusätzlich Ansehen. Es ist eine Abwärtsspirale, mit der ein Erfolg der AfD zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung wird.
Währenddessen legt die AfD zu, obwohl ihr Landeschef Höcke wegen Volksverhetzung angeklagt ist. In Sonneberg gewann sie im Juni 2023 ihren ersten Landrat und wenige Monate später in Nordhausen beinahe ihren ersten Oberbürgermeister. Und das war nur der Probelauf. Im Frühjahr 2024 wird in Thüringen parallel zum EUParlament über die Stadträte, Kreistage, Gemeinderäte, Landräte und Oberbürgermeister abgestimmt, bevor am 1. September der Landtag gewählt wird.
Funktionsfähige Mehrheiten scheinen nicht in Sicht, zumal zwei neue Parteien unter der Führung von Sahra Wagenknecht und Hans-Georg Maaßen antreten wollen. Zwar wirkt der Schock der Kemmerich-Wahl von 2020 nach und engt die Operationsfähigkeit der AfD ein. Gleichzeitig schließt die CDU für sich aus, nochmals eine Linke-geführte Minderheitsregierung ins Amt zu lassen. Die zwischenzeitliche Zusammenarbeit, sagt Voigt, sei nur einer »absoluten Notsituation« geschuldet gewesen.17
Doch was ist, wenn sich die Notsituation wiederholt? Falls die AfD zur stärksten Partei aufstiege, geriete bereits die konstituierende Sitzung des Parlaments zur Machtprobe. Als größte Fraktion dürfte eine in großen Teilen extremistische Partei den Parlamentspräsidenten nominieren. Gewänne die AfD gar ein Drittel der Sitze des Landtags, könnte sie Verfassungsänderungen, Richterwahlen und die Besetzung des Rechnungshofes blockieren. Damit besäße sie eine Sperrminorität. »Der Boykott der AfD und die Blockade des Parlaments als Transmissionsriemen des Volkes hätten damit ein Ende«, frohlockt schon einmal Björn Höcke.18 Der Weg zur Macht soll für ihn über Erfurt nach Berlin führen: 2025 wird der Bundestag neu gewählt.