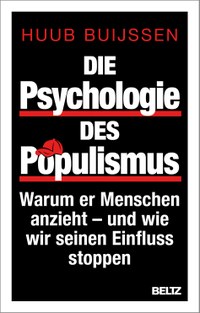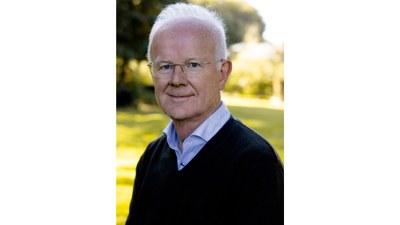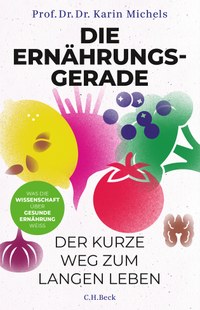Einleitung
Wie kommt es, dass populistische Parteien weltweit so schnell an Popularität gewinnen? Wie kommt es, dass politische Persönlichkeiten, die kein Problem damit haben, soziale Ungleichheit zu verschlimmern, ausgerechnet die Unterstützung derjenigen genießen, die von ihren Vorstellungen und ihrer Politik am meisten betroffen sind und benachteiligt werden? Wie kommt es, dass Politiker, die sich einer vulgären Sprache bedienen und ihre Kollegen beleidigen, das Vertrauen vieler Wähler erringen?
Diese Fragen beschäftigen mich schon seit vielen Jahren. Im vorliegenden Buch ergründe ich die Geheimnisse hinter dem zunehmenden Erfolg populistischer Auffassungen. Da mein Fachgebiet die Psychologie ist, suche ich nach Antworten, die aus meiner eigenen Disziplin stammen. Das scheint mir gerechtfertigt, denn Entscheidungen, und dazu gehören auch die Gründung oder Wahl einer politischen Partei, entspringen vor allem der menschlichen Psyche. Was einen Menschen zum Menschen macht – seine Wünsche, Motive, Triebe, Ängste –, bestimmt die Ideologie eines Politikers. Und es bestimmt, wo ein Bürger im Wahllokal schließlich sein Kreuzchen setzt. In diesem Buch werde ich auf die immer breiter werdende Palette an Spezialisierungen innerhalb der Psychologie zurückgreifen. Dabei schöpfe ich vor allem aus den gut gefüllten Wissensspeichern der Entwicklungspsychologie, der Ökonomischen Psychologie, der Psychogerontologie (meiner eigenen Spezialisierung), der Biologischen Psychologie, der Moralpsychologie, der Neuropsychologie, der Klinischen Psychologie, der Sozialpsychologie und der Evolutionären Psychologie – dem für dieses Buch wichtigsten Bereich.
Ich mache nun einen kurzen Abstecher in die Marketingpsychologie, die Wissenschaft der Konsumentenbeeinflussung. Damit will ich verdeutlichen, was ich mit dem Buch zu erreichen hoffe. Wenn wir einen Supermarkt betreten, sehen wir fast überall zunächst Regale mit Obst und Gemüse. Legen wir gleich zu Beginn frische und gesunde Produkte in den Einkaufswagen, sind wir anschließend eher bereit, ungesündere Produkte einzukaufen, die oft auch mehr Umsatz bringen. Entscheiden wir uns außerdem erst vor Ort im Supermarkt, was wir essen wollen, lassen wir uns am Eingang mit Obst und Gemüse zu den dazu passenden Zutaten inspirieren. Die Wege in den Märkten laufen oft gegen den Uhrzeigersinn. Das führt dazu, dass wir unbewusst langsamer gehen und damit auch mehr Zeit haben, Produkte im Wagen oder Korb zu deponieren. Ein Team von Psychologen hat über alle diese Dinge gründlich nachgedacht. Durchschauen wir die psychologischen Tricks des Supermarktes, können wir uns besser vor den Versuchungen schützen, die dort überall lauern. Da ich meine eigenen Schwächen kenne, nutze ich aktuell eine Einkaufsliste, an die ich mich strikt halte.
Entsprechend hoffe ich, dass wir uns besser gegen Populismus wappnen können, wenn wir seine Geheimnisse entschlüsseln und die Anziehungskraft verstehen, die er auf viele ausübt. Als wichtiges Ziel hierbei sehe ich den Erhalt der liberalen Demokratie, der nach Aristoteles am wenigsten schlechten aller Verfassungsformen.1
Das Lebensmotto des belgischen Schriftstellers Georges Simenon ist zugleich auch meins: Urteile nicht, sondern versuche zu verstehen. Ich habe mir die allergrößte Mühe gegeben, das vorliegende Buch aus dieser Haltung heraus zu schreiben. Mir kann es nur mit einem vorurteilsfreien oder unvoreingenommenen Blick gelingen, den Populismus zu ergründen. Gleichzeitig ist mir bewusst, dass ich mir damit eine unmögliche Aufgabe aufgehalst habe. Schon während meiner allerersten Psychologievorlesung habe ich den sogenannten Bestätigungsfehler kennengelernt, den kognitiven Zustand, der unseren Blick und unser Denken unausweichlich trübt. Der Professor erläuterte uns, wir seien sehr gut darin, die Meinungen und Aussagen anderer Menschen herauszufordern, während wir unsere eigenen jedoch automatisch verteidigen und schützen würden. »Je klüger ein Mensch ist, desto mehr Argumente kann er für seine eigene Sicht vorbringen«, fügte er damals hinzu. Oder wie es der tschechische Schriftsteller Milan Kundera einst kurz und knapp ausdrückte: »Doch was ist eine Überzeugung? Ein Gedanke, der stehen geblieben, der erstarrt ist.«2
Der Moralpsychologe Jonathan Haidt, der in Kapitel 10 die Hauptrolle spielen wird, hat bereits darauf aufmerksam gemacht, dass es vor allem die eigenen Werte und Moralvorstellungen sind, die uns für den Standpunkt des anderen blind werden lassen. Auch mir ist es nicht gelungen, dem erwähnten psychologischen Prinzip zu entkommen. Ich gestehe lieber gleich, dass ich mehrfach, sogar schon in dieser Einleitung, meine eigenen Auffassungen (lies: Abneigungen) über Populismus nicht für mich behalten konnte, weswegen ich doch geurteilt habe. Ich bitte meine Leser – vor allem die Populisten unter ihnen – vorab um Entschuldigung.
Wie ist das Buch aufgebaut? Was dürfen Sie erwarten? In Kapitel 1 werde ich versuchen zu beschreiben, was Populismus ist und wie man ihn erkennen kann. Das Wort »versuchen« habe ich absichtlich gewählt, denn wie ich zeigen werde, ist es gar nicht so einfach, Populismus zu definieren.
In den sechs folgenden Kapiteln werde ich den Fokus auf populistische Politiker und ihre Ideen legen. Ich beschreibe darin die sechs psychologischen Gründe der Anziehungskraft, die in der Literatur über Populismus auch die Angebotsseite genannt werden.
Kapitel 8 und 9 widmen sich der Nachfrageseite. Wer wählt populistische Parteien? Was bewegt diese Wähler? Welche Profile haben sie? Ja, ich schreibe hier bewusst in der Mehrzahl. Wie bei der Anschaffung eines neuen Autos sind die Motive, warum jemand eine bestimmte Partei wählt, sehr unterschiedlich. Als meine Familie vor zehn Jahren ein Auto kaufen wollte, haben wir mit Blick auf das Klima nach dem sparsamsten Wagen gesucht, der auf dem Markt war (und landeten beim Suzuki Celerio). Ein anderer hat dieses Auto möglicherweise wegen des niedrigen Preises gekauft, ein Dritter, weil man bequem überall damit parken kann, bei einem Vierten gab vielleicht der hohe Wiederverkaufswert den Ausschlag, und so weiter.
In Kapitel 10 führe ich die Angebots- und Nachfrageseite, die ohnehin nicht immer gut zu trennen sind, wieder zusammen, wenn ich die Moral des Populismus bespreche. Dann steht die Frage im Mittelpunkt, welche Ethik der Ideologie des Populismus zugrunde liegt. Um sie zu beantworten, werde ich die Moral des Populismus dem linksorientierten Denken gegenüberstellen. Ich verspreche Ihnen: Das ist ein interessantes Kapitel! (Denken Sie jetzt nicht, ich würde mir selbst auf die Schulter klopfen: Der Inhalt des Kapitels entspringt zum größten Teil nicht meinem Kopf, sondern dem des bereits erwähnten Jonathan Haidt.)
Im Schlusskapitel werde ich auf Grundlage der bis dahin gewonnenen Erkenntnisse versuchen, einige Tipps zur Bekämpfung des Populismus anzubieten. Hiermit erkläre ich im Vorhinein einen Haftungsausschluss: Erwarten Sie nicht zu viel von diesen Ausführungen. Ich hoffe, dass die Lektüre dieses Buchs dazu beiträgt, das Rätsel der zunehmenden Popularität des Populismus für die Leser ein wenig zu lüften, damit sie selbst auf Ideen kommen, wie das Blatt noch gewendet werden könnte. Kurz gesagt: Ich hoffe, dass das »Begreifen« dazu führt, das Phänomen Populismus besser »in den Griff« zu bekommen.
Zur Auflockerung werde ich häufig persönliche Erfahrungen aus meinem eigenen Leben einflechten. Mir ist bewusst, dass ich dabei ein großes Risiko eingehe, denn wie schon mein Lieblingsphilosoph Michel de Montaigne schrieb: »Letztlich jedoch spricht man über sich selbst niemals ungestraft. Während Selbstkritik stets gut ankommt, wirkt sich Eigenlob nur nachteilig aus.«3
In meinem Buch finden sich zudem Zitate, nicht nur von populistischen Politikern, sondern auch von Politologen, Psychologen, Philosophen, Journalisten und Wählern. Denn wie wieder Montaigne es ausdrückte: »In meinen Zitaten lasse ich andere sagen, was ich selber nicht so gut ausdrücken könnte, sei es aus Mangel an Sprachgewandtheit, sei es aus Mangel an Scharfsinn.«4
Was ist Populismus?
»Ohne dieses Kabinett könnten die Niederlande so viel besser aussehen: reicher, sicherer, sozialer, niederländischer. Die Elite träumt ihre süßen rosa Träume, aber das Volk ist nicht verrückt. Die Menschen, die seit Jahrzehnten beschissen werden, lassen sich das nicht mehr gefallen. Veränderung liegt in der Luft. Hoffnung dämmert am Horizont. Man spürt es überall, es gibt auch kein Halten mehr. Jeder sieht es, außer den Leuten in der Ministerriege.«1
So äußerte sich der Anführer der Partij voor de Vrijheid (Partei für die Freiheit, PVV), Geert Wilders, während der Haushaltsdebatte von 2009 im niederländischen Parlament. Wie wir gleich sehen werden, gab er damit in wenigen Sätzen ein grandioses Beispiel populistischer Rhetorik zum Besten.
Was ist Populismus? Die Frage, mit der wir uns in diesem Kapitel beschäftigen, ist auch der Titel eines Buchs von Jan-Werner Müller, Professor für Politologie an der Princeton University und einer der führenden politischen Denker derzeit.2 Ihm zufolge steht uns kein Set aus kohärenten Kriterien zur Verfügung, anhand dessen wir bestimmen könnten, wann jemand im echten Wortsinn ein Populist ist. Daher können wir Populismus noch nicht eindeutig beschreiben. Einige Politologen haben jedoch bereits pionierhafte Versuche unternommen, um die Merkmale von Populisten zu beschreiben.
Merkmale
Notwendige Voraussetzung, um als populistischer Politiker bezeichnet werden zu dürfen, ist nach Müller zunächst, dass er (oder sie) die Eliten kritisiert. Wie Wilders im oben genannten Zitat: »Die Elite träumt ihre süßen rosa Träume.« Aber nicht jeder, der den Status quo kritisiert, ist per Definition ein Populist. Dann müsste man alle Politiker, die vehement oppositionelle Ansichten vertreten, mit diesem Etikett versehen. Ist es nicht der politische Auftrag der Opposition, die Arbeit der Regierung zu hinterfragen und eigene Programme anzubieten? Anti-Elitarismus ist daher zwar eine notwendige, aber keine hinreichende Voraussetzung für Populismus.
Populisten sind jedoch nicht nur anti-elitär, sondern auch antipluralistisch. Für sie setzt sich »das Volk« nicht aus verschiedenen Bürgern mit unterschiedlichen und manchmal sogar kollidierenden Meinungen und Interessen zusammen – in ihren Augen ist es eine homogene Gruppe. Weil »das Volk« ihrer Ansicht nach unteilbar ist, sind mehrere (oder andere) Meinungen oder Parteien miteinander »unvereinbar«.
»Das Volk ist nicht verrückt«, sagt Wilders. Damit meint er: »Das Volk weiß es am besten.« Implizit sagt er damit auch, dass der »Wille des Volkes«, und damit seine Interessen und Wünsche, eindeutig ist. Dabei wird dieser Wille auch immer als rechtschaffen und rein dargestellt. Politische Gegner sind nach Ansicht von Populisten eine kleine unmoralische Gruppe, die eigentlich nicht zum »Volk« gehört, durch und durch verdorben und ausschließlich auf den eigenen Gewinn aus ist. Wie Jörg Haider, der ehemalige Vorsitzende der rechtspopulistischen Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ), der sprach von den »Gaunern der Republik […], die unter dem Deckmantel der Universität und Wissenschaft oder sonstigen Institutionen agieren«.3
Populisten richten ihre Pfeile nicht nur auf Politiker, die vermeintlich an der Macht kleben und ausschließlich ihre eigenen Interessen verfolgen. Im »Namen des Volkes« ziehen sie auch in den Kampf gegen Universitäten, gegen die Justiz und den (kritischen) Journalismus.
Letzteren bezeichnete die ehemalige Parteichefin der Alternative für Deutschland (AfD) Frauke Petry als »Pinocchio-Presse«4, und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan sprach von der »Journaille« und sogar den »Terroristen mit der Feder«.5
Populisten werfen dem Journalismus vor, parteiisch und korrupt zu sein, sich stets auf die Seite der etablierten Ordnung zu stellen und so die Reinheit der Nation in Gefahr zu bringen. Populisten werden auch nie müde, von den Dächern zu schreien, das einfache Volk, und nicht die Eliten, müsse in der Politik das erste und letzte Wort haben.
Wer ihre politische Agenda nicht teilt, so impliziert ihre populistische Logik, gehört auch nicht wirklich zum »Volk« und ist daher ein »Volksfeind«. Denn dieser lebt isoliert vom »Volk« und ist folglich auch blind und taub für das, was »im Volk« vor sich geht. Noch einmal Wilders: »Jeder sieht es, außer den Leuten in der Ministerriege.«
Der Politologe Professor für Politologie Maurits Meijers und sein Kollege, Dr.Andrej Zaslove, beide an der Universität Nijmegen tätig und auf Populismus spezialisiert, nennen als letztes Merkmal für Populisten noch ihr »manichäisches Weltbild«.6 Damit meinen sie, dass Populisten die Politik für einen Kampf zwischen Gut und Böse halten. Für sie sind alle, die zur etablierten Ordnung gehören, schlecht und korrupt, weswegen sie vom Thron gestoßen werden müssen. Bei Wilders klingt das so: »Die Menschen, die seit Jahrzehnten beschissen werden, lassen sich das nicht mehr gefallen. Veränderung liegt in der Luft.«
Sobald Populisten selbst an die Macht gekommen sind, erkennen sie nicht einmal mehr das Existenzrecht der Opposition an, so Müller, und bilden eine Gefahr für die Demokratie.
Wie erkennt man Populisten?
Jetzt wissen wir, über welche Merkmale ein Populist verfügt. Aber wie erkennen wir ihn? Wie spricht ein populistischer Politiker? Wie hält er eine Rede vor »dem Volk«? Der international anerkannte niederländische Populismusexperte Cas Mudde hat mit verschiedenen Kollegen gesprochen und ihnen die Frage gestellt, wie man einen Populisten erkennen könne.7 Den Experten zufolge gibt es fünf Muster im Sprachgebrauch, die Populisten gemeinsam sind:
Der Populist verweist in Reden und Kampagnen ständig auf »das Volk«. Er sagt beispielsweise: »Ich möchte dem Volk eine Stimme geben.« Nach einem für ihn günstigen Wahlergebnis kann man die Uhr danach stellen, dass der Populist sagt: »Das ist ein Sieg für das einfache Volk.«
Er verwendet Personalpronomen, um eine Beziehung zu seiner Zuhörerschaft herzustellen und einen Gegensatz zwischen dem »Wir« (dem »Volk«) und dem »Sie« (der Elite) zu schaffen. Den Satz von vorhin »Das ist ein Sieg für das einfache Volk« wird er um den Satz ergänzen: »Das ist ein Sieg für euch.« Oder: »Wir geben euch, dem Volk, die Macht zurück.« Er spricht also nicht über die Köpfe der Zuhörenden hinweg, sondern spricht sie direkt an.
Er zieht über die Elite her, etwa in Sätzen wie: »Das Establishment hat ausgezeichnet für sich gesorgt, aber nicht für die Bürger und Bürgerinnen in unserem Land.« Oder, um das zuvor schon erwähnte Zitat von Wilders noch einmal zu bemühen: »Die Elite träumt ihre süßen rosa Träume, aber das Volk ist nicht verrückt. Die Menschen, die seit Jahrzehnten beschissen werden, lassen sich das nicht mehr gefallen.«
Wenn der Populist seine politischen Gegner kritisiert, nutzt er häufig die Metonymie. Bei dieser Stilfigur wird die Bezeichnung für eine Person oder ein Objekt durch einen anderen Begriff ersetzt, der in einer engen Beziehung zu dem eigentlich Gemeinten steht. Ein Beispiel ist der Titel des Wahlprogramms der PVV von 2012 bis 2017: »Ihr Brüssel, unsere Niederlande«. »Brüssel« steht hier (natürlich) für die Europäische Union, von der die PVV nichts wissen will.
Populisten betonen, dass ihre Zuhörerschaft oder ihr Publikum Opfer der aktuellen (nicht populistischen) Regierung ist.
Für diese Opferrolle brachte Alice Weidel bei einem Bürgerdialog am 22. September 2022 in Hoppegarten folgendes starke Beispiel:
»Die Bundestagdebatten legen doch ganz klar offen, dass es diesen Menschen an Gefühl fehlt, an Bodenhaftung, an Problembewusstsein, für uns, für die arbeitende Bevölkerung, die hier völlig … die hier VÖLLIG … ich sag’s jetzt einfach mal ganz … [tief seufzend und kurz spannungsaufbauend pausierend], es geht mir nicht über die Lippen … [wieder pausierend], aber vielleicht sag ich es doch: Ihr werdet doch alle verarscht von denen da oben. Darum geht es doch! Sie werden hier über den Tisch gezogen! Und das tut mir für die Millionen Wähler so leid, die diesen Mist nicht gewählt haben. Das haben sie nicht verdient! Mir tut es leid für die Wähler, die uns gewählt haben. Aber ich kann versprechen: Wir werden mehr. Und wir werden das Blatt wenden. Und dafür sind wir angetreten.«8
Man bemerke, dass sie schon im ersten Satz die beiden ersten Merkmale von Populismus erfüllt: Sie verweist darin nicht nur auf das »Volk«, sondern stellt direkt auch eine Verbindung her: für uns, die arbeitende Bevölkerung.
Es gibt kein Rezept und keine perfekte Formel, wie man populistische Äußerungen identifiziert, so Cas Mudde. Wenn ein Politiker behauptet, die Elite oder ein politischer Gegner sei korrupt, bedeutet das nicht automatisch, dass wir es mit einem populistischen Politiker zu tun haben. Anti-Elitarismus ist, wie bereits erwähnt, eine notwendige, aber unzureichende Bedingung für Populismus. Entscheidend für die Frage, ob es sich um einen Populisten handelt, ist, ob das skizzierte Muster den wichtigsten Rahmen für die Rhetorik des Politikers bildet. Wie ein Künstler oder eine Band, die einmalig einen großen Hit gelandet hat, bei jedem Auftritt ihr Publikum mit diesem Stück beglückt, wird der Populist bei jeder Kampagne dasselbe Lied anstimmen. Und genau wie die Fans der Band mit dem One-Hit-Wonder bei jedem Auftritt auf ihren Lieblingssong warten und schon bei den ersten Klängen des Stücks zu jubeln anfangen, werden die glühenden Anhänger eines populistischen Anführers jubeln, wenn sie ihre Lieblingsmelodie hören. Später, in Kapitel 6, werde ich noch ausführlicher darauf eingehen, wie Populisten eine Rede vor ihrer Zuhörerschaft halten, und versuchen, eine psychologische Erklärung zu finden, warum viele Menschen der populistischen Rhetorik erliegen.
Das Spektrum von rechts bis links
Links oder rechts? Das ist eine der ersten Fragen, sobald eine neue Partei in der politischen Landschaft auftaucht. Links und rechts bilden daher auch wichtige Ordnungskriterien im Politikbetrieb. Links steht für fortschrittlich, für das Streben nach (ökonomischer und politischer) Gleichheit und für eine hohe Besteuerung von Reichen und Unternehmen, die hohe Gewinne erzielen. Rechtsorientierte Politiker sind eher konservativ oder werterhaltend. Sie stellen das Individuum über die Gesellschaft und wollen die staatliche Einmischung so gering wie möglich halten, weswegen sie auch niedrige Steuertarife propagieren. Wenn es um Populismus geht, ist auch die Haltung gegenüber Einwanderern essenziell. Für das rechte politische Spektrum ist deren Ausschluss oder Abwehr ein Hauptthema, für das linke nicht.
Die derzeit bekanntesten Populisten im In- und Ausland sind rechtspopulistisch. Wer der Politik und den Nachrichten auch nur ein klein wenig folgt, kennt nicht nur die Namen von Donald Trump, Alice Weidel, Herbert Kickl (FPÖ, Österreich) und Marine Le Pen (Rassemblement National, Frankreich), sondern auch die von Recep Tayyip Erdoğan (AKP, Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung, Türkei) und Viktor Orbán (Fidesz, Ungarn).
Jedoch finden wir auch im linken Spektrum Populisten wie Martin Schirdewan und Janine Wissler, die beiden ehemaligen Vorsitzenden der Partei Die Linke, und Sarah Wagenknecht, die im Herbst 2023 Die Linke verließ und eine neue, nach ihr benannte Partei gründete: das Bündnis Sarah Wagenknecht (BSW).
Auch außerhalb Deutschlands gibt es Linkspopulisten, aber diese sind dem größeren Publikum weniger bekannt. Alexis Tsipras (von der griechischen Partei Syriza, und von 2015 bis Juli 2019 Ministerpräsident Griechenlands) wird den meisten noch ein Begriff sein. Aber wie viele kennen Pablo Iglesias (von der spanischen Partei Podemos), den bolivianischen Präsidenten Evo Morales und den brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva? Auch sie wenden sich gegen die Elite, aber eine andere, nämlich die der Profite abstaubenden Bankiers und gierigen CEOs, um in ihrer Terminologie zu bleiben.
Ist Populismus nun ein binäres Konzept mit Populisten auf der einen Seite und Nichtpopulisten auf der anderen? Gibt es keine »Grautöne«? »Aber sicher doch«, sagen die bereits genannten Politologen Maurits Meijers und Andrej Zaslove aus Nijmegen. Ihrer Ansicht nach lässt sich Populismus vielmehr als ein Spektrum von ganz links bis ganz rechts außen beschreiben. Sie hatten eine Expertengruppe gebeten, alle Parteien, die 2019 in der niederländischen Zweiten Kammer saßen, in Bezug auf Populismus zu beurteilen. Die Experten orientierten sich an den Merkmalen, die oben als typisch für den Populismus beschrieben wurden. Auf einer Elf-Punkte-Skala von 0 bis 10 erzielte die niederländische PVV das höchstmögliche Ergebnis: eine 10.
Bewegungen nach dem »Führerprinzip«
Populistische Parteien sind dem Namen nach zwar häufig demokratisch, doch in der Praxis handelt es sich oft um Bewegungen, die nach dem Modell des »Führerprinzips« funktionieren. So werden Parlamentskandidaten der PVV oder der ebenfalls niederländischen populistischen Partei Forum für Demokratie (Forum voor Democratie, FvD) nicht von den Mitgliedern gewählt, sondern von den jeweiligen Parteiführern. In der PVV gibt es überhaupt keine Mitglieder. Einst war auch die Lijst Pim Fortuyn (Liste Pim Fortuyn) in Wirklichkeit eine Ein-Mann-Partei oder -Bewegung. Fortuyns tragischer Tod verhinderte, dass er in die Zweite Kammer einzog (oder wie er selbst prophezeite: Ministerpräsident werden konnte). Wäre er nicht ermordet worden, hätte man damals kein Psychologe oder Politologe sein müssen, um vorherzusagen, dass Parteimitglieder, die es in die Kammer geschafft hätten, lediglich Fußabtreter oder Adjutanten gewesen wären. Denn weil innerhalb einer populistischen Partei »der Wille des Königs Gesetz« ist, müssen sich Kammermitglieder nach dem großen Boss richten. Wer in der Öffentlichkeit einen abweichenden Standpunkt vertritt, kann sicher sein, dass er oder sie ohne Pardon aus der Partei fliegt.
Die Fairness gebietet es zu erwähnen, dass auch nicht populistische Parteien nicht davor zurückschrecken, Mitglieder zur Ordnung zu rufen, die öffentlich etwas verlauten lassen, das zu weit von der Parteilinie abweicht. Auch sie entscheiden sich manchmal für weitreichende Sanktionen, indem sie etwa jemanden auf einen aussichtslosen Listenplatz setzen oder aus der Partei ausschließen. Aber das lässt unberührt, dass der Bewegungsspielraum innerhalb einer populistischen Partei sehr viel kleiner ist als bei nicht populistischen Parteien. Die PVV, die von ihren Parteigenossen Kadavergehorsam verlangt, hat daher eine lange Geschichte unüberwindlicher politischer Konflikte, öffentlicher Streitigkeiten, Ausschlüsse und Abspaltungen.
Der türkische Präsident Erdoğan hat seinen Kritikern einst vorgehalten: »Wir sind das Volk. Wer seid eigentlich ihr?«9 Möglicherweise war dieser Ausdruck inspiriert von den demonstrierenden DDR-Bürgern während des Falls der Berliner Mauer, die sich damals mit dem Slogan »Wir sind das Volk« gegen das Regime der Sozialistischen Einheitspartei der DDR richteten. Mit der Verwendung der »Wir-Form« erweckt Erdoğan den Anschein, im Namen seiner Partei zu sprechen, aber wer gut hinhört, fasst das »wir« als einen Pluralis Majestatis auf. Wie Erdoğan glauben die meisten populistischen Anführer, sie seien die authentische Stimme und Verkörperung des »Volkswillens«. Eine populistische Partei ruht daher häufig auf nur einer einzigen Säule, dem Parteiführer. Steigt dieser aus der Politik aus oder stirbt, bleibt auch die Partei oft auf der Strecke. Der Titel des Buches, das der Journalist Chris Aalberts über Thierry Baudet, den Gründer und Parteiführer der eingangs erwähnten FvD, verfasste, trägt den bezeichnenden Titel: De partij dat ben ik (Die Partei, das bin ich).10 Das hätte auch auf dem Cover von Büchern über viele andere populistische Parteiführer stehen können.
Nationalpopulismus
In diesem Buch werde ich mich auf den Rechtspopulismus konzentrieren, und zwar aus zweierlei Gründen. Der wichtigste ist, dass von ihm die größte Bedrohung für unser Land, die Niederlande, und die uns umgebenden Länder ausgeht. Der zweite Grund ist eher didaktischer oder inhaltlicher Natur: Es wäre verwirrend, wenn ich bei jedem Thema, das ich anschneide, sowohl linke als auch rechte Standpunkte aufzeigen würde.
Die englischen Politologen Roger Eatwell und Matthew Goodwin, Autoren des Buches National Populism, sind der Ansicht, man werde vielen politischen Anführern, die als rechtspopulistisch gelten – wie Donald Trump, Marine Le Pen und Geert Wilders –, nicht gerecht, wenn man sie als rechtspopulistisch bezeichne.11 Sie hätten schließlich oft Standpunkte vertreten, die nicht gut in die Einteilung von rechts und links passen würden. So ist Wilders in Bezug auf Einwanderer rechts, bei Themen wie Pflege und Rente jedoch links. Und sowohl für die AfD als auch für die FPÖ gilt, dass sie auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit und Altersvorsorge manchmal linke Standpunkte vertreten (wobei sie selbstverständlich den Fokus auf den Schutz der Interessen der einheimischen Bevölkerung legen).
Eatwell und Goodwin schlagen daher vor, statt von Rechtspopulismus von Nationalpopulismus zu sprechen. Darunter verstehen sie eine Ideologie, die die Kultur und Interessen des eigenen Landes in den Vordergrund stelle. Außerdem verspreche sie, denjenigen Menschen eine Stimme zu geben, die sich von der korrupten und weit von ihnen entfernt stehenden Elite vernachlässigt, ja verachtet fühlen. Eine Elite auch, deren Werte, wie dieses Buch zeigen wird, fundamental anders sind als die der Menschen, die sie regieren. Ich kann mich in der Terminologie von Eatwell und Goodwin gut wiederfinden und verwende in diesem Buch daher fortan den Begriff Nationalpopulismus statt Rechtspopulismus.
Zusammenfassung
Eine eindeutige Definition von Populismus gibt es bisher nicht, aber wir können ihn dennoch an den folgenden Merkmalen erkennen: Er ist anti-elitär, betrachtet das »Volk« als homogen, schreibt diesem einen eindeutigen Willen zu, gibt ihm immer das letzte Wort und hält die Politik für einen Kampf zwischen Gut und Böse. Es gibt sowohl Links- als auch Rechtspopulismus sowie Mischformen, und neben populistischen Parteien par excellence auch Parteien mit nur einem oder mehreren populistischen Merkmalen.
Wie kommt es, dass Menschen eine populistische Partei wählen? Im folgenden Kapitel hoffe ich zu verdeutlichen, dass das Geheimnis in einer besonderen Funktion unseres menschlichen Gehirns verborgen liegt, nämlich dem Teil, der Erinnerungen speichert: unserem Gedächtnis.