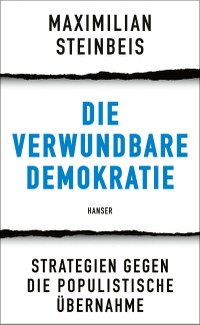1. Verfassungsmissbrauch
Grundrechts-Extremisten
Hallo, sagt Stephan Brandner und stellt sich vor: Er sei gut 50 Jahre alt, gelernter Industriekaufmann, seit 1996 Rechtsanwalt in Gera und seit 2014 Abgeordneter erst im Thüringer Landtag, jetzt im Bundestag. »Als Rechtsanwalt und Rechtspolitiker«, sagt Brandner und breitet die Arme aus, »liegen mir unsere Grundrechte, liegt mir unser Grundgesetz sehr am Herzen.« Und es schmerze ihn sehr, wie mit manchen Grundrechten umgegangen werde in der Coronakrise. Mit den Füßen würden sie getreten, das Grundrecht auf Eigentum, das Grundrecht auf Berufsfreiheit. »Hunderttausende sind draußen betroffen von staatlichen Schließungsverfügungen und wissen nicht, wie sie finanziell über die Runden kommen können.« Weshalb es wichtig sei, »die Grundrechte in Krisenzeiten zu leben. Bleiben Sie wachsam! Gemeinsam für das Grundgesetz!«
Brandner ist einer von drei stellvertretenden Bundesvorsitzenden der AfD, ein enger Gefolgsmann des Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke und der Erste in der Geschichte der Bundesrepublik, der es durch schiere Unerträglichkeit geschafft hat, als Vorsitzender eines Bundestagsausschusses mitten in der laufenden Legislaturperiode abgesetzt zu werden. Und er ist einer von 46 AfD-Politikern, die im Frühling und Sommer 2020, auf dem Höhepunkt der Coronapandemie, für die Kampagne »Gemeinsam für das Grundgesetz« vor die Kamera treten und ein kurzes Video zu ihrem jeweiligen Lieblings-Grundgesetzartikel aufnehmen.
Mit dieser Kampagne bemüht sich die AfD, von ihrem Verhältnis zur bundesdeutschen Verfassung ein geradezu inbrünstig affirmatives Bild zu zeichnen. Das Grundgesetz sei »die beste Verfassung, die wir je hatten«, heißt es im Begleittext zu den Videos. »Es garantiert uns Grundrechte, die uns vor staatlicher Willkür schützen. Doch diese müssen Tag für Tag neu verteidigt werden.« Verfassungsfeindliche Extremisten? Aber keine Spur, im Gegenteil: »Was unser Grundgesetz angeht«, sagt ein Berliner AfD-Kommunalpolitiker in einem der Videos, »so sage ich ganz klar: Ich bin ein Grundrechts-Extremist!«
Die meisten dieser Videos sind nach einem stereotypen Muster aufgebaut: Hier steht eine Verfassungsnorm, zumeist ein Grundrecht. Dort stehen Bürgerinnen und Bürger, die durch empörende Zustände und Machenschaften um ihr gutes Recht gebracht werden. Sie werden oft – explizit oder implizit – in der ersten Person Plural angesprochen: Das Grundgesetz garantiert uns bzw. unsereinem dieses oder jenes Recht, aber diese unsere Rechte werden uns bzw. unsereinem grundgesetzwidrig vorenthalten, weshalb wir die eigentlichen Verteidiger der Verfassung sind im Gegensatz zu denjenigen, die uns unsere Rechte streitig machen. Deshalb: »Gemeinsam für das Grundgesetz!«
Was es mit den jeweiligen Verfassungsnormen auf sich hat und warum und auf welche Weise sie für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenwürde und für den Bestand einer wohlgeordneten Gesellschaft in einem gut regierten Staat wichtig sind, spielt in diesen Videos so gut wie keine Rolle. Grundrechte werden als eine Art Besitzstand behandelt, als »verdinglichte Freiheit«, die einem gehört wie das Auto in der Garage oder der Ölkessel im Keller. Wer es wagt, diese Instrumente der privaten Selbstverwirklichung des freien Individuums in ihrem Wirkungsradius zu begrenzen, muss mit der gleichen Gegenwehr rechnen wie ein Einbrecher, der vom Hausbesitzer auf frischer Tat ertappt wird.
Dieses Muster gibt das Auswahlprinzip vor, nach dem das Grundgesetz in diesen Videos verteidigt werden soll: Es geht um Artikel 5, um die Meinungsfreiheit – bedroht durch Internet- und Hate-Speech-Regulierung. Um die Freiheit von Forschung und Lehre – bedroht durch Political Correctness. Es geht um Artikel 20, um das Volk, von dem alle Staatsgewalt ausgeht, und die »Windparks oder Bergbauvorhaben«, die gegen den Willen des Volkes beschlossen würden. Es geht um Artikel 4, die Religionsfreiheit (Christentum!), Artikel 6, den besonderen Schutz für Ehe und Familie (»hat nur Sinn, wenn damit Ehe von Mann und Frau gemeint ist«), Artikel 7 zum Schulwesen (Privatschulen!). Einer nimmt Artikel 16a, das Recht auf politisches Asyl und dessen Schranken (»Na? Fällt Ihnen was auf?«), zum Anlass, die Sorge um das Grundgesetz zu einer Frage der ethnischen Abstammung zu erklären. Ein anderer findet über die in Artikel 140 gebündelten Verweise auf die Weimarer Reichsverfassung den Satz, dass die bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten durch die Ausübung der Religionsfreiheit weder bedingt noch beschränkt werden – und trotzdem gelte in Deutschland »die Scharia« und gebe es »Parallelgesellschaften«!
Einige nehmen direkt sich selbst bzw. ihre Partei als Gradmesser dafür, wie übel es um die Grundrechte in Deutschland bestellt ist. Ein Landtagsabgeordneter, im Zivilberuf Polizeibeamter, weist auf Artikel 33 hin, das Beamtengrundrecht, das allen Deutschen den gleichen Zugang zum öffentlichen Dienst gewährt, »auch wenn man die Meinung der Regierung nicht teilt«, die dann aber gegen Beamte, die von diesem Recht Gebrauch machen, den Verfassungsschutz »politisch instrumentalisiert«. Ein anderer nennt Artikel 21, wonach die Parteien an der politischen Willensbildung des Volkes mitwirken, und beschuldigt die »Antifa«, mit »schweren Straftaten« die Geltung dieser Norm für die AfD »de facto auszuhebeln«.
Sogar der unantastbaren Würde des Menschen, des ersten und höchsten Werts des Grundgesetzes, können sich AfD-Politiker:innen angeblich nicht länger sicher sein in Deutschland: »Schon früh, als Opfer rassistisch motivierter Übergriffe wurde mir diese Würde wegen meinem schwarzen Haar und meiner Hautfarbe selten zugestanden. Heute spricht man mir die Würde aufgrund meines politischen Engagements in der AfD ab.« Andere geben sich regelrechten Gewaltfantasien hin, mit sich selbst in der Rolle des Opfers: »Ich möchte die Freiheit haben, zu machen und zu sagen, was ich für richtig halte, ohne dafür jederzeit abgeholt, gefoltert oder eingesperrt werden zu können.« Die Freiheit, klagt ein anderer, werde »unter dem Deckmantel der Moral … schleichend abgeschafft. Wer auch nur zum persönlichen Ziel erklärt, reich und wohlhabend werden zu wollen, muss, wenn es nach den Linken geht, damit rechnen, erschossen zu werden oder im Gulag aufzuwachen.«
Das Bild, das die AfD in diesen Videos von sich selbst zeichnet, zeigt eine Partei von angeblich glühenden Grundgesetz-Fans, die Verfolgungen ausgesetzt ist, weil sie die Prinzipien der Verfassung ernst nimmt und verteidigt. Dieses Bild soll nicht nur ihrer Verortung jenseits der Grenze, die den »Boden des Grundgesetzes« umschließt, widersprechen. Mehr noch, sie will den Spieß umdrehen. Wer sie außerhalb der Grenze der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verortet, steht selbst außerhalb dieser Grenze: Wer ihr den Platz auf dem Boden des Grundgesetzes bestreitet, so der Refrain dieser Videokampagne, vergeht sich an Meinungsfreiheit, Demokratie und Rechtsstaatsprinzip, ja sogar an der Menschenwürde.
Obendrein zeigt dieses Bild aber ein ganz und gar instrumentelles Verhältnis zur Verfassung: Das Grundgesetz wird benutzt, um es als Zeugen dafür aufzurufen, dass mit einem System, das einem das als Besitz empfundene eigene Recht schmälert, etwas nicht stimmt. Wer recht hat, ist in diesem Bild nicht länger eine Frage, die durch die Anwendung von Rechtsnormen auf einen bestimmten Sachverhalt beantwortet wird. Wer recht hat, ist Prämisse, nicht Schlussfolgerung. Das ist gesetzt. Und wenn das Recht zu einem anderen Schluss kommt als der Bestätigung dieser Setzung, dann umso schlimmer für das Recht. Dann stimmt mit ihm etwas nicht. Dann ist es verfassungswidrig. Die Anwesenheit von Geflüchteten in Deutschland: »Herrschaft des Unrechts!« Die Impfpflicht in der Pandemie: ein Angriff auf die körperliche Unversehrtheit. Die Übernahme von Verantwortung für Desinformation und Hassrede durch Plattformbetreiber: ein Anschlag auf die Meinungsfreiheit. Die Regulierung klimaschädlicher Heizungssysteme: ein Attentat gegen die Freiheit des Eigentums. Soweit und solange das Grundgesetz diesen Befund stützt oder zu stützen scheint, bleibt das Verhältnis zu ihm mühelos affirmativ. Es wird so zwar zum bloßen Stichwortlieferanten der eigenen Selbstermächtigung, kann aber einer solchen Vereinnahmung keinen Widerstand mehr entgegensetzen.
Im Namen des »Volkes«
Jede:r hat eine Vorstellung davon, wie autoritäre Herrschaft aussieht: überall Spitzel, überall Polizei, überall Angst. Wer die Regierung kritisiert, muss damit rechnen, im Morgengrauen verhaftet zu werden. Die Regierung steht auf wackeligem Grund und muss sich deshalb ständig mit Gewalt stabilisieren. Sie kann keine überzeugenden Gründe für ihre Herrschaft nennen, höchstens irgendwelchen lügenhaften Kitsch, der allenfalls zur Überwältigung taugt, aber nicht zur Überzeugung, und deshalb stets mit der Drohung mit Gewalt hinterlegt bleiben muss, um seine Wirkung zu tun. Auf die Frage, mit welchem Recht sie von mir verlangt, mich ihren Entscheidungen zu fügen, hat sie am Ende nichts zu sagen als: weil sie es kann.
Es ist noch gar nicht lange her, da erschien solche autoritäre Herrschaft als ein Relikt des 20. Jahrhunderts und eine nach und nach aussterbende Spezies. Die »dritte Welle« der Demokratisierung hatte ab 1975 die faschistischen Regime in West- und Südeuropa, die Militärdiktaturen in Lateinamerika, die Apartheid in Südafrika und die meisten kommunistischen Diktaturen in Asien und Osteuropa fortgespült, und mit dem »Arabischen Frühling« 2011 schien auch das Ende der autokratischen Regime im Nahen Osten und in Nordafrika nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Doch es kam bekanntlich anders. Seit der Mitte des letzten Jahrzehnts verbreitete sich in der Politikwissenschaft eine beunruhigende Beobachtung: Nicht nur schien die dritte Welle zu brechen. Da baute sich eine Gegenwelle auf, der Autoritarismus gewann Terrain zurück. Aber nicht mit den alten Methoden, nicht durch Militärputsch, Staatsstreich und gefälschte Wahlen. Er bemächtigte sich der Institutionen der Demokratie von innen heraus, machte sie sich zu eigen, durchdrang und besetzte sie allmählich, um sie schließlich gegen sich selbst zu richten, und zwar nicht nur in Regionen, die man sich angewöhnt hatte als »instabil« und in puncto demokratischer Kultur sozusagen zurückgeblieben zu betrachten, sondern auch und gerade in den Mutterländern der Demokratie schlechthin.
Das Mittel dazu war und ist der Populismus: der strategische Einsatz einer bestimmten, mehr oder weniger beim Wort zu nehmenden »Politikvorstellung«, so die klassisch gewordene Definition von Jan-Werner Müller, »laut derer einem moralisch reinen, homogenen Volk stets unmoralische, korrupte und parasitäre Eliten gegenüberstehen – wobei diese Art von Eliten eigentlich gar nicht wirklich zum Volk gehört«. In einer liberalen rechtsstaatlichen Demokratie ist es zwar das »Volk«, das die Machtfrage zu beantworten hat: Von ihm geht nach Artikel 20 Abs. 2 Grundgesetz »alle Staatsgewalt aus«. Aber wie das geschieht und was unter diesem »Volk« zu verstehen ist, ist notwendig eine Rechtsfrage. Für den autoritären Populismus ist es hingegen nicht das in demokratischen Verfahren in Kraft gesetzte und durch unabhängige Gerichte gesprochene Recht, das die Frage, wer das Volk ist und in welchen Verfahren es seinen Willen bildet und äußert, beantwortet und gleichzeitig offenhält. Sondern die Antwort ist bereits gegeben. Die Volksidentität ist allem Recht und allen demokratischen und justiziellen Verfahren vorgängig. Sie ist einfach da, sichtbar für alle, die sie sehen können, jedenfalls aber für die autoritären Populisten selbst, die darauf ihre Abgrenzung von den »abgehobenen«, »kosmopolitischen« Eliten stützen: Jeder normale Mensch sieht doch, was das ist, das Volk, sieht es als natürliches, kulturelles und historisches Faktum mit sich selbst identisch dastehen als Spiegelbild seiner selbst, und wer das nicht sieht, mit dem stimmt eben etwas nicht.
Was dieses »Volk« will, ist ebenfalls bereits da. Rechtlich normierte Verfahren wie Wahlen und Abstimmungen sind nicht erforderlich, diesen kollektiven Willen hervorzubringen, sondern nur dazu da, ihn zu affirmieren. Das mit sich selbst identische »Volk« weiß auch ohne sie, was es will. Man muss es nur fragen. Plebiszite und Volksbefragungen sind die Mittel der autoritär-populistischen Wahl dazu, zumal dann, wenn der autoritär-populistische Machthaber selbst die Frage formuliert und so bereits weitgehend steuern kann, wie die Antwort ausfällt. Wenn die rechtsstaatlichen und demokratischen Verfahren diesen als vorgegeben gesetzten Volkswillen bestätigen, dann umso besser. Wenn nicht, dann stimmt mit ihnen etwas nicht.
Die Verfassung kann dieses behauptete »Volk« und seinen behaupteten »Willen« affirmieren – dann affirmiert auch der autoritäre Populismus die Verfassung. Sie ist insoweit für ihn nützlich, als sie ihm eine Deckung bietet, hinter der er den Mangel an Begründung für seine Setzungen verstecken kann. Solange ihn die Verfassung deckt, lässt sich sein Autoritarismus viel schwerer nachweisen. Er braucht sich nicht mehr zu exponieren, braucht keinen Militärputsch und keine Gewalt mehr, weil und soweit die Verfassung ihm liefert, was er selbst nur behaupten, aber nicht begründen kann: die Rechtfertigung für seinen Herrschaftsanspruch. Sie liefert ihm obendrein Grund- und Minderheitsrechte, die er strategisch einsetzen kann, solange er selbst noch nicht herrscht – zum Protest, zur Obstruktion, zur Delegitimierung derer, die an seiner Stelle herrschen. Sie liefert ihm Möglichkeiten, Debatten zum Entgleisen zu bringen und Entscheidungen zu blockieren. Er kann die demokratischen Prozesse zum Stillstand bringen und damit seine Erzählung unterfüttern, dass die »Eliten«, die an seiner Stelle herrschen, illegitime und korrupte Versager sind und das System, das ihn nicht herrschen lässt, kaputt und reparaturbedürftig ist.
Diese Deckung ist aber notwendig lückenhaft und unzureichend. So viele Rechte ihm die Verfassung gibt, so viele verweigert sie ihm auch. Auch wenn er schließlich auf demokratischem Weg rechtmäßig an die Macht gelangt, stößt er immer noch überall an Grenzen und Schranken, die die Verfassung und die durch sie begründeten Institutionen seiner Macht setzen. Soweit ihm die Verfassung und ihre Institutionen in die Quere kommen, ihn hindern und kontrollieren, werden sie für den autoritären Populismus zur Herausforderung: Da muss man etwas machen. Das Spiegelbild des mit sich selbst identischen »Volkes« muss mit dem Bild, das die Verfassung zeichnet, zur Deckung gebracht werden. Rast- und ruhelos wird an der Verfassung herumgebogen und herumgebosselt, bis die Deckung vollkommen ist und sie der eigenen Identifikation mit dem »Volk« keinen Widerstand mehr entgegensetzt. Die Institutionen werden unterworfen, umgebaut und mit loyalen Gefolgsleuten besetzt, die dann politische Gegner und Minderheiten und andere nicht zum wahren »Volk« Dazugehörige drangsalieren, auf dass sie die Identifikation mit dem Volks-Spiegelbild nicht länger stören. Die Verfahren werden darauf optimiert, dass sich das vermeintlich mit sich selbst identische »Volk« in ihnen stets zuverlässig widerspiegelt – insbesondere die demokratischen Wahlen. Solange diese Verfahren noch gegen ihn ausgehen können, ist der autoritäre Populismus nicht am Ziel. Das ist er erst, wenn er die Verfassung in ein lücken- und fugenloses Spiegelkabinett umgebaut hat, in dem er, wohin er auch blickt, immer nur sich selbst erblickt.
So rückt die Volksidentität in den Rang einer Art Metaverfassung hinter der Verfassung, die gegen die Verfassung und ihre Institutionen in Stellung gebracht werden kann, ohne dabei je deren Deckung verlassen zu müssen. Das Parlament ist nicht länger der Ort, an dem sich das repräsentierte Volk als freie und gleiche Verschiedene begegnen und seine Gegensätze produktiv auf Dauer stellen kann, sondern ein Ort, an dem das »Volk« sich und seine Identität gegen das Andere, Fremde, Feindliche und alle, die es repräsentieren, verteidigt. Wahlen sind nicht länger Verfahren, die wechselnde Mehr- und Minderheiten hervorbringen und die Demokratie vom Konsens- und Kompromisszwang entlasten und die Möglichkeit offenhalten, sich überstimmen zu lassen und so mit den für alle verbindlichen kollektiven Entscheidungen nicht einverstanden und trotzdem Bürger:innen bleiben zu können, sondern sie sind Ausdruck der Volksidentität, indem das »Volk« mit seinen Repräsentanten eins wird. Menschenrechte sind nicht länger die Bedingung der Möglichkeit, als Minderheit oder Individuum das Wagnis des Überstimmtwerdens einzugehen, sondern die Ermächtigung derer, die dem wahren »Volk« angehören, ihre Freiheitsspielräume bis zur Neige auszuschöpfen, im Gegensatz zu der Anmaßung der Anderen, Fremden, Feindlichen, dem »Volk« Fesseln anlegen und es hindern zu wollen, ganz bei sich zu sein.
Der autoritäre Populismus ist ein globales Phänomen. Auf sämtlichen Kontinenten breitet er sich aus. Die meisten Demokratien sind in der einen oder anderen Form von ihm befallen. In manchen Ländern – z. B. Ungarn, Indien, Italien, Venezuela, Türkei – ist er an der Regierung. In anderen – z. B. Polen, USA, Brasilien – war er an der Regierung, ist aber, jedenfalls vorläufig, wieder abgewählt worden. In wieder anderen – z. B. Frankreich, Spanien, Niederlande, Österreich – schien oder scheint seine Machtbeteiligung oder gar -übernahme zum Greifen nahe. Seine Gestalt ist im Detail so unterschiedlich wie die jeweiligen Verfassungsordnungen, von denen er sich nährt, aber doch gekennzeichnet von einer gemeinsamen Strategie: die Institutionen der liberalen Verfassung zur Plausibilisierung seiner populistischen Erzählung und zu seiner Immunisierung gegenüber öffentlicher Kritik, rechtsstaatlicher Kontrolle und demokratischem Wettbewerb, kurz: zur Errichtung eines autoritären Regimes zu missbrauchen.
Von autoritär-populistischen Regierungsmehrheiten ist Deutschland bisher auf Landes- oder Bundesebene noch verschont geblieben. Nicht aber von der autoritär-populistischen Strategie selbst. Die entfaltet einstweilen ihre destruktive Wirkung aus der Opposition heraus, und zwar auf eine sich immer weiter selbst verstärkende Weise: Mit wachsenden Stimmenanteilen bekommt sie immer mehr Beteiligungs- und Verfahrensrechte in die Hand und damit immer mächtigere Möglichkeiten, ihrer Erzählung von der Korruptheit des »Systems« und der »Eliten«, die es beherrschen, Plausibilität zu verleihen und so ihren eigenen Herrschaftsanspruch zu untermauern. Wo sie Einfluss auf Gesetzgebung und Gesetzesvollzug erlangt, multiplizieren sich diese Möglichkeiten: Jetzt hat sie die Verfassung im Rücken beim Sprechen für das »Volk«. Je größer der Wahlerfolg der autoritären Populisten, desto mehr wächst auch bei ihrer demokratischen Konkurrenz die Versuchung, sich ihnen immer mehr anzuverwandeln. So wird die autoritär-populistische Ermächtigung zur self-fulfilling prophecy.
Dieser Strategie kann man nicht entkommen. Aber man kann ihr entgegentreten. Man kann sie erkennen und benennen und sich auf ihre nächsten Schritte vorbereiten. Man muss nicht in jede ihrer Fallen hineintappen und nicht jedes ihrer Spiele mitspielen. Man kann ihre Schritte und Taktiken antizipieren. Man kann in Szenarien durchspielen, wie genau eine solche Strategie im deutschen Verfassungskontext umgesetzt werden könnte, welche Institution sich in diesem Fall als wie resilient oder anfällig erweist und wer welchen Beitrag dazu leisten kann, dass sie ans Ziel gelangt – oder eben auch nicht. Bereits das hat einen Resilienzeffekt: Wer die Strategie der autoritären Populisten erkennt, wird weniger leicht auf ihre Taktiken hereinfallen und weniger wahrscheinlich die graduelle, für sich genommen erst einmal oft wenig aufsehenerregende Übernahme der Institutionen als bloße Technizität missverstehen, um die sich die Juristerei kümmern soll, die aber mit dem eigenen Leben nicht viel zu tun hat. Wer den Möglichkeitsraum, als den die autoritären Populisten die demokratische Verfassung betrachten, überblickt, wird sich rechtzeitig zu Protest und Widerstand wappnen können, bevor aus Möglichkeiten Wirklichkeiten geworden sind und es für Gegenwehr zu spät ist.
Resilienz durch Antizipation: Das ist der Zweck des Thüringen-Projekts, das wir im Sommer 2023 gestartet haben. Am Beispiel des Freistaats Thüringen haben wir in mehr als 100 vertraulichen Gesprächen mit Politiker:innen, Beamt:innen, Richter:innen, Wissenschaftler:innen und Vertreter:innen der Zivilgesellschaft durchgespielt, was in verschiedenen Bereichen passieren könnte, wenn bestimmte Beteiligungsrechte und Entscheidungskompetenzen in autoritär-populistische Hände fallen. Wir haben mit Personen gesprochen, die von solchen Szenarien betroffen wären und auf deren Reaktionsfähigkeit es im Zweifel ankäme, wenn sie sich realisieren. Wir haben von ihnen erfahren, wie sie die Chancen und Risiken solcher Szenarien einschätzen, wie sie reagieren würden, wo sie die größten Probleme sehen und was ihnen an Handlungsmöglichkeiten einfällt. Sie sind vorbereitet. Natürlich nicht auf alles. Aber doch auf vieles.
Thüringen ist neben Sachsen und Brandenburg eins von drei Bundesländern, die am 1. September 2024 einen neuen Landtag wählen. In Thüringen hat es die AfD 2020 schon einmal geschafft, durch trickreichen Umgang mit den Verfahrensregeln der Demokratie den Ministerpräsidenten mitzubestimmen, wenngleich nur für ein paar Tage. Vier Jahre später könnte sie stärkste Fraktion werden, ein Drittel oder mehr der Landtagsmandate erringen, womöglich sogar Einfluss auf Regierung und Gesetzgebung erlangen. Die Frage, was dann unter diesen verschiedenen Rahmenbedingungen alles passieren könnte, ist nicht nur Spekulation. Sie zu stellen und zu beantworten ist die Voraussetzung dafür, überhaupt erkennen zu können, was gespielt wird. Je früher und gründlicher das geschieht, desto besser stehen die Chancen, sich wappnen zu können. Das gilt nicht nur für die Entscheidungs- und Funktionsträger:innen vor Ort in Thüringen, nicht nur für die Rechtswissenschaft, nicht nur für die Politik. Sondern für die deutsche Gesellschaft insgesamt.
Wir haben uns intensiv damit beschäftigt, was die Verfassung und ihre Interpreten leisten können, um Verfassungsmissbrauch zu verhindern und autoritäre Populisten zu stoppen. Wir haben Werkzeuge und Mechanismen identifiziert, die die Resilienz des Rechtsstaats und der Demokratie stärken können. Aber am Ende sind alle verfassungsrechtlichen Mechanismen, Werkzeuge und Institutionen nur so gut wie das, was die Gesellschaft aus und mit ihnen macht. Die Verfassung ist ein Text. Ein herausragend wichtiger und inspirierender Text. Aber Demokratie und Freiheit zu retten vermag weder ein Text noch das blinde Vertrauen auf einen solchen. Die liberale Demokratie zu bewahren, zu verbessern und zu beschützen ist die Aufgabe aller, als Zivilgesellschaft: beim Frühstück, im Büro, im Supermarkt, auf der Demo, beim Familienessen. Das Recht und seine Institutionen werden uns nicht retten. Das müssen wir schon selbst tun. In vielen kleinen Beiträgen. Deshalb dieses Buch.
Entschlossen haben wir uns zu diesem Projekt vor allem auf der Folie der verfassungspolitischen Erfahrungen zweier europäischer Nachbarländer, mit denen wir uns auf dem Verfassungsblog über viele Jahre intensiv beschäftigt haben. In Ungarn und in Polen wurde die autoritär-populistische Strategie mit besonders zerstörerischer Konsequenz vorangetrieben. Beide Fälle unterscheiden sich in vielfacher Hinsicht, nicht zuletzt im Ergebnis: In Ungarn erscheint es auf absehbare Zeit nicht mehr vorstellbar, dass das autoritär-populistische Regime mit demokratischen Mitteln wieder abgewählt werden kann. In Polen ist genau das gelungen – aber ob und inwieweit sich die in der autoritär-populistischen Regierungszeit zertrümmerten Institutionen wieder reparieren lassen, ist noch offen. Gemeinsam ist aber beiden Fällen, dass man an ihnen studieren kann, wie die autoritär-populistische Strategie aussieht und welcher Taktiken sie sich bedient. Vor allem Ungarn dient seit langer Zeit der ganzen autoritär-populistischen Bewegung in Europa als Inspiration und Vorbild – auch und nicht zuletzt der Thüringer AfD und ihrem Vorsitzenden Björn Höcke. Deshalb wollen wir uns zunächst diesem Fall zuwenden.