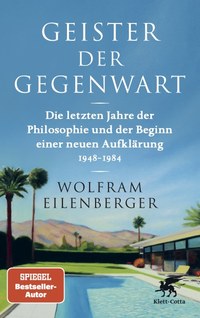I. AUFKLÄRUNGEN 1948–1950
FRANKFURT AM MAIN – »DEUTSCHLAND«
Worauf durfte er hoffen? Mit der bangen Gewissheit, lediglich »Objekt von Konstellationen, nicht eigentlich meiner selbst mächtig zu sein«, besteigt Theodor W. Adorno am 11.Oktober 1949 den »Chief« von Los Angeles nach New York. Zur Verabschiedung an den Bahnsteig gekommen ist neben seiner Gattin (»unendliche Verbundenheit mit Gretel bis in den Tod«) auch eine kleine Gesandtschaft jener Künstler- und Literatenkolonie, die sich mit den Jahren des Exils auf den Namen »Deutsch-Kalifornien« getauft hat. Sowie, natürlich, Adornos bevorzugter Denkgenosse und Vorgesetzter Max Horkheimer, seit knapp zwei Jahrzehnten Direktor des aus Stiftungsmitteln finanzierten Instituts für Sozialforschung.
Am Gleis steckt Horkheimer dem Freund noch einen Essayband aus der Feder Jean-Paul Sartres zu. Bis zum Zugwechsel in Chicago vermögen die Gedanken des neuen Stars am französischen Intellektuellenhimmel indes nur bedingt zu überzeugen: »Auffällig der Widerspruch zwischen den oft schlagenden konkreten Einsichten ... und den armselig leeren Kategorien wie ›sich selbst wählen‹ usw., aus denen jene angeblich hervorgesponnen sind.«
Sartres Ambitionen als Literat wie Philosoph, Adorno begreift es wohl, sind auch die eigenen. In Wahrheit sind es die einer ganzen Generation von Davongekommenen: Wie Befreiung nach der Befreiung denken? Wie den Ausgang in ein mündiges Leben aufzeigen? Wie, nach den Erfahrungen dieses Krieges, überhaupt noch von Selbstbestimmung sprechen? Tagebuchnotiz: »Ein Haupteinsatzpunkt der kommenden Arbeit.«
Zunächst aber gilt es, auf dem Weg zurück nach Frankfurt auch in New York vorläufig Abschied zu nehmen. Insbesondere von der verwitweten Mutter, deren erster Anblick Adorno schaudern lässt: »Vom Alter wie zerstört, das Gesicht, anstatt klar, wie in Stücke zerrissen.« Gar ist ihm, als »wäre sie nicht identisch, sondern etwa ein altes Weib, das sie selber vor 20 Jahren im Spaß imitierte«. Auch die Tatsache, dass ihre amerikanische Pflegekraft sie wie »ein Tier tätschelt« und dabei »a good girl« nennt, trägt nicht zur Beruhigung bei: »Verdacht daß sie ihr nicht genug zu essen gibt.« Elementare Mangelerfahrungen, die Einzelkind Adorno selbst in den dunkelsten Kriegsjahren nie gekannt hatte. Auch zukünftig gedachte er nicht, sie in den eigenen Lebensvollzug eindringen zu lassen.
AGENDA
Neben freundschaftlichen Treffen wie mit dem Filmtheoretiker und Schriftsteller Siegfried Kracauer, in den 20er Jahren Leiter des Feuilletons der Frankfurter Zeitung (»Er ist geistig wieder besser beieinander, auch nicht mehr so sinnlos eitel, da erfolgreicher.«), sind die Tage von Terminen mit den in New York verbliebenen Kollegen des Instituts dominiert. Es geht um die Klärung administrativer Fragen sowie Projekte mit Universitäten, Ministerien oder auch des Pentagons, die das aufgrund fehlgegangener Börsenspekulationen klamm gestellte Institut ständig anwerben muss. So war Adorno nahezu den gesamten Sommer mit der Überarbeitung einer Studie über die »Autoritäre Persönlichkeit« (»Studies in the Authoritarian Personality«) befasst. Ermittelt werden sollte, wie es um die etwaige Faschismusanfälligkeit in der gegenwärtigen amerikanischen Gesellschaft bestellt war. War das Aufkommen einer rechten Diktatur auch hier eine ernstzunehmende Möglichkeit?
Der Kniff der Umfrage bestand darin, Haltungen anhand von Aussagen abzufragen, die nicht direkt politischer Natur waren. Wie zum Beispiel: »Mögen viele Menschen auch spotten, es kann sich immer noch zeigen, dass die Astrologie vieles zu erklären vermag.« Oder: »Amerika entfernt sich so weit vom American Way of Life, dass es vielleicht nur noch mit Zwang wiederherzustellen ist.« Je nachdem, wie stark die Testpersonen diese Aussagen unterstützten oder ablehnten, ließ sich auf einer sogenannten F-Skala (F für Faschismus) deren Grad an rechtsradikaler Neigung ermitteln.
Bei allem Raffinement für Adorno reine Lohnarbeit, in Angang wie Umsetzung weit entfernt von seinen Kerninteressen als Philosoph und Gesellschaftstheoretiker. Was er seine Kollegen vom Institut auch bei jeder denkbaren Gelegenheit spüren ließ. Anstatt auf Normalverteilungen und Skalen zu bauen, ist er der Überzeugung, das Mark des Ganzen offenbare sich am klarsten in alltäglich Übersehenem. Im Ausformulieren setzt er lieber auf prägnante Denkbilder als gestanzten Studiensprech; im Freilegen gesellschaftlicher Befindlichkeit auf irreduzible Einzelerfahrungen anstatt Multiple-Choice.
Ein Forscherethos, den es bei aller busyness vorläufig letzter Tage auch im eigenen Verhalten einzuholen gilt. So am 16.Oktober in Form eines Treffens mit Carol (gemäß Tagebuch eine Bekanntschaft früher New Yorker Tage):
Wir aßen im Rumpelmeier, ich setzte ihr das Programm auseinander, das wir streng innehielten; Genießen der Vorlust. Nach Reservation reizend im 5th Avenue. Nachmittag der äußersten Exzesse, in völliger Helle und Klarheit. Echte Masochistin: zweimal ihr Orgasmus nur beim freilich erbarmungslosen Schlagen ... Ihre Kunst des Hintanhaltens, der Küsse ins Leere, <tantalizing>. Das Kunststück beim Lieben von Hinten einen ganz einzuschließen.
Adornos Analyse nach erfolgter »Reprise am Morgen«:
Große Integrität und Opferbereitschaft. Die akademische Sphäre war ihre Rettung aus einem ganz verlumpten Milieu. An Politik lernte sie, die mehrere Selbstmordversuche gemacht hatte, von sich selbst loszukommen, ans Objektive zu denken ... (sie ist glücklich verheiratet).
Fast ein Existenzideal.
ENGEL
Mehr als ein Jahrzehnt trennt Adorno von seinem letzten Aufenthalt in Europa. »Ohne die leiseste Seekrankheit«, dafür in einem »nie gekannten Zustand« zwischen »Herzklopfen – und Herzschmerzen«, verlebt er auf der Queen Elizabeth die fünftägige Überfahrt nach Cherbourg. Erst in Paris entlädt sich die Spannung des Revenant: »Auf der Place de la Concorde geheult. Am Bahnhof der Riss: kein Benjamin da.«
Wer anders als Walter Benjamin hatte ihn in frühen Frankfurter Tagen gelehrt, die eigene Gegenwart als ein Tableau verwirkter Hoffnungen zu entschlüsseln? Jedes noch so unbedeutend scheinende Novum modernen Großstadtlebens als Index dräuender Barbarei zu deuten? Bis in die letzten Tage hatte Adorno seinen geistigen Erzieher von New York aus gestützt, den in Paris zunehmend isolierten und von der Deportation bedrohten Benjamin immer wieder zur Flucht nach Übersee gedrängt. Doch als dieser nach langem Zaudern im Spätsommer des Jahres 1940 endlich von Marseille Richtung Pyrenäen aufbricht, um die spanische Grenze bei Portbou zu überqueren, wird ihm wegen einer behördlichen Nichtigkeit die Ausreise verweigert. Geistig wie körperlich entkräftet, beschließt er noch in derselben Nacht, seinem Leben mit einer Überdosis Morphium ein Ende zu setzen.
Bereits am kommenden Morgen sollte dem Rest seiner Flüchtlingsgruppe die Passage gewährt werden. Wie auch Hannah Arendt nur wenige Monate darauf über die exakt selbe Route die Flucht aus dem besetzten Frankreich über Spanien und Lissabon nach Amerika gelingt. Von den engeren Freunden ist sie die letzte, die Benjamin lebend sieht.
Vor seinem Aufbruch in Marseille hat er ihr ein Bündel Manuskripte übergeben, die Arendt, da es sich um eine Art geistiges Vermächtnis handelte, Adorno übergeben sollte. Dabei verbindet Arendt mit »Wiesengrund« (wie sie Adorno konsequent bei dessen zweiten, väterlichen Familiennamen nennt) bereits seit Ende der 20er Jahre herzlichste Abneigung. Wie auch ein Brief Arendts an Benjamins Jugendfreund, den Judaisten Gershom Scholem, von New York nach Jerusalem aus dem Jahre 1943 zum Ausdruck bringt:
Mit Wiesengrund zu verhandeln, ist schlimmer als sinnlos. Was die mit dem Nachlass angestellt haben oder anzustellen gedenken, weiß ich nicht. Ich habe mit Horkheimer, der im Sommer hier war, gesprochen: ohne jedes Resultat. Behauptet, die Kiste sei in einem Safe (dies ist wohl sicher gelogen) und er sei noch gar nicht herangegangen ... Hinzu kommt, dass das Institut selbst auf dem Aussterbeetat ist. Sie haben immer noch Geld, aber sie sind mehr und mehr der Meinung, dass sie sich damit einen ruhigen Lebensabend sichern müssen. Die Zeitschrift kommt nicht mehr heraus, ihr Ruf hier ist nicht gerade erstklassig, sofern man überhaupt weiß, daß sie existieren. Wiesengrund und Horkheimer leben in Californien in großem Stil. Das Institut ist hier rein administrativ. Was administriert wird, außer Geldern, weiß kein Mensch.
Keine wohlwollende, sachlich indes zutreffende Beschreibung damaliger Zustände. Der straffe Eigensinn, andere sprachen von Selbstherrlichkeit, mit dem das Duo Horkheimer-Adorno die »Forschungen« von der Westküste aus bestimmt, hat mit den Jahren selbst Stammkräfte aus alten Frankfurter und auch Freiburger Bezugskreisen dazu gebracht, sich mehr und mehr vom Institut für Sozialforschung zu distanzieren. Allen voran den Psychoanalytiker Erich Fromm sowie den Philosophen Herbert Marcuse. Beide gehen in den USA mittlerweile eigene Wege.
Die Leseprobe in voller Länge finden Sie beim Verlag.