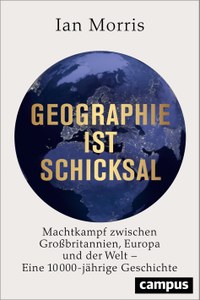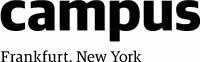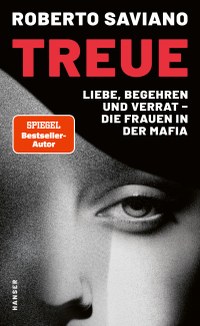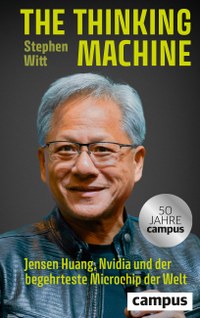Als ich ein Kind war, erzählte mir mein Großvater wieder und wieder, dass es in seiner Kindheit im Wetterbericht regelmäßig hieß: »Nebel im Kanal – Kontinent abgeschnitten« (Abbildung 0.1). Wie bei so vielen Witzen lag der Humor in der Mehrdeutigkeit. Wollte mein Großvater sagen, dass das Land vor die Hunde gegangen war? Oder dass die Engländer eine geradezu komische Gewissheit ihrer eigenen Bedeutung hegten? Oder beides? Oder keins von beiden? Er erklärte es mir nie. Aber mehr als 40 Jahre, nachdem er ihn mir zum letzten Mal erzählte, wirkt der Witz sehr aktuell. Am 23. Juni 2016 entschied sich die Mehrheit der Briten für den Austritt aus der Europäischen Union. Bevor die Woche vorüber war, war der Premierminister gestürzt (er war der dritte von vier konservativen Regierungschefs, die über Europa stolperten), die Abgeordneten der Labour Party hatten ihrem eigenen Parteichef das Vertrauen entzogen, und 2 Billionen Dollar des globalen Vermögens hatten sich in Luft aufgelöst. Das war nicht lustig.
Am Tag nach dem Referendum entschloss ich mich, ein Buch über die Geschehnisse zu schreiben. Ich wusste, dass hunderte andere Autoren einen ähnlichen Entschluss fassen würden oder bereits gefasst hatten, und tatsächlich erschienen nur wenige Wochen später die ersten Bücher über den Brexit. Ich gelangte trotzdem zu der Überzeugung, dass es sich lohnen würde, meines zu schreiben, weil ich vermutete, dass es sich deutlich von allen anderen unterscheiden würde. Die meisten einschlägigen Darstellungen konzentrieren sich auf die sieben Jahre zwischen David Camerons Erklärung im Jahr 2013, er befürworte eine Abstimmung, und Großbritanniens Austritt im Jahr 2020. Einige gehen bis zum Jahr 1973 zurück, in dem das Land der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) beitrat. Sehr wenige suchen die Ursprünge Ende der vierziger Jahre, als die ersten Pläne für eine europäische Föderation auftauchten, und eine Handvoll beginnt mit der Reformation oder der Bedrohung durch die spanische Armada im 16. Jahrhundert. Ich bin überzeugt, dass keine dieser Analysen weit genug zurückreicht. Nur wenn wir uns die gesamten 10 000 Jahre ansehen, die vergangen sind, seit der Meeresspiegel nach der Eiszeit stieg und die britischen Inseln vom europäischen Kontinent trennte, können wir die übergeordneten Muster verstehen, welche die britische Geschichte geprägt haben und weiterhin prägen.
Ich will damit nicht sagen, dass wir in den Steinen von Stonehenge außenpolitische Empfehlungen oder ewige Wahrheiten über das englische Wesen finden werden. Die Archäologen lachen mit Recht über Leute, die derart Dummes sagen. Aber wenn wir die Kräfte herausarbeiten wollen, die Großbritanniens Beziehungen zu Europa und der Welt prägen, müssen wir einen Zeitraum von mehreren Jahrtausenden betrachten. Erst wenn wir die Fakten in diesen Rahmen einordnen, wird uns klar, warum der Brexit auf einige so reizvoll und auf andere so schockierend wirkte und was als nächstes auf Großbritannien zukommt.
Eine solche langfristige Betrachtung ist keineswegs neu. Im Jahr 1944 erklärte der Teilzeithistoriker Winston Churchill: »Je weiter man in die Vergangenheit blickt, desto weiter kann man in die Zukunft blicken.« Doch es vergingen Jahrzehnte, bis sich hauptberufliche Historiker seinen Rat zu Herzen nahmen. Erst seit Beginn des 21. Jahrhunderts haben sich die Historiker wirklich mit dem angefreundet, was wir heute als »Big History«, als »große (oder tiefe) Geschichte« bezeichnen, und studieren Trends, die sich über Jahrtausende erstrecken und sich auf den gesamten Planeten auswirken. Die meisten historischen Gesamtdarstellungen (darunter auch einige Bücher von mir) entfernen sich von den Einzelheiten der Geschehnisse in bestimmten Zeiten und an einzelnen Orten, um eine Geschichte in planetarischem Maßstab zu erzählen. Hingegen möchte ich in diesem Buch das Fernrohr umdrehen und ausgehend vom Globalen das Lokale heranzoomen. Schließlich wird die Geschichte von wirklichen Menschen gemacht, und die groben Pinselstriche sind die einzelnen Haarlinien, aus denen sie bestehen, nicht wert, wenn sie uns nicht helfen, das Leben zu verstehen, das wir tatsächlich führen. Daher möchte ich in diesem Buch die Methoden der Big History anwenden, um das Großbritannien nach dem Brexit in den Kontext der Beziehungen einzuordnen, welche die britischen Inseln nach der Eiszeit zu Europa und der Welt pflegten.
Noch heute, ein Dreivierteljahrhundert nach Churchill, studiert nur eine Minderheit der Geschichtsforscher die langfristigen Prozesse. Als beispielsweise der angesehene Historiker David Edgerton in seinem vorzüglichen Buch The Rise and Fall of the British Nation erklärte, der Brexit sei »ein neues Phänomen, dessen Ursachen im Hier und Jetzt« lägen und »nichts mit der tiefen Geschichte zu tun« hätten, löste er keine Kontroverse aus. Aber meiner Meinung nach hätte es so sein sollen. Auf den folgenden Seiten werde ich versuchen zu zeigen, dass der Brexit tatsächlich sehr viel mit der tiefen Geschichte zu tun hat, dass man ihn nur verstehen kann, wenn man ihn in einer langfristigen, weiten Perspektive betrachtet. Die Big History kann uns sogar zeigen, was der Brexit im kommenden Jahrhundert bedeuten könnte.