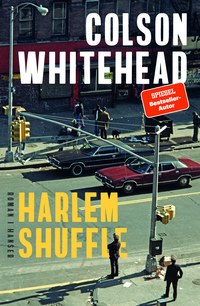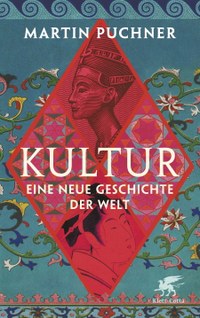Eigentlich waren ihm die Tische zur Straße hin lieber, aber im Chock Full o’Nuts war viel los. Vielleicht eine Tagung im ersten Stock. Carney hängte seinen Hut an die Garderobe und setzte sich an den Tresen. Sandra war mit ihrer Kanne auf Streife und goss ihm eine Tasse ein. »Was kann ich dir noch bringen, Baby?«, fragte sie. In jüngeren Jahren hatte sie in den Spitzenrevuen getanzt, im Club Baron und im Savoy, Solotänzerin im Apollo. So wie sie über das billige graue Linoleum glitt, würde man meinen, sie tanzte immer noch professionell. Das Showbusiness hatte sie jedenfalls nicht aufgegeben, denn als Kellnerin arbeitete man in einem Beruf, in dem man auch für die billigsten Plätze spielen musste.
»Bloß den Kaffee«, sagte er. »Wie war der Besuch deines Sohns?« Das Chock Full o’Nuts gehörte zu seinem Morgenprogramm, seit er das Geschäft eröffnet hatte. Sie sog an den Zähnen. »Gekommen ist er immerhin. Nicht, dass ich ihn zu Gesicht gekriegt hätte. Hat die ganze Zeit mit seinen Freunden zusammengesteckt.« Sie ließ die Kanne baumeln, ohne einen Tropfen zu verschütten. »Hat mir eine Nachricht hinterlassen.«
Die Hitzewelle hielt an, zum Leidwesen aller. Die heiße Luft aus der Küche machte es noch schlimmer. Von seinem Hocker aus hatte Carney einen Blick auf die Seventh Avenue, wo der Hoteleingang von abreisenden Gästen wimmelte. Pagen bliesen in Pfeifen, in gestaffelter Folge fuhren gelbe Taxis vor.
An den meisten Tagen würde Carney das Geschehen vor dem Hotel gar nicht beachten, doch die Begegnung mit Freddie machte ihm zu schaffen. Er war mit seinem Cousin zusammen gewesen, als er die Bürgersteig-Choreographie vor dem Hotel Theresa zum ersten Mal gesehen hatte, bei einem Ausflug mit ihm und Tante Millie. Carney musste damals zehn oder elf gewesen sein, wenn sie auf ihn aufpasste. Diese unstete Phase in seinem Leben. »Mal sehen, um wen da alle so viel Wirbel machen«, hatte Tante Millie gesagt. Sie hatte sie zu Eiscreme-Sodas ins Thomforde eingeladen, um irgendetwas zu feiern – was, wusste Carney nicht mehr –, und sie waren auf dem Nachhauseweg. Die Menschenmenge vor dem blauen Vordach des Hotel Theresa zog sie an. Junge Männer in Hotel-Uniformen hielten Gaffer im Zaum, und dann fuhr der große Bus vor. Sie gingen hinüber, um es sich anzusehen.
Der rote Teppich vor dem Waldorf von Harlem war Schauplatz täglicher, manchmal auch stündlicher Spektakel, ob es sich nun um den Anblick des Schwergewichtschampions handelte, der Anhängern zuwinkte, während er in einen Cadillac stieg, oder um eine fix und fertige Jazzsängerin, die um drei Uhr morgens mit den Teufelsversen im Mund aus einem Taxi purzelte. Das Theresa hob die Rassentrennung 1940 auf, nachdem die von Juden und Italienern beherrschte Gegend gekippt war und zur Domäne von Einwanderern aus der Karibik und Schwarzen aus dem Süden wurde. Jeder, der uptown kam, hatte irgendeine Art von stürmischem Ozean überquert.
Der Geschäftsführung blieb keine andere Wahl, als ihre Türen zu öffnen, und wohlhabenden Schwarzen blieb keine andere Wahl, als dort abzusteigen, wenn sie die Luxusbehandlung wollten. Sämtliche berühmten schwarzen Sportler und Filmstars übernachteten dort, die Spitzensänger und Geschäftsleute, sie aßen im Orchid Room im zweiten Stock zu Abend und gaben Soireen im Skyline Ballroom. Von den Fenstern der Skyline in der zwölften Etage aus konnte man in die eine Richtung die Lichter der George Washington Bridge, in die andere die der Triborough Bridge und im Süden das Wahrzeichen des Empire State Building sehen. Obenauf. Dinah Washington, Billy Eckstine und die Ink Spots wohnten in der obersten Etage. So jedenfalls die Überlieferung des Hotels.
Jener Nachmittag im Thomforde mit seiner Tante stand im Zeichen der Rückkehr von Cab Calloways Bigband. Eine Public-Relations-Firma – oder ein Portier, der von einer Boulevardzeitung bezahlt wurde – hatte Fotografen einen Tipp gegeben, um für angemessenen Rummel zu sorgen. Der Name des Bandleaders schwang sich in riesigen weißen Buchstaben über die Seite des Tourneebusses, leicht fleckig, wo Weißbacken in irgendeinem Kuhkaff ihn mit Eiern beworfen hatten, hätte schlimmer sein können. Die Schaulustigen kreischten, als die Musiker, in ihren taubenblauen Anzügen und übergroßen Sonnenbrillen lässig und elegant, auf den Bürgersteig traten. Freddie stellte sich dazu – Leute, die sich schick anzogen, beeindruckten ihn schon damals. Cab kam erst später am Abend. Er hielt sich in D. C. eine Lady, die ein Händchen für bodenständiges Frühstück und andere frühmorgendliche Freuden hatte, jedenfalls dem Vernehmen nach.
Die Bigband betrat die Lobby in Hepcat-Formation, hintereinander, als erschienen sie auf der Bühne, denn dieser Auftritt war ebenso sehr ein Gig wie jedes ihrer abendlichen Konzerte, eine Zurschaustellung von Glamour, eine Bekräftigung schwarzer Exzellenz. Wenn die Show vorbei war, zerstreute sich das Publikum, und auf dem Bürgersteig kehrte Ruhe ein, bis die nächste Berühmtheit landete. Tante Millie las gern laut Theresa-Artikel aus den Klatschspalten vor: Wie wir hören, sorgte ein bestimmter Casanova mit Samtstimme vergangene Woche im berühmten Hotel Theresa mit einer der kaffeebraunen Schönheiten des Savoy für ziemlichen Rabatz. Anscheinend wollte seine Frau ihn zum Geburtstag überraschen und blies dem kleinen Törtchen sämtliche Kerzen aus …
Carney wohnte nach dem Tod seiner Mutter ein paar Jahre lang bei seiner Tante und Freddie. Er war in der Küche, als seine Tante angesichts der Berichterstattung des Courier über die Ankunft der Calloway-Bigband begeistert aufkreischte, obwohl der Bericht selbst sie nicht überzeugte. »Ich glaube nicht, dass Hunderte von Menschen da waren, oder findet ihr?«
An dem Abend, an dem Carney den Mietvertrag für den Laden unterschrieb, veranstaltete das Filmstudio Twentieth Century-Fox seine Premierenparty für Carmen Jones im Hotel. Drei Blocks weiter auf der Seventh Avenue kippten und schwenkten die wuchtigen Scheinwerferstrahlen. Der Verkehr auf der 125th war ein hupendes Gedränge, mittendrin wütend fuchtelnde Cops. Das weiße Licht, das um die Ecke kam, war so hell, dass es einem vorkam, als hätte die Erde sich aufgetan, als wäre irgendein wundersamer Ausbruch im Gang. Um Carneys neue Vereinbarung mit Salerno Properties Inc. wurde weniger Trara gemacht. Sie schaffte es nicht in die Zeitungen, doch er zog es vor zu glauben, dass sie auf ihre Weise auch bedeutsam war. Als gälten alle diese hellen Lichter ihm.
Dieser Tage tat sich auf dem Bürgersteig selten etwas. Die Hotels downtown erkannten, dass es Gewinn brachte, sich schwarzen Gästen zu öffnen, und die Jahre der wüsten Zechgelage, des nächtlichen Glücksspiels und der Klatschspalten-Faxen waren dem Ruf des Hotels abträglich. An der Bar fand man sich inzwischen eher neben einem Zuhälter oder einer vom Gewerbe anstelle von Joe Louis oder einer Grande Dame der schwarzen Gesellschaft wieder. Das Café, in dem Adam Clayton Powell Jr. die Bedienungen charmiert hatte, wurde von Chock Full o’Nuts übernommen. Der Kaffee war besser und das Essen auch, sodass es in Carneys Augen kein großer Verlust war. Es war immer noch das Hotel Theresa, Mittelpunkt der schwarzen Welt, und seine dreizehn Etagen bargen mehr Möglichkeiten und mehr Majestät, als ihre Eltern und ihre Großeltern sich hatten träumen lassen.
Das Hotel Theresa auszurauben war so, als würde man gegen die Freiheitsstatue pinkeln. Als würde man Jackie Robinson am Vorabend der World Series einen präparierten Drink unterjubeln.
»Verdammt nochmal, Bill!«, sagte Sandra. In einem der Herde qualmte irgendetwas, und aus der Durchreiche trieb grauer, fettschwerer Rauch in den Essbereich. »Alles im Griff, Boss!«, sagte der Koch und wich ihrem Blick aus. Sandra wusste sich durchzusetzen, ob nun im Umgang mit dem Küchenpersonal oder mit den impulsiven Aufmerksamkeiten von Kunden. Im Apollo zu tanzen war schließlich ein Seminar über das männliche Tier gewesen. Angesichts des legendären Rufs, den das Hotel seinerzeit in puncto nächtlichem Amüsement genoss, spendierten Männer ihr wahrscheinlich in der Bar gegenüber der Eingangshalle Drinks, dort gingen alle hin. Und sie zündete sich ihre Zigaretten zu trostlosen Versprechen an. Damals in den Glanzzeiten – ihren und denen des Hotels.
Einmal fragte Carney sie, warum sie mit dem Tanzen aufgehört hatte. »Baby«, sagte sie, »wenn der liebe Gott dir sagt, du sollst es an den Nagel hängen, dann hörst du drauf.« Sie zog ihre Stöckelschuhe aus und band sich eine Schürze um, aber sie wurde die 125th Street nicht los – man konnte das Apollo vom Fenster aus sehen.
Am Morgen nach Freddies Ansage im Nightbirds fasste Carney Sandras Worte als Weisheit zum Thema »Kenne deine Grenzen« auf. Nämlich: Selbst wenn er krumm genug für den Vorschlag seines Cousins wäre, hätte er gar nicht die Kontakte, um eine Sore aus dem Hotel Theresa unterzubringen. Dreihundert Zimmer, wer weiß wie viele Gäste Wertsachen und Bargeld in den Schließfächern hinter der Rezeption verwahrten – er wüsste gar nicht, was er damit anfangen sollte. Genauso wenig wie Buxbaum, sein Abnehmer in der Canal Street. Bekäme wahrscheinlich einen Herzinfarkt, wenn Carney so einen Haufen Zeug anschleppte.
Sandra füllte Carneys Tasse nach, er merkte es gar nicht. Was krumme Dinger anging, war Carney eher ein kleines Licht, sowohl in der Praxis als auch in seinen Ambitionen. Gelegentlich mal ein Schmuckstück, die elektronischen Geräte, die Freddie und noch ein paar andere lokale Gestalten im Laden vorbeibrachten, das konnte er rechtfertigen. Nichts Größeres, nichts, was übermäßige Aufmerksamkeit auf seinen Laden lenkte, die Fassade, die er der Welt zeigte. Wenn es ihm einen Kitzel verschaffte, diese unrechtmäßig erworbenen Güter in legale Waren zu verwandeln, einen Stromstoß in seinem Blut, als hätte er in eine Steckdose gegriffen, so hatte er ihn unter Kontrolle und nicht umgekehrt. So schwindelerregend und stark er auch war. Jedermann hatte geheime Winkel und Gassen, die kein anderer sah – worauf es ankam, waren die größeren Straßen und Boulevards, das, was auf den Karten zu sehen war, die andere von einem hatten. Das Ding in ihm, das sich ab und zu mit einem Ruf, einem Zupfen oder einem Schrei bemerkbar machte, war nicht das gleiche wie das, was sein Vater gehabt hatte. Diese Krankheit, die sich jeden Augenblick unterwarf. Die Krankheit, der Freddie immer öfter zu Diensten war. Carney war ähnlich veranlagt – wie auch anders, bei einer Kindheit mit einem solchen Vater. Als Mann musste man seine Grenzen kennen und sie meistern.
Zwei Typen in Nadelstreifenanzügen, wahrscheinlich Vertreter, die in der Stadt Versicherungen verhökerten, kamen aus der Bar herein, die das Café von der Eingangshalle trennte. Sandra sagte ihnen, sie sollten sich setzen, wohin sie Lust hätten, und als sie sich umdrehte, beguckten sie ihre Beine. Sie hatte schöne Beine. Diese Tür. Durch die Tür kam man von der Bar und in die Eingangshalle. Es gab drei Zugänge in die Eingangshalle: von der Bar, von der Straße und von der Kleiderboutique aus. Plus die Fahrstühle und die Feuertreppe. Drei Leute vorn am Empfang, ein ständiges Kommen und Gehen von Gästen … Carney bremste sich. Er nahm einen Schluck von seinem Kaffee. Manchmal war er unachtsam, und seine Gedanken gerieten auf Abwege.
Im Nightbirds hatte Freddie ihm das Versprechen abgenommen, darüber nachzudenken, denn er wusste, meistens machte Carney dann doch mit, wenn er zu lange über einen der Pläne seines Cousins nachdachte. Carney musste nur einen Abend lang die Decke anstarren, das reichte, um die Sache unter Dach und Fach zu bringen, die Risse da oben wie eine Skizze der Risse in seiner Selbstbeherrschung. Das gehörte zu ihrer üblichen Laurel-und-Hardy-Nummer – Freddie beschwatzte ihn zu irgendeinem unüberlegten Vorhaben, und dann versuchte das ungleiche Paar, den Konsequenzen zu entgehen.
Schon wieder so ein schöner Schlamassel, in den du mich da reingeritten hast. Sein Cousin war ein Hypnotiseur – plötzlich stand Carney Schmiere, während Freddie im Billigwarenhaus Comics klaute, sie schwänzten die Schule, um sich im Loew’s ein Western-Doppelprogramm anzusehen. Zwei Drinks im Nightbirds, und dann quetschte sich die Morgendämmerung durch das Fenster von Miss Marys Privatkneipe, und der Schwarzgebrannte rollte ihnen im Kopf herum wie eine Eisenkugel. Ich hab da eine Halskette, die ich loswerden muss, kannst du mir helfen?
Jedes Mal wenn Tante Millie Freddie wegen irgendeiner Geschichte, die die Nachbarn ihr erzählt hatten, ins Gebet nahm, war Carney mit einem Alibi zur Stelle. Niemand würde Carney jemals verdächtigen, dass er log, dass er unehrlich war. Das war ihm ganz recht. Dass Freddie der Truppe um Miami Joe, mit der er sich da eingelassen hatte, seinen Namen genannt hatte, das war unverzeihlich. Carney’s Furniture stand verdammt nochmal im Telefonbuch, in der Amsterdam News, wenn er es sich leisten konnte, eine Anzeige zu schalten, und jeder konnte ihn ausfindig machen.
Carney erklärte sich bereit, darüber zu schlafen. Am nächsten Morgen konnte die Zimmerdecke ihn nicht umstimmen, und jetzt musste er sich überlegen, was er wegen seines Cousins unternahm. Es ergab einfach keinen Sinn, dass ein Gangster wie Miami Joe einen Schmalspurganoven wie Freddie für so einen Job ins Boot holte. Und dass Freddie ja gesagt hatte, war eine schlechte Nachricht. Das war etwas anderes, als Süßigkeiten zu klauen, und auch etwas anderes als damals, in ihrer Kindheit, als sie an der Spitze der Insel auf einem Felsen dreißig Meter über dem Hudson River gestanden hatten und Freddie ihn herausforderte, in das schwarze Wasser zu springen. War Carney gesprungen? Er war gesprungen und hatte den ganzen Weg hinunter geschrien. Und jetzt verlangte Freddie von ihm, in einen Haufen Beton zu springen.
Er bezahlte Sandra. Sie zwinkerte ihm routiniert zu. Als Freddie am Nachmittag im Büro anrief, sagte Carney ihm, es komme überhaupt nicht in Frage, und rieb ihm seine Naivität unter die Nase. Und damit hatte es sich, zwei Wochen lang, bis das Ding über die Bühne ging und Chink Montagues Gorillas auf der Suche nach Freddie in den Laden kamen.
Der Raubüberfall war in sämtlichen Nachrichten. Er musste Rusty fragen, was der Juneteenth war, und er hatte recht gehabt, es war irgend so ein ländliches Ding.
»Der Juneteenth, das ist, als die Sklaven in Texas mitgekriegt haben, dass die Sklaverei vorbei war«, sagte Rusty. »Meine Cousins haben das immer mit einer Party gefeiert.«
Erst sechs Monate später mitzukriegen, dass man frei war, kam ihm nicht wie ein Grund zum Feiern vor. Eigentlich eher ein Anlass, die Morgenzeitung zu lesen. Carney las jeden Tag die Times, die Tribune und die Post, um sich auf dem Laufenden zu halten, kaufte sie sich an dem Stand an der Ecke.