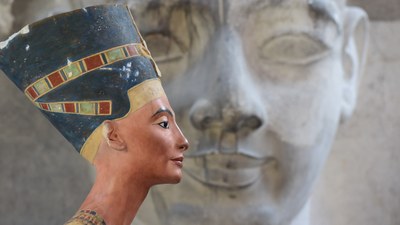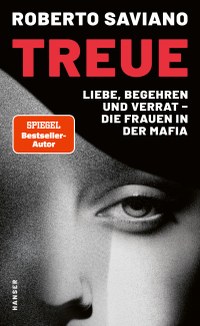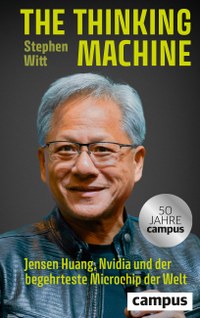Wie Kultur zu Werke geht
Eine Sichtweise zur Kultur lautet: Auf der Erde leben Volksgruppen, die durch gemeinsame Praktiken zusammengehalten werden. Und jede dieser Kulturen mit ihren bestimmten Bräuchen und Kunstformen gehört den Leuten, die in sie hineingeboren wurden. Deshalb muss sie vor äußerer Einmischung geschützt werden. Demnach ist Kultur eine Art Eigentum, das diejenigen besitzen, die sie mit Leben erfüllen. Das Positive an dieser Sichtweise besteht darin, dass sie Menschen dazu ermuntert, ihr Kulturerbe zu pflegen, und ihnen die Mittel an die Hand gibt, es auch zu verteidigen: zum Beispiel durch Druck auf Museen, Kulturgüter, die unter dubiosen Umständen erworben wurden, an ihre rechtmäßigen Eigentümer zurückzugeben. Die Anschauung, wonach Kultur besessen werden kann, wird von einer überraschend breiten Koalition verfochten, darunter Nativisten, die sich ihren nationalen Traditionen verpflichtet fühlen, und diejenigen, die kulturelle Aneignungen dadurch zu unterbinden hoffen, dass sie das Kulturgut einer Gruppe zur Verbotszone für Außenstehende erklären.
Eine andere Sichtweise lehnt die Vorstellung ab, dass Kultur wie ein Besitz behandelt werden kann. Als ein beispielhafter Vertreter kann der chinesische Reisende Xuanzang gelten, der sich nach Indien aufmachte und mit buddhistischen Handschriften in die Heimat zurückkehrte. Übernommen wurde sie auch von arabischen und persischen Gelehrten, die Werke griechischer Philosophie übersetzten. Sie wurde von zahllosen Schriftkundigen, Lehrern und Künstlern praktiziert, die sich aus Quellen weit außerhalb der eigenen Kultur inspirieren ließen. Und in der Ära nach dem europäischen Kolonialismus schlossen sich ihr neben dem nigerianischen Schriftsteller und Nobelpreisträger Wole Soyinka auch zahlreiche weitere Künstler an.
Für sie entsteht Kultur nicht nur aus den Ressourcen einer Gemeinschaft, sondern auch aus Begegnungen mit anderen Kulturen. Sie wird nicht allein durch die Erlebnisse von Individuen geprägt, sondern ebenso durch entliehene Formen und Ideen, die sie darin unterstützen, eigene Erfahrungen auf neuartige Weise zu verstehen und auszudrücken. Durch die Brille einer Sichtweise betrachtet, die Kultur als Eigentum begreift, mögen diese Kulturschaffenden als Eindringlinge erscheinen, die sich Fremdes aneigneten oder gar Diebstahl begingen. Aber sie verfolgten ihre Arbeit mit Demut und Hingabe, weil sie intuitiv erkannten, dass sich Kultur dadurch weiterentwickelt, dass sie in Umlauf kommt. Sie wussten, dass die irrige Vorstellung von Eigentum und Urheberschaft der Kultur Grenzen setzt und ihr Zwänge auferlegt, die ihre Ausdrucksformen verarmen lässt.
Dieses Buch ist keine Festrede auf die hohe Literatur und auch keine Verteidigungsschrift für den abendländischen Kanon. Es vertritt eine Sicht der Kultur, die chaotischer und meines Erachtens interessanter ist: eine der von weit her stammenden Einflüsse, die durch Kontakte zustande kommen, und der Innovation, die dadurch voranschreitet, dass die Scherben untergegangener Zivilisationen ausgegraben und zu etwas Neuem zusammengekittet werden. Viele der Figuren, die federführend für diese Sichtweise standen, erhielten für ihr Werk niemals die verdiente Anerkennung, und manche kennt auch heute noch niemand, wenn man von einem kleinen Kreis von Spezialisten absieht. Auch mir waren viele unvertraut, bis ich über die etablierten Kanons hinausblickte und mich den Protagonisten dieses Buchs zuwandte. Sie führten mich auf weniger ausgetretene Pfade und durch verborgene Seitenstraßen. Und das habe ich von ihnen gelernt: Wenn wir die Auswüchse des Tourismus begrenzen, einen respektlosen Umgang mit fremden Kulturen vermeiden und bedrängte Traditionen schützen wollen, müssen wir eine Sprache finden, die sich nicht um Besitz und geistiges Eigentum dreht, sondern sich eher an dem orientiert, wie Kultur wirklich zu Werke geht.
Aus der Arbeit dieser Kreativen ergibt sich eine neuartige Erzählung zur Kultur, eine des Engagements, das die Hürden von Zeit und Raum überwindet, von überraschenden Verbindungen und unterschwelligen Einflüssen – eine Kulturgeschichte, die nicht nur schöne Seiten hat und so auch nicht dargestellt werden sollte. Aber sie ist die einzige, die wir haben: die Geschichte von uns Menschen als einer kulturschaffenden Spezies. Unsere Geschichte.