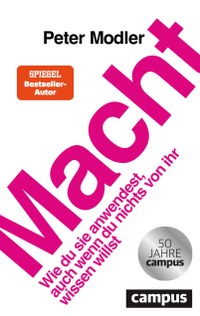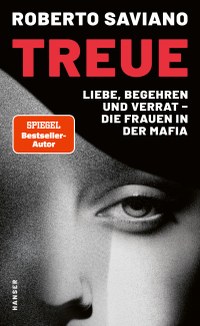Toxischer Shit
Wer der Auslöser für dieses Buch war, weiß ich noch ganz genau: ein junger Mann zwischen zwanzig und dreißig. Seinen Namen weiß ich bis heute nicht.
Er hatte eine enorm sympathische Ausstrahlung, wach, charmant, schlagfertig. Bei einem meiner Vorträge war er mir aufgefallen, weil er so intelligente Fragen gestellt hatte und bei ein paar kleinen Szenen, die ich vor dem ganzen Publikum dargestellt hatte, völlig angstfrei und selbstbewusst mitgemacht hatte. Bei dem Vortrag war es um Konflikte an Universitäten gegangen. Wir hatten alle zusammen in diesem Hörsaal eine gute Zeit gehabt, uns mit dem Thema auseinandergesetzt, uns gewundert, gelacht und ein paar praktische Lösungen gefunden. Als nach dem Vortrag die meisten schon gegangen waren, kam er dann aber noch einmal zu mir und stellte mir eine Frage, die ihm auf dem Herzen zu liegen schien – nämlich die, ob es tatsächlich so viele Machtspiele im Management von Forschungseinrichtungen und Lehrstühlen gebe. Das musste ich bejahen. Aber, fügte ich hinzu, wenn man sich darauf einstellt, kann man gut damit klarkommen.
Er jedoch schüttelte daraufhin, sichtlich angewidert, den Kopf und ging einfach. Beim Hinausgehen hörte ich ihn nur noch vor sich hinmurmeln: »Toxischer Shit. Echt toxischer Shit.« Es war völlig klar, dass er mit diesem Sachverhalt nichts zu tun haben wollte.
Seither ist er mir präsent. Dieses Buch würde ich ihm gern zu lesen geben. Dabei ist er mit seiner demonstrativen Abneigung alles andere als allein. Ich treffe seit Jahren auf solche Reaktionen: gut ausgebildete, intelligente Leute, die dann sofort Ablehnungsreflexe entwickeln, wenn sie mit Machtfragen zu tun haben sollen. Sie empfinden es als derart abstoßend, im Beruf auf einen anderen Faktor zu treffen als ihre fachliche Kompetenz – auf die sie oft zu Recht stolz sind –, dass sie sich lieber aus jeder Auseinandersetzung zurückziehen. Entweder begegnet mir jemand auf der Höhe meiner Fähigkeiten und meiner Bildung oder ich lasse es ganz bleiben. Selber schuld!
Es passt da durchaus ins Bild, wenn in mehreren großen Erhebungen bei jüngeren Berufstätigen der Anteil derer deutlich abnimmt, die sich irgendwann in einer Führungsrolle sehen.1
Ich bedaure das. Woher dieses Mindset kommt, kann ich nachvollziehen, aber es führt leider dazu, dass eine Gesellschaft (und auch die Unternehmen in ihr) die besten Köpfe verliert. Das können wir uns um unser aller Zukunft willen gar nicht leisten.
Darum also dieses Buch, im Grunde so etwas wie ein langer Brief an diesen mir Unbekannten oder vielmehr an alle diejenigen, die sich aus verständlichen Gründen aus Machtfragen heraushalten wollen. Und damit leider anderen Leuten Tür und Tor öffnen, die bei diesem Thema keinerlei Skrupel haben.
Mit Macht möchten ja inzwischen sehr viele Menschen nicht einmal dann etwas zu tun haben, wenn sie sich in einer Rolle befinden, die andere als ausgesprochen machtvoll empfinden. In der Gruppe entscheiden: gern. Konsens im Team haben: auf jeden Fall. Aber etwas durchsetzen, auch gegen Widerstand: lieber nicht.
Ein Beispiel, das für viele stehen könnte: jemand wie der Türsteher des legendären Berliner Szene-Clubs »Berghain«, der unzählige Menschen nicht hineinlässt, die dort auch gern tanzen würden. Das finden die Abgewiesenen natürlich alles andere als toll. Er hat zwar seine Gründe (will nämlich einen geschützten Raum ermöglichen), teilt sie aber den Weggeschickten nicht mit. Die Betroffenen können nach seiner Entscheidung gleich wieder abziehen.
Klarer Fall von Machtausübung! Sollte man meinen. Die Pointe ist aber, dass genau dieser Sachverhalt von eben dem Türsteher kategorisch bestritten wird. Zwar weist er tatsächlich jeden Tag Leute ab, jahrelang, behauptet aber ausdrücklich, dass das mit Macht nichts zu tun habe.2 Wie wenn er sich dieses Begriffes schämen würde. Er will offensichtlich innerhalb seiner Szene auf keinen Fall als jemand dastehen, der Macht ausübt. Das wollen inzwischen viele nicht mehr. Wie kommt das?
Es versteht sich inzwischen fast von selbst, dass bei vielen Menschen mit einer entschieden moralischen Überzeugung zwar eine Menge Kompromisse eingegangen werden, aber bei Machtfragen ist die rote Linie schnell überschritten. Bezeichnend die Antwort auf die Frage, die vor ein paar Jahren an einen Großmeister der Achtsamkeit, den buddhistischen Lama Ole Nydahl, gestellt wurde. Der Lama wurde gefragt: »Was steckt hinter dem Bedürfnis, Macht ausüben zu wollen?« Darauf entgegnete der Lama: »Das Bedürfnis, andere zu beherrschen, resultiert aus der eigenen Schwäche … (es waren, d.V.) oft Leute, die wenig Spaß am Leben hatten und ein bisschen langweilig waren … Fröhliche Menschen müssen niemanden beherrschen! Wer selbst stark ist, muss nicht auf anderen Leuten sitzen.«3 Ein bisschen unernst der Lama, ein bisschen am Thema vorbei, aber irgendwie klingt’s doch cool.
Auch in vielen Firmen und Organisationen wird über Machtfragen inzwischen überhaupt nicht mehr geredet (übrigens auch nicht seitens der Betriebsräte), es gibt da eindeutig angesagteres Vokabular, Teilhabe etwa oder Spirit, Authentizität oder die gute alte Work-Life-Balance. Und alles natürlich »wertschätzend,« unbedingt. Gegen diese angenehmen Begriffe ist auch grundsätzlich gar nichts einzuwenden, wenn nicht … ja, wenn nicht ihr inflationärer Gebrauch den Verdacht nahelegen würde, dass es da einen ganz enormen blinden Fleck geben könnte.
Denn wer sich nicht täuschen lässt vom einladenden Sound agilen Arbeitens und hierarchiefreier Botschaften stößt durchaus nicht auf herrschaftsfreie Zonen.
Merkelismus
Von anderen Ländern aus gesehen, wirkt auch der Umgang der Deutschen mit politischen Machtfragen etwas bizarr. Die hiesige Eigenart, etwas lieber nicht direkt zu entscheiden, sondern sich ewig Zeit zu lassen mit Hin- und-her-Diskutieren – man könnte es als Merkelismus apostrophieren –, wirkt dort befremdend.
Von innen aus betrachtet, ist das natürlich ganz anders. Wissen die da draußen denn nicht mehr, welchen brutalen Gewalt-Exzessen sich die Deutschen im Dritten Reich ausgeliefert hatten? Das Zurückschrecken vor Machtausübung muss doch nur zu verständlich sein angesichts einer Vergangenheit, wo schrankenlose Macht in Gestalt eines einzigen Menschen, eines sogenannten »Führers«, verherrlicht worden war.
Der Machtmissbrauch dieser Jahre war so existenziell und hatte eine solche Blutspur hinter sich hergezogen, dass es jahrzehntelang zum Code of Conduct bei deutschen Intellektuellen gehörte, von Machtfragen nichts wissen zu wollen. Noch am ehesten befasste man sich damit in der Form des spöttischen Kommentars. Aber etwa selbst Macht auszuüben: no way.
Allerdings mehren sich die Zeichen, dass dieses antrainierte Zurückschrecken vor jeder Machtanwendung einen hohen Preis hat. Denn im Windschatten dieses vermeintlich unschuldigen Verhaltens erodiert Vertrauen, breitet sich das Recht des Stärkeren aus, gehen moralische Maßstäbe verloren und wird das untergraben, was wir Demokratie nennen.
Zugegeben, der Begriff Machtanwendung hört sich irgendwie kalt und dezent brutal an. Dabei stellen sich schnell Assoziationen ein, die uns am Ende nicht viel weiterhelfen. Wir denken an den Herrn der Ringe, an einen Diktator im Amt, an den Idioten von Chef, der seine Leute zusammenbrüllt, oder an eine Königskrönung mit all ihrem goldenen Pomp. In den Sekundenbruchteilen, die unser Gehirn zum Assoziieren braucht, taucht vielleicht die schreiende Menge beim Reichsparteitag mit Goebbels auf, ein segnender Papst oder Konzernvorstände in Privatjets. Die Grundstimmung ist dabei eher nicht positiv.
Hinzukommt, dass viele Menschen inzwischen Machtanwendung und Machtmissbrauch einfach gleichsetzen. Dieses Missverständnis ist eines der bequemsten und der folgenreichsten. Denn genau diese Gleichung erzeugt nicht nur politische Blindheit in Firmen und Gesellschaft, sie lähmt auch sehr effizient. Die flache Gleichsetzung untergräbt jede Machtanwendung, die zu Veränderung, gar Verbesserung der Verhältnisse führen könnte. Wozu so eine Macht noch organisieren, wenn es ja doch nur eine Frage der Zeit ist, bis ein Missbrauch aus ihr wird? Dann lieber nichts tun, dann lieber folgenlose Kritik äußern an denen, die wir völlig undifferenziert als »die Mächtigen« beziehungsweise »die Machthaber« bezeichnen. Das bringt uns dann die Zustimmung der Gleichgesinnten ein, gegenseitiges Schulterklopfen, weil man vermeintlich auf der richtigen Seite steht. Wozu diese Haltung aber faktisch führt, ist nichts anderes als die Kultivierung von Ohnmacht.
»Macht« kommt sprachgeschichtlich vom alten »mögen«, »vermögen«, also können. Unser Verb »machen« leitet sich direkt davon ab. Mit »mögen« im Sinn von Sympathie hat es nichts zu tun, vielmehr handelt es sich, ganz neutral verstanden, nur um ein anderes Wort für Wirksamkeit. Im alltäglichen Sprachgebrauch, gerade unter Gebildeten, wird über Macht allerdings kaum noch so neutral gesprochen, sondern in der Regel mit moralischer Aufladung. Die Empörungsbereitschaft wartet bei diesem Begriff an jeder Ecke.
Im Folgenden begebe ich mich darum auf so etwas wie eine Forschungsreise durch unseren Alltag. Dabei halten wir uns nicht weiter damit auf, die Ausübung von Macht nur in der sogenannten großen Politik zu verorten. Klar, wenn man das macht, fällt das Jammern und die Verurteilung leichter, weil wir ja mit eben dieser »großen Politik« vermeintlich nichts zu tun haben. Aber wir sind damit nur scheinbar fein raus. Der Taschenspielertrick ist zu dreist. Wir tun oft so, als wären wir bloß engagierte Beobachterinnen, während wir in Wirklichkeit Akteure sind und voll dabei. Ich erkläre das im Buch noch detailliert.
Unausweichliche Machtanwendung
Um diese Missverständnisse und Fehlannahmen hinter uns zu lassen, unternehmen wir eine kleine Expedition durch das, was wir für normal und selbstverständlich halten, was aber in Wahrheit alles andere als das ist. Dabei soll uns gerade das Verhalten interessieren, an das wir bei Machtfragen nicht gleich denken. Nicht das der Vorstandsvorsitzenden, sondern das der Busfahrerin. Nicht der Investor steht im Fokus, sondern der Friseur. Nicht der Bundeskanzler, sondern die Kollegin im agilen Team. Sie werden sehen, das kann anregend sein.
Was ich nicht vornehme – obwohl auch das sehr reizvoll wäre, nur bin ich dafür nicht besonders kompetent –, ist eine Analyse der Machtfragen in Familien. Manche Firmen tun ja sogar so, als seien sie genau das – »Familien« nämlich. Und unterschlagen dabei, wie viele Familien leider katastrophale Orte sind und dass gerade in den schön beleumundeten Familien die meisten Gewalttaten verübt werden. Einfach nur nett geht es auch in Familien nun mal nicht zu. Aber um diese privaten Lebensverhältnisse wird es im Folgenden nicht gehen.
Worum es auch nicht gehen wird, ist die Machtausübung in sozialen Netzwerken. Es sind ja eher asoziale Einrichtungen geworden, mit ihrem zwanghaften Neuigkeitenhunger, den sektenhaften Fake-News, den Shitstorms mit geringer Faktengrundlage und dem mob-artigen Verhalten. Aber auch das: nicht unser Thema. Ebenfalls nicht unser Ding: die anonyme Macht von bürokratischen Systemen. Dass diese Systemmacht nicht nur Schutz sein kann, sondern auch Lähmung, erleben unzählige Menschen – wenn die Organisation jede Initiative aussitzt, verzögert, verdaut und als wirkungslos wieder ausscheidet. Aber das gehört in ein anderes Buch.
Was wir uns jedoch umso genauer auf den folgenden Seiten anschauen, ist der Zusammenhang zwischen der eigenen beruflichen Aufgabe und den damit verbundenen – unausweichlichen und zwangsläufigen – Machtfragen. Das betrifft in erster Linie Menschen, die sich in beruflichen Führungsrollen befinden oder sich überlegen, eine solche Rolle zu übernehmen. Allerdings sollten wir die Grenzen dabei nicht zu eng ziehen. Auch der Lehrer in einer Klasse, die Chirurgin im OP-Raum, die Leiterin einer Kita, der Owner eines Projekts haben Führungsrollen. Auch dann, wenn sie davon eigentlich nichts wissen wollen. Im Grunde genommen geht die Bedeutung unseres Themas weit über Führungskräfte hinaus. Wir richten damit den Blick auf das Bindemittel für ein ganzes Gesellschaftsgebäude, auf den sozialen Mörtel, der es zusammenhält. Es geht dabei, kleiner machen wir’s jetzt nicht, um das, was uns zivilisiert.
Das ist eine ziemlich große Überschrift. Aber wir versuchen einmal, dies alles mit einer gewissen Leichtigkeit zu behandeln. Auch wenn es dabei überall um gewichtige Machtfragen geht.
Zum Text selbst folgende Hinweise: Alle fremdsprachigen Texte wurden von mir selbst übersetzt. Eigennamen sind fiktiv, mit Ausnahme prominenter und bereits öffentlich bekannter Persönlichkeiten. Mein Dank für kritische Lektüre geht an Anne Kotterer, Ekkehard Pohlmann und Martin Ott; für das Kapitel zu agilem Arbeiten an Sandra Dalk und Anke Scheuber. Und nicht zu vergessen: meine Lektorin Waltraud Berz.
Warum wir selbst Macht anwenden sollten?
Weil es uns den Hals retten kann.
Peter Modler