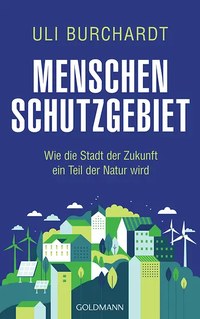Mein Dorf
Mein Dorf ist viele Hundert Jahre alt. Es liegt 450 Meter über dem Meer, ein paar Kilometer vom Bodensee entfernt, in einer klimatisch bevorzugten Lage mitten in Europa. Da bin ich aufgewachsen, von dort stammen meine ersten Erinnerungen. Mein Dorf hat heute circa 750 Einwohner und in etwa die Form eines Quadrates, und wenn man sich dieses Quadrat aus der Nähe anschaut, dann erkennt man, dass es ursprünglich ein T war. Dieses T, das waren zwei Straßen, an denen entlang kleine Bauernhöfe standen. Zu Beginn der Siebzigerjahre, als ich geboren wurde, wurde mein Dorf in das größere Nachbardorf eingemeindet, und es entstand unter dem Siedlungsdruck der Stadt Konstanz mit der Neugründung der Universität ein kleines Neubaugebiet mit zwei neuen Straßen, fertig war das Quadrat.
Aber zurück zum T: An dessen zwei Straßen siedelten sich im Laufe von Jahrhunderten Bauern an. Die Bauernhöfe in unserer Region waren meist lang gestreckte Gebäude, ein Drittel Wohnhaus und zwei Drittel »Ökonomie« – der Teil also, in dem die Tiere, das Futter, die Gerätschaften untergebracht waren. Neben oder hinter dem Haus ein Bauerngarten, wo ein Großteil des eigenen Bedarfs an Obst und Gemüse angebaut wurde, vor dem Haus ein Misthaufen, der Dünger für die Felder und Wiesen. Dort wurde Futter vor allem für das Milchvieh produziert, in meiner Kindheit waren das Grünfutter (also frisch gemähtes Gras), Heu (also getrocknetes Gras) und Futterrüben. Mit diesem kleinen System produzierte man Milch sowohl für den eigenen Bedarf als auch zum Verkaufen: Als ich ein Kind war, brachten die Bauern jeden Abend die Milch, die sie übrig hatten, also verkaufen konnten, mit dem Handwagen zum »Milchhäusle« in der Mitte des Dorfes. Dort wurde die Milch abgegeben, gewogen und notiert. Irgendwann kam ein Lastwagen von der Molkerei und holte alles ab.
Zum Hof gehörten Hühner, manchmal ein paar Ziegen oder Schafe und nicht zu vergessen Schweine, denen man die Reste aus der Küche zum Fressen gab. Jeder Hof ernährte die dort lebenden Generationen einer Familie und vielleicht noch ein paar Arbeitskräfte. Produziert wurden Milch und meist noch etwas Getreide, das nicht auf dem Hof gebraucht wurde und verkauft werden konnte. Außerdem Eier, eventuell etwas Obst, viele brannten auch Schnaps selbst. Und was natürlich auch produziert wurde: Fleisch.
Rübenkeller, Schmiede und Schlachtfest
Wir hatten zu Hause keine Landwirtschaft, mein Vater arbeitete als Professor an der Universität Konstanz, und meine Brüder und ich waren drei Jungs, die ständig unterwegs waren. Der Hof, auf dem wir als Kinder am meisten Zeit verbrachten, lag genau in der Mitte des Dorfes, an der Kreuzung des T. Die Kinder der Familie, die dort lebte, waren damals schon fast erwachsen, wir waren also die einzigen Kinder dort, waren gern gesehen und nahmen jahrein, jahraus am Leben auf dem kleinen Hof teil.
Dazu gehörte zum Beispiel die Rübenernte: Die schweren Futterrüben wurden mit einem einfachen kleinen Roder aus der Erde gezogen, von Hand grob gereinigt, aufgehoben und auf einen Wagen geladen. Eingelagert wurden sie im Rübenkeller – für jede Art der Lagerung gab es auf dem Hof den richtigen Raum: den trockenen Heustock fürs Heu, den Erdkeller für Kartoffeln oder Äpfel und eben den kühlen, feuchten Rübenkeller für die Rüben. Die Rüben wurden nach der Ernte von außen durch eine Öffnung in der Wand direkt in den Keller geschüttet. Von dort holte man sich im Lauf des Winters die Rüben, die man zerkleinerte und dem Milchvieh fütterte. Für unsere Mitarbeit bei der Rübenernte bekamen wir jedes Jahr je eine Rübe geschenkt. Daraus schnitzten wir uns Rübengeister, die in unserer Gegend zu dieser Jahreszeit gehörten. Es war Herbst, es war früh dunkel, es war neblig, es roch nach feuchter Erde. Alles schmeckte nach schwerer, aber befriedigender Arbeit.
»Nur Narren haben es eilig« stand in großen Lettern an die Wand geschrieben in der Schmiede, die sich ebenfalls in der Mitte des Dorfes befand. Die Werkstatt lag an der Straße und war immer offen, oft wurde an großen Werkstücken, wie zum Beispiel Treppengeländern, direkt am Straßenrand gearbeitet. In der Schmiede brannte das Schmiedefeuer unter einer großen Esse, der Schmied hantierte mit mächtigen Hämmern und Zangen, legte Eisen ins Feuer, zog glühende Eisen heraus und bearbeitete sie unter lautem, klingendem Hämmern auf dem schweren Amboss, dass die Funken flogen. Die Schmiede gehörte im Dorf dazu, dort wurde das hergestellt oder repariert, was der Bauer nicht selbst herstellen oder reparieren konnte. Und natürlich wurden Hufeisen geschmiedet und Pferde beschlagen.
Fast alles, was ein Mensch zum täglichen Leben braucht, wurde in meinem Dorf produziert: Kartoffeln, Gemüse, Getreide, Milch, Eier, Obst, Saft, Most, Schnaps. Kohlenhydrate und Proteine also, Ballaststoffe und Vitamine, Spurenelemente und Genussmittel. Und natürlich Geflügel und Fleisch. Die Hühner schlachtete unser Bauer selbst, wir schauten zu. Das Huhn wurde aufgegriffen, zum Hackklotz gebracht, und mit einem leichten Beil wurde ihm der Kopf abgeschlagen. Das Tier zuckte noch kurz, dann rupfte es die Bäuerin und bereitete es zu – Frauenarbeit. Ähnlich erging es den Stallhasen, auch das machte der Bauer selbst. Anders bei Schwein und Rind: Schweine wurden vom Metzger, der von Zeit zu Zeit auf den Hof kam, geschlachtet und unter Mithilfe der Familie weiterverarbeitet, zu Fleisch und Wurst, Blutwurst, Leberwurst. Dampf und Schlachtgeruch erfüllten die Luft, und dann war Schlachtfest – es gab Fleisch und Wurst satt für alle, die mitgearbeitet hatten. Der Großteil der Produkte ging in die Speisekammer und wurde eingelagert.
Vorratshaltung war eine wichtige Kompetenz, die man insbesondere als Hauswirtschafterin oder Bäuerin lernte. Wer je Obst, Gemüse oder gar Fleisch selbst haltbar gemacht und eingelagert hat, der weiß, dass es viele Kulturtechniken, Werkzeuge, viel Wissen, Können und ein kluges Management braucht, wenn man die richtige Menge der richtigen Lebensmittel in der richtigen Qualität selbst gemacht das ganze Jahr für eine vielköpfige Familie vorhalten möchte.
Rinder wurden noch seltener als Schweine geschlachtet. Dafür gab es einen Schlachtraum der Gemeinde, neben dem Feuerwehrhaus, dorthin wurden die Tiere gebracht und vom Metzger geschlachtet und zerlegt. Mit einem Bolzenschussgerät wurde zwischen den Augen der Betäubungsschuss angesetzt, das Rind brach schlagartig zusammen, die Kehle wurde durchgeschnitten und das Tier mit einer Kette an den Hinterbeinen emporgehoben zum Ausbluten.
Wiederkäuer
Rinder sind Wiederkäuer, sie haben vier unterschiedliche Mägen (Pansen, Blättermagen, Netzmagen und Labmagen) und fressen völlig andere Nahrung als wir Menschen, zum Beispiel Gras oder Heu, beides ist für uns gar nicht verwertbar. Haben Sie schon mal versucht, einen Grashalm zu essen? Ein Rind verwandelt also für uns nicht verwertbare Pflanzen in wertvolle Lebensmittel, nämlich Milch und Fleisch. Beim Schwein ist das anders. Ein Schwein ist ein Allesfresser. Schweine ernähren sich sehr ähnlich wie wir Menschen, eigentlich sind sie unsere Nahrungskonkurrenten. Ein Schwein füttert man deshalb entweder – so wie früher auf dem Dorf – mit Resten, die der Mensch nicht mehr essen kann oder mag. Oder man füttert es – so wie heutzutage – mit Lebensmitteln, die wir Menschen nicht brauchen, weil sie im Überfluss vorhanden sind. Getreide zum Beispiel. Schweinefleisch ist deshalb ein Luxusgut, ein sogenanntes Veredelungsprodukt. Ein Schwein macht aus zehn Kilojoule Menschennahrung, zum Beispiel Getreideschrot, etwa ein Kilojoule Schweinefleisch. Anders gesagt: Würde man statt des Schweinefleischs das Getreide essen, das an das Schwein verfüttert wurde, wäre man zehnmal so lange satt. Deshalb gab es in Zeiten, in denen Lebensmittel knapp waren, zum Beispiel im Krieg, eines nicht: Schweinefleisch. Und deshalb ist Schweinefleisch das Merkmal von Wirtschaftswunder und Aufschwung schlechthin.
Zurück zur Kuh: Wenn man Milch einerseits und vegane Alternativen andererseits mit Blick auf ihre Energiebilanz vergleicht, ist zu bedenken, dass die Energie für die veganen Produkte aus Hafer oder Soja kommt, diejenige für die Kuhmilch aber zu einem guten Teil eben aus Gras. Aus Gras können wir ohne die Hilfe einer Kuh keine Energie herstellen. Aus Hafer oder Soja natürlich schon, zum Beispiel Müsli oder Tofu. Anders gesagt: In unfruchtbaren Regionen, wo Ackerbau, also eben zum Beispiel der Anbau von Hafer oder Soja, gar nicht möglich wäre, da ist aber die Haltung von Kühen möglich. Das ist übrigens der Grund, warum sich Bergland ganz anders anfühlt als Flachland: Wer von München nach Garmisch fährt, kann sehen, wie der Ackerbau irgendwo bei Murnau langsam endet; die Böden werden, je näher man den Bergen kommt, flachgründiger und unfruchtbarer und das Klima kälter, es gibt nur noch Grünland. Und in diesen Regionen gab es entsprechend nur einen wesentlichen Wirtschaftszweig: Milchviehhaltung. Produziert wurden also hauptsächlich Milch und Käse, was bis heute die Bergregionen, ihre Kultur und ihre Küche prägt. Notgedrungen. Denn etwas anderes als Milch hätte man dort, erst recht weiter oben in den Bergen, überhaupt nicht produzieren können. Und auch nicht ernten. Die Kühe können natürlich an Stellen fressen, wo Maschinen gar nicht mehr und Menschen kaum noch arbeiten können.
Kurz gesagt: Aus Soja und aus Hafer könnten wir eine Menge andere nützliche Dinge herstellen als Milchalternativen, aus Gras ohne die Hilfe der Wiederkäuer gar nichts. Die Kühe haben in unserem Ökosystem deshalb eine gänzlich andere Bedeutung als die Schweine: Sie erschließen Energie und Nährstoffe, die der Mensch ohne ihre Hilfe nicht erschließen könnte. Deshalb sollten wir die Kühe nicht einfach so infrage stellen, wie manche selbst ernannte Hardcore-Klimaschützer das zuweilen fordern.
Ökosystem Dorf
Mein Dorf mit seiner kleinstrukturierten Landwirtschaft war also ein typisches Bauerndorf, ein ausgeklügeltes Ökosystem, das sich weitgehend selbst versorgte, sprich: Es gab viele geschlossene Nährstoffkreisläufe. Es war also ein relativ nachhaltiges, effizientes Habitat für Mensch und Tier, aber es wäre damals schon seit Jahrzehnten ohne fossile Brennstoffe für Heizungen und Maschinen nicht mehr funktionsfähig gewesen.
Damals, in den Siebzigerjahren, waren über mein Dorf bereits viele Modernisierungswellen hinweggegangen. Die Technisierung der Landwirtschaft, der Wandel vom Arbeitsochsen (oder gar der Kuh) zum Pferd, später zum Traktor. Der Wandel der Getreideernte von der unglaublich schweren Arbeit des Sensens und Dreschens über die Dreschmaschine, die dann später zentral in den Dörfern stand und einen Teil dieser schweren Arbeit, nämlich das Dreschen, das zuvor den ganzen Winter hindurch dauerte, in kurzer Zeit erledigte und die Handarbeit mit dem Dreschflegel für immer überflüssig machte – bis hin schließlich zum Mähdrescher, der die Ernte ab Mitte des 20. Jahrhunderts schon fast alleine übernahm.
Und in diesen Jahren wurden die ersten Auswirkungen von Urbanisierung in meinem Dorf sichtbar: Menschen, die in der Stadt arbeiteten, zogen zum Leben aufs Land, dorthin, wo Platz war. Wir zum Beispiel. Und die Menschen im Dorf, die bisher Landwirte gewesen und daran gewöhnt waren, das ganze Jahr und sieben Tage die Woche auf ihrem Hof zu arbeiten, die suchten sich jetzt Arbeit in der Stadt. Arbeit, die besser bezahlt war als die auf dem Hof, und die vor allem regelmäßig war: mit Feierabend an jedem Tag und mit einem freien Wochenende. So wurden ihre Bauernhöfe erst zu Nebenerwerbsbetrieben, später wurden die meisten ganz aufgegeben. Heute gibt es in meinem Dorf nur noch einen Haupterwerbslandwirt: den Müllerhof.