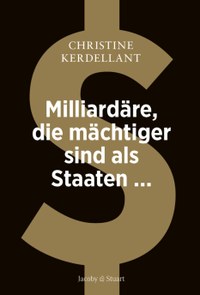Eine »systemische« Macht
Sie sind sechs, sämtlich Amerikaner, und sie sind weltweit aktiv, außerhalb der Zugriffsmöglichkeiten von Steuereinnehmern und Regulierern. Ihr persönlicher Reichtum übersteigt jede Vorstellung: 50, 100, 150 Milliarden, je nach Stimmung an den Börsen. Sie behaupten, die Welt retten zu wollen, doch die Covid-Pandemie hat sie vor allem noch reicher gemacht. Selbst wenn ihre Aktien an Wert verlieren, wiegen sie immer noch schwerer als die meisten Staaten der Welt. Wie sie heißen? Elon Musk (SpaceX, Tesla, X), Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Facebook-Meta), Bill Gates (Microsoft), Sergey Brin und Larry Page (Google). Diese sechs haben eine systemrelevante oder »systemische« Macht.
Es ist nicht ihr Vermögen, das sie so mächtig macht, vielmehr macht ihre Macht ihr Vermögen. Im Grunde genommen ist ihre offenkundige Finanzmacht nicht so wichtig. Worauf es ankommt, sind Fähigkeiten, die die Staaten nicht besitzen, nicht mehr besitzen oder noch nie besessen haben. Auf manchen Gebieten ersetzen sie die Staaten oder konkurrieren mit ihnen. Eines Tages werden sie sie ganz ersetzen können, ohne vom Volk dazu erkoren worden zu sein. Das ist etwas, was es in der Geschichte der Demokratien noch nicht gegeben hat.
Diese sechs westlichen Milliardäre werden immer noch reicher und mächtiger, ohne dass jemand sie daran hindert, denn die, die sie aufhalten könnten, wollen es nicht, und die sie gern aufhalten würden, können es nicht. Sie stellen eine existenzielle Bedrohung der Demokratien dar, die sie haben groß werden lassen, auch wenn sie vorgeben, über unsere Leben zu wachen wie der Vatikan über unsere Seelen.
Dem Magazin Forbes zufolge gab es 2023 2668 Dollarmilliardäre auf der Erde; Musk, Zuckerberg, Page, Brin, Bezos und Gates sind gar nicht alle die Ersten auf dieser Liste. Bernard Arnault, der Chef von LVMH (Louis Vuitton-Moët-Hennessy), steht oft an der Spitze, wenn an der Börse gerade ein für ihn günstiger Wind weht, Warren Buffet, der über 90-jährige König der Anleger, oder Françoise Bettencourt Meyers, die Erbin von L’Oréal, haben Reichtümer angehäuft, ohne jedoch eine Macht über Leben und Tod unserer Gesellschaften zu haben. Sie besitzen mehr Geld als sie jemals ausgeben könnten, doch sie sind keine Transhumanisten, haben nicht vor, die Spezies Mensch zu verändern, sie hegen auch keine messianischen Träume und benutzen ihre kolossalen Mittel nicht, um den Tod abzuschaffen oder den Mars zu kolonisieren – und sie üben auf die Psyche der jungen Generationen nicht denselben zerstörerischen Einfluss aus.
Es sind sechs Männer, um die es hier gehen soll, und nicht um den Block der »GAFAM« (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft), doch in jedem Fall gründet sich die Macht dieser Tycoons auf den Unternehmen, die sie zuerst gegründet haben. Allerdings sind ihre eigenen Aktivitäten nicht mit denen ihrer Unternehmen identisch. Außerdem gehören die Unternehmen von Elon Musk nicht zur GAFAM-Gruppe, obwohl er einer der Milliardäre mit fast uneingeschränkter Macht ist. Schließlich besitzt Apple, das zu GAFAM gehört, kein Monopol, also auch keine alleinige Macht auf einem Gebiet: Es hat mit einer mächtigen Konkurrenz aus Korea und China zu kämpfen. Als Steve Jobs, der ikonische Gründer von Apple, noch lebte, gehörte er also nicht zu dieser Handvoll »systemrelevanter« Milliardäre.
Die Vereinigten Staaten und Europa haben die Tech-Giganten immer weiterwachsen lassen, bis sie unantastbar wurden. China dagegen hat sie gezügelt, nachdem es den Boden für seine eigenen Akteure wie Alibaba oder Tencent bereitet hatte, doch als diese supermächtig und zur Gefahr für den Staat wurden, hat Xi Jinping ihnen die Flügel gestutzt. Er hat sie auf Linie gebracht, um allein von ihrer Macht profitieren zu können. Eine solche Übernahme ist im Westen schwer vorstellbar, und China ist alles andere als ein Rechtsstaat.
Bezos musste von 2007 bis 2011 keine Steuern zahlen
Sind die westlichen Staaten zu schwach geworden oder diese Milliardäre zu stark?
Wenn ihr Vermögen alle Rekorde schlägt, liegt das nicht nur an ihren blühenden Unternehmungen: Es liegt auch daran, dass sie es verstanden haben, die weltweiten Finanzströ- me zu ihrem Vorteil umzuleiten – mit der Hilfe von Steuerparadiesen und zum Schaden der Länder, in denen sie aktiv sind. Einige von ihnen haben sogar, was ihr eigenes Vermögen betrifft, die amerikanische Bundessteuer auf ihr Einkommen umgangen, indem sie in ihren Investments höhere Verluste deklarierten als die jährlichen Einnahmen. Das war der Fall bei Elon Musk im Jahr 2008 und bei Jeff Bezos zwischen 2007 und 2011 – kurz bevor er für eine Weile der reichste Mann der Welt wurde.
Sie könnten gut in einer Welt ohne Staaten leben und sind instinktiv misstrauisch gegenüber Regierungen, die ihren Einfluss begrenzen oder ihnen Steuern auferlegen. Elon Musk unterstützt Trump und seine Niedrigsteuern für die Reichsten; die Gründer von Google planten eine Zeit lang, Google offshore anzusiedeln, auf einer Plattform vor der amerikanischen Küste.
Diese neuen Ultrareichen übernehmen von den Staaten auch einige hoheitliche Aufgaben, das heißt Tätigkeiten, die eigentlich nur vom Souverän ausgeübt werden können. Sie sind in der Raumfahrt, dem Gesundheitswesen, der Verteidigung, der Diplomatie und dem Bildungswesen – das heißt der Wissenschaft und der Prägung des Geistes – tätig bis dahin, dass sie auf bestimmten Gebieten völlig beherrschend sind. Sie sind reicher, einflussreicher und aktiver als die meisten Nationalstaaten. Und sie müssen niemandem Rechenschaft ablegen – vor allem keinen Wählern. Aber ist es normal, dass sie anstelle der Bürger darüber entscheiden, was gut für diese ist?
Als der französische Astronaut Thomas Pesquet 2021 zur internationalen Raumstation ISS flog, tat er das nicht mithilfe einer französischen Rakete. Und auch nicht mit einer Trägerrakete der einst allmächtigen NASA, der amerikanischen Raumfahrtagentur. Der amerikanische Staat kann solche Geräte nicht mehr produzieren. Seit der Explosion der Challenger 1986, die die Nation traumatisiert hat, nimmt er keine Risiken mehr auf sich. Der französische Astronaut benutzte auch keine europäische Rakete – Europa, das früher mit der Ariane sehr gut im Weltraumgeschäft war, ist in Rückstand geraten. Pesquet hat die ISS mit einer Falcon 9 erreicht, einer Rakete von Elon Musk – Jeff Bezos hätte es besser gefunden, wenn es seine gewesen wäre, eine Blue Origin. Der Amazon-Gründer sinnt deshalb auf Rache. Doch gleich, ob es der eine oder der andere ist: Es sind die neuen Milliardäre, die unsere Raumfahrer ins All schicken.
Elon Musk hat anstelle des amerikanischen Staats die Risiken auf sich genommen und ist dafür reichlich bezahlt worden. Dieser zugleich südafrikanische, kanadische und US-amerikanische Unternehmer, 246 Milliarden Dollar reich, ist in einem Jahrzehnt ein Weltraumgigant geworden. Für ihn sind die kleinen Reisen zur Raumstation und zurück nur der Gruß aus der Küche: Was ihn interessiert, sind die riesigen Raketen, die die Menschen morgen zum Mond und dann zum Mars bringen sollen. Denn er hat beschlossen, den roten Planeten zu unserem »Ersatzplaneten« zu machen. Ein jungfräuliches Gebiet, ein neuer Wilder Westen, wo die Kühnsten herrschen und das Gesetz diktieren, denn es gibt dort keinen Staat. Die NASA (also die amerikanischen Bürger) ermöglicht seine Träume vom Mars, indem sie die Entwicklung seiner Starship-Mondfähren finanziert.
Elon mag keine Regulierungen, keine gegebene Ordnung. Er glaubt nur an Talent, Geschwindigkeit, Willenskraft. Nicht nur bei Autos oder Raketen. Ein Drittel der Telekommunikationssatelliten, die die Erde umkreisen, gehört ihm. Er hat sie ins All geschossen, ohne irgendwen um Erlaubnis zu fragen. Sein Prinzip: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Umso schlechter für Europa, wenn es keine Anstalten macht, seine eigenen hinaufzuschicken. Er kennt nur das Recht des Stärkeren. Europa kann da nicht mithalten.
Starlink entscheidet den Krieg in der Ukraine
Dank ihm kann es die Ukraine mit der russischen Armee aufnehmen. Er fabriziert weder Caesar-Haubitzen noch Leopard-Panzer ... doch seine Satelliten sind entscheidend für diesen Krieg des 21. Jahrhunderts. Er hat der ukrainischen Streitmacht erlaubt, sie für ihre digitalen Kampfsysteme in Anspruch zu nehmen, sie für die Beobachtung zu nutzen, dafür, Artillerieangriffe zu koordinieren, und dafür, dass operative Einheiten mit den Stäben kommunizieren können. Wenn Drohnen, Kameras, Videoaufnahmen und die Feindbeobachtung genauso viel zählen wie die Zahl von Panzerdivisionen, ist die Verfügbarkeit des Internets von vitalem Interesse.
Wenn Elon Musk den Ukrainern nicht sein Starlink-System – diese Hunderte von Satelliten, die zu zahlreich sind, als dass sie alle ausgeschaltet werden könnten, und die dazugehörigen Stationen – zur Verfügung gestellt hätte, hätten die Russen ihren ukrainischen »kleinen Bruder« schon im ersten Anlauf vernichtet. Dank seines Netzwerks konnte Kiew seinen Krieg führen. Doch könnte der Milliardär, vielleicht auf die Bitte von Wladimir Putin hin, zu dem er Kontakte pflegt, in bestimmten besonders umkämpften Gebieten im Süden die Verbindungen gekappt haben. Ohne Internetzugang herrschte bei den Ukrainern dort gerade, als sie zum Angriff übergehen wollten, totales Chaos. Heute zittern die Offiziellen im Pentagon bei der Vorstellung, Musk könnte sich aus der Ukraine zurückziehen.
Um zu verhindern, dass Russland sich das Land einverleibte, konnte die Armee von Wolodymyr Selenskyj auch auf Technologien von Google, Microsoft, Amazon oder Meta zurückgreifen, die kein Staat ihr hätte bieten können. Der Mythos von der politischen Neutralität der Internetgiganten ließ sich bald nicht mehr halten. Die ukrainische Regierung wurde über die ersten Cyberangriffe informiert, weil Microsoft das Weiße Haus alarmiert hatte. Seitdem beherbergen die Clouds von Microsoft und Amazon die ukrainischen Bevölkerungsregister und die Steuerunterlagen des Landes. Google spielt eine zentrale Rolle bei der Geolokalisierung, während YouTube und Facebook für den Kampf gegen Desinformation eingesetzt werden. Die Gesellschaften der sechs Milliardäre haben sich in der zivilen wie militärischen Elektronik der Ukraine festgesetzt.
Was das bedeutet? Alle Daten zu den Bürgern sind für die Big Tech frei zugänglich. Um die dringendsten Aufgaben erfüllen zu können, geben die Ukrainer ihre Souveränität auf ...
Die Digitalgiganten haben im Ukrainekonflikt eine Bedeutung gewonnen, die politische Fragen aufwirft. Sie arbeiten gegenüber den amerikanischen Regierungsstellen transparent. Wenn wir General Bonnemaison glauben, dem Kommandanten des französischen ComCyber, der im Dezember 2022 in der Nationalversammlung angehört wurde, ist das, was eine verbündete Macht aufbieten könnte, nicht vergleichbar mit den Mitteln, über die die Milliardäre verfügen – an Technikern, Material, Investitionsvolumen oder Forschungskapazitäten. Natürlich, der Boden, das Meer und die Luft werden von den nationalen Armeen kontrolliert, doch der Cyberspace ist wie der Weltraum weitgehend von privaten Unternehmen beherrscht. Der Privatsektor spielt also eine vitale Rolle in der Verteidigung eines Landes – und er legt, ob man das will oder nicht, einige Spielregeln fest.
Musk entscheidet über »Gut« und »Böse«
Derselbe Elon Musk, Herr über Raumfahrt und E-Autos, hat für 44 Milliarden Dollar Twitter gekauft und es in X umgetauft. Damit hat er die Hand auf ein gigantisches Influencer-Netz mit 350 Millionen Nutzern gelegt. Auf diesem neuen Terrain hat er zunächst einmal die »Zensur« beseitigt, deren »Opfer« Donald Trump und Kanye West geworden waren, nachdem sie dort lange Zeit zu Hause gewesen waren. Der ehemalige Präsident twitterte dort seine Fake-Informationen und brachte die Demokratie in Gefahr, als er seine Anhänger dazu aufrief, das Kapitol zu stürmen. Und der Rapper provozierte dort am laufenden Band und klopfte antisemitische Sprüche. Trump, der seinen eigenen Social-Media-Kanal besitzt, kehrte erst am 24. August 2023 zu dem zurück, was inzwischen X hieß, und zwar mit seinem mug shot, dem Po- lizeiphoto, das gegenüber Gerichten seine Identität festhielt. Inzwischen twitterte auch Kanye West wieder, und Musk musste ihn erneut zensieren: Der Rapper konnte sich nicht zurückhalten, die Nazis reinzuwaschen und seiner Bewunderung für Hitler Ausdruck zu verleihen. Diese Zensur wie auch das, was zugelassen wurde, wirft allerdings eine Frage auf: Natürlich kann man Kanye West nicht verteidigen, aber ist es normal, dass Musk die Sache ganz allein entscheiden konnte? Kurz nachdem er das Netzwerk gekauft hatte, hatte er die Konten von einem Dutzend Journalisten gesperrt, von der New York Times bis zur Washington Post, deren Schuld darin bestand, dass sie den Standort seines Privatjets enthüllt, also seine Privatsphäre verletzt hatten. Kann Elon Musk also für den ganzen Planeten dekretieren, was als »gut« und was als »böse« zu gelten hat? So wie Marc Zuckerberg, der ganz allein entschieden hat, das Facebook-Konto von Donald Trump zu sperren? Doch wer kann über Gut und Böse ent- scheiden, wenn nicht Gott, für die, die an ihn glauben? Oder auch eine Versammlung von Richtern als Repräsentanten der Bürger?
Es ist nicht das erste Mal, dass das Weiße Haus sich mit Geschäftsmännern auseinandersetzen muss, die Schüsselsektoren der Wirtschaft beherrschen; früher waren das die Eisenbahnen, die Ölindustrie oder der Telekommunikationssektor. Doch der Unterschied zwischen unseren Milliardären und den robber barons, den Raubrittern des 19. Jahrhunderts, besteht darin, dass Musk wie Zuckerberg über eine Technologie und ein Medium verfügen, die, wenn sie es wollen, ihr eigenes Netzwerk und ihre eigene Senderkette werden und von dort aus unmittelbar ihre politischen Ideen verbreiten.
Hält sich Musk selbst für den Schöpfer, wenn er Implantate in Gehirne von Affen oder Schweinen – und sicher bald auch menschlichen Freiwilligen (das ist 2024 bereits geschehen, d. Übers.) – einsetzen lässt, durch die die Hybridisierung von Mensch und Maschine vorangebracht werden soll, damit die Menschheit mit der künstlichen Intelligenz »mithalten« kann?
Dieser seltsame und extravagante Patron ist nicht der einzige seiner Art. Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, versucht wie er mit seiner Blue-Origin-Rakete mit der NASA ins Geschäft zu kommen, seit die USA das Schicksal ihrer Astronauten diesen Milliardären anvertrauen müssen, denen die Welt längst viel zu klein ist. Auch er bemüht sich um Weltraumtourismus mithilfe von Verträgen mit öffentlichen Institutionen, nur allzu glücklich darüber, dass die Vereinigten Staaten ihre eigenen Initiativen aufgegeben haben angesichts der technischen Herausforderungen – bis dahin, dass sie sich nicht mehr scheuten, die Russen von Sojus um Hilfe zu bitten. Die NASA vertraut selbst die Raumanzüge der Astronauten, die als Nächste auf dem Mond herumlaufen werden, der Privatwirtschaft an; sie werden, so heißt es, mehr als 1 Milliarde Dollar das Stück wert sein: Washington wird sie deshalb nicht entwerfen lassen, sondern mieten!
Bezos sieht uns schon in O’Neill-Kolonien
Auch der größte Internethändler hat einen großen Plan für die Menschheit: das O’Neill-Projekt. Jeff Bezos träumt davon, die Bevölkerung unseres erschöpften Planeten in »O’Neill-Zylinder« umzusiedeln, benannt nach dem amerikanischen Physiker Gerard K. O’Neill. Es handelt sich um mehrere Kilometer lange riesige Zylinder oder Kapseln, die im All schweben und in denen es Städte und Felder geben könnte.
Für die nähere Zukunft hat der Amazon-Gründer begonnen, sich auf einem der Felder zu versuchen, auf denen der amerikanische Staat nur schwach vertreten ist: dem Gesund-heitswesen. Das ist ein Gebiet von schnell zunehmender Bedeutung, und die Webmilliardäre besitzen so viele Nutzerdaten, dass sie meinen, diese Goldmine ausbeuten zu müssen. Es ist leicht zu erraten, dass derjenige, der die Gewohnheiten seiner Kunden kennt – ihre Ernährungsweise, ihre Lebensverhältnisse, ob sie Sport treiben oder nicht, auch die Ärzte, zu denen sie gehen –, die guten Versicherten leicht von den weniger guten unterscheiden kann und sie eines Tages entsprechend wird zahlen lassen können. Er kann die Daten auch an Versicherer verkaufen, an Banken und Arbeitgeber. Bezos hat es mit Amazon Care versucht, musste allerdings mangels Rentabilität 2022 den Rückzug antreten. Aber nur vorläufig.
Jeff Bezos ist nicht der einzige Milliardär, der ein Auge auf die Gesundheit der Menschen geworfen hat, in der Annahme, damit besser umgehen zu können als Staaten oder öffentliche Einrichtungen: Bill Gates, der Gründer und Entwickler von Microsoft, hat beschlossen, seinen »Ruhestand« und sein Vermögen im Weltmaßstab für philanthropische Zwecke zu nutzen, in der großen Tradition amerikanischer Milliardäre, doch mit vervielfachtem Einsatz.
Bill Gates ist Teil der weltweiten Gesundheitsfürsorge. Der Microsoft-Gründer hat seinen Sitz in der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, deren zweitgrößter Geldgeber er mit 751 Millionen Dollar im Jahr ist, weit vor Deutschland, Frankreich oder China. Als Präsident Trump seinerzeit entschied, dass die USA sich aus der WHO zurückziehen und nicht mehr darin einzahlen würden, schlug der mächtigste Rentner der Welt vor, die Bill-&-Melinda-Gates-Stiftung könne ihre Zahlungen übernehmen. Er ist heute unverzichtbar beim Kampf gegen Polio und Malaria in Afrika und hat Hunderte von Millionen Dollar für die Erforschung und gerechte Verteilung eines Impfstoffs gegen Covid-19 aufgewendet.
Bill Gates herrscht über die Weltgesundheit
Gates wendet bei den Impfkampagnen dieselben strengen Methoden an, die seit fünf Jahrzehnten seinen Erfolg in der Informatik garantiert haben. Er entscheidet, welcher Impf-
stoff am dringendsten gebraucht wird und welche Kinder in welchem Land unter welchen Bedingungen geimpft werden sollen. Die Staaten unterwerfen sich diesem Regime, sie haben keine andere Wahl. Es ist ja sein Geld, das der Stiftung, die er mit seiner Frau Melinda gegründet hat, von der er heute getrennt ist, die aber weiterhin neben ihm deren Botschafterin war. (Melinda Gates hat sich 2024 aus der Stiftung zurückgezogen, um sich ihren eigenen Wohltätigkeitsprojekten zu widmen, d. Übers.) Was Gates schafft, ist wirklich außergewöhnlich – doch es gibt Stimmen, die ihm vorwerfen, alleine zu entscheiden, ohne dass es ein Gegengewicht gibt. Es stimmt, dass er niemandem Rechenschaft schuldet und dass niemand seine Auswahlkriterien kennt, die Prinzipien, nach denen er in dem einen oder dem anderen Land tätig wird. Es gibt keine demokratische Kontrolle über sein philanthropisches En- gagement. Man wirft ihm vor, welchen Einfluss er über die WHO inzwischen hat. Für manche ist er faktisch deren Chef geworden.
Bill Gates ist im Netz stets schlecht behandelt worden, was vielleicht an der Erinnerung an die Zeit liegt, als Microsoft noch ein Monopol hatte und gegen seinen Konkurrenten Apple wie Goliath gegen David auftrat. Heute klagen Verschwörungstheoretiker ihn an, er habe gewusst, dass die Covid-19-Pandemie ausbrechen würde. Er hatte in der Tat die Behörden weltweit gewarnt, dass die Gefahr uns drohte – und folglich, so die Verschwörungstheoretiker, muss er sie selbst herbeigeführt haben.
Sergey Brin und Larry Page, die Erfinder von Google wiederum, wollen sich nicht auf Impfungen beschränken: Sie wollen den Menschen unsterblich machen. Noch nie hat ein Staatschef eine solche Ambition gehabt. Sie würden es gerne besser machen als Gott, und zwar auch gegen dessen »Willen«. Diese beiden Libertären haben einen Teil ihres Vermögens in dieses äußerste Ziel investiert: das Altern und den Tod abzuschaffen. Dieser Herausforderung widmet sich die Biotechfirma Calico (California Life Company), deren Sitz der Veteran’s Boulevard (einen besseren Namen hätte man nicht erfinden können) in San Francisco ist.
Sie könnten ihr Geld auch in die Krebsforschung stecken, doch das interessiert sie nicht. Für sie wäre das nicht ambitioniert genug, denn das würde den Menschen nicht mehr als drei Jahre zusätzlicher Lebenserwartung bringen. Was sie wollen, ist »den Tod töten«. Calico forscht also über den Prozess des Alterns. Die Vizepräsidentin des geheimnisvollsten Unternehmens von Alphabet (wozu auch Google gehört) ist Cynthia Kenyon, eine Forscherin, die sich 1993 dadurch einen Namen gemacht hat, dass es ihr gelang, die Lebenszeit eines Wurms, C. elegans, durch eine genetische Manipulation zu verdoppeln. Calico arbeitet auch mit Nacktmullen, einer Nagetierart, die länger lebt als andere.
Larry Page und Sergey Brin haben auch die transhumanistische »Singularity University« finanziert und deren Direktor Ray Kurzweil, ein Genie der neuronalen Netzwerke, dafür gewonnen, die Forschungen bei Google zu leiten. Kurzweil ist überzeugt, dass unsere Spezies ihre biologischen Grenzen sprengen und mit Maschinen fusionieren muss, um Unsterblichkeit zu erreichen: Wenn wir den Inhalt des Gehirns auf einen Roboter überspielen können, brauchen wir unsere provisorischen Körper gar nicht mehr! Page und Brin haben sich mit niemandem beraten und nicht die Mühe gemacht, eine Ethikkomission einzurichten, bevor sie diese Programme gestartet haben.
Nur die Reichsten werden unsterblich sein
Anders als Staaten, die sich an Gruppen von »Weisen« wenden und eine demokratische Diskussion organisieren, bevor sie Entscheidungen fällen, die künftige Generationen betreffen und die menschliche Spezies verändern könnten, glauben die Tech-Milliardäre, dass alles, was möglich ist, auch gemacht werden soll und dass das, was gut für sie, auch gut für uns ist. Der Tod ist ein Problem, und für jedes Problem gibt es eine Lösung. Unabhängig von den damit verbundenen ethischen Problemen wäre es naiv zu glauben, dass das Elixier der ewigen Jugend, wenn sie es denn finden, universell zugänglich wäre. Wie immer werden nur die Reichen es sich leisten können. Die Gründer von Google sind auch Mitglieder des sehr geschlossenen Klubs der führenden internationalen Unternehmen der künstlichen Intelligenz, nachdem sie DeepMind gekauft haben, den britischen Champion auf diesem Gebiet. Ihnen gehörte auch ihre eigene Abteilung für KI-Forschung, GoogleBrain. Sie haben beides fusioniert, zweifellos um die stärkste Position im Wettlauf zur Allgemeinen Künstlichen Intelligenz zu haben, einer Intelligenz, die zumindest gleich intelligent wäre wie der Mensch.
Mark Zuckerberg ist der letzte dieser Milliardäre, die mächtiger sind als ganze Staaten – und nicht der am wenigsten einflussreiche. Der Chef von Facebook und Instagram hat Informationen über 3 Milliarden Menschen, ein Drittel der Bewohner unseres Planeten, und zwar das kaufkräftigere Drittel. Und er weiß, wie man diese Menschen beeinflussen kann. Keine Diktatur der Welt könnte dies in dieser Größenordnung. Bei der Affäre um Cambridge Analytica stellte es sich heraus, dass er dieses wertvolle Wissen auch ohne Skrupel ausgebeutet hat. Facebook hat tatsächlich die Profile seiner Abonnenten einer Organisation überlassen, die in der Lage war, deren Stimmabgabe durch zielgerichtete Nachrichten zu steuern.
Die Whistleblowerin Frances Haugen, eine ehemalige Facebook-Angestellte, hat auch gezeigt, dass das Unternehmen »seine Profite mit unserer Sicherheit finanziert hat«. In der Tat ließ ein Datenanalytiker von Facebook Anfang November 2020, wenige Tage nach dem Sieg von Joe Biden über Donald Trump im Präsidentschaftswahlkampf, seine Kollegen wissen, dass 10 % der auf der Plattform gestreamten politischen Inhalte Meldungen waren, in denen es hieß, die Wahl sei gefälscht worden. Dieses auf Facebook verbreitete und dann von Donald Trump bis zum Erbrechen immer wiederholte jeder Grundlage entbehrende Gerücht führte am 6. Januar 2021 zum Sturm auf das Kapitol. Anhänger des ehemaligen Präsidenten drangen in den Kongress ein, als der Sieg von Joe Biden bestätigt werden sollte, und fünf Personen fanden dabei den Tod.
Der Gründer von Facebook und die Gründer von Google besitzen noch eine andere enorme Macht: Sie bestimmen über Leben und Tod der Medien und damit der Demokratie. Ihre beiden Firmen allein ernten zwei Drittel der Werbeeinnahmen im Internet, zum Nachteil der Medien, die gleichwohl für die Inhalte sorgen. Sie haben sich geweigert, für die Verbreitung von deren Artikeln zu zahlen, entgegen dem, was das europäische Recht ihnen vorschreibt. Damit missachten sie die Souveränität der Staaten und verstoßen gegen demokratische Prinzipien. In manchen Ländern wird bis heute darum gerungen. Doch obwohl die imperialistische Strategie dieser Männer das Gleichgewicht der politischen Kräfte bedroht, haben die Staaten zu spät begriffen, dass sie ihre destruktive Macht unterschätzt haben.
Wie konnten sich diese übermächtigen Unternehmer über die Leiter und Besitzer traditioneller Unternehmer erheben? Wie haben sie unser Leben verändern können, zum Besseren und öfter noch zum Schlechteren? Liegt das daran, dass sie »Träume« haben, ganz große Pläne, den Willen, die Welt nach ihrem Willen neu zu schaffen? Die Chefs von Procter & Gamble, von Volkswagen oder Vuitton brüsten sich nicht damit, das Leben der Menschen auf eine neue Stufe zu bringen. Unsere »Supermen« aber haben sich dieser gleichsam messianischen Aufgabe verschrieben. Sie halten sich für die Retter der Welt.
Jugendliche in großer Gefahr
Und dennoch! Sie haben sie während der Covid-Pandemie nicht gerettet. Abgesehen einmal von Bill Gates – der sich dies in seinem zweiten Leben zur Aufgabe gemacht hat – haben sie nichts dazu beigetragen, Impfstoff zu finanzieren oder zu verteilen. Sie haben sich damit begnügt, Geld zu verdienen. Denn angesichts von Zwangslockdowns wurde das Internet unverzichtbar, um zu kommunizieren, einzukaufen, Filme anzusehen, im Homeoffice zu arbeiten oder Geschäftsreisen in Form von Videokonferenzen zu absolvieren ... Sie können dieser seltsamen Grippe, zu deren Bekämpfung sie nichts beigetragen haben, nur danken: Sie hat es den Tech-Konzernen erlaubt, in wenigen Monaten ein Maß der Durchdringung der Wirtschaft zu erreichen, für das sie normalerweise 20 Jahre gebraucht hätten. Die Verkäufe bei Amazon, die medizinische Betreuung im Internet und die Onlinekonferenzen auf Google Meet oder seinen Entsprechungen Zoom oder Teams sind explodiert. Damit haben die Tech-Giganten uns einen Dienst erwiesen, das ist wahr, aber vor allem haben sie sich um Milliarden bereichert. Die Profite von Amazon und Facebook haben sich im zweiten Drittel des Jahres 2020 gegenüber dem Vorjahr schlicht verdoppelt.
Nicht nur, dass diese Unternehmen die Welt nicht »besser« machen; im Gegenteil, sie verändern sie, indem sie die Demokratie gefährden. Die sozialen Netzwerke von Facebook bis X tragen in hohem Maße die Verantwortung für das Anwachsen von politischer Aggressivität und Populismus. Ihre Algorithmen verleiten dazu, in immer größerem Maße hundertprozentige Überzeugungen oder provokante Ansichten zu verbreiten und dadurch die einzelnen User-Communities in einer ungesunden ideologischen Isolation zu belassen. Mit diesen Maschinen, die die gesellschaftliche Spaltung vorantreiben, verheert die politische Polarisation die Öffentlichkeit in den USA wie in Europa.
Vielleicht noch schlimmer ist, dass die sozialen Netzwerke einen verhängnisvollen Einfluss auf die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen haben, die täglich zu viele Stunden am Bildschirm verbringen, was ihre intellektuelle Entwicklung behindert. Wie wir sehen werden, ist es kein Zufall, dass die meisten Chefs von Tech-Unternehmen ihren Kindern den Besitz eines Smartphones untersagen, bevor sie 14 sind, und die Zeit beschränken, die ihre jugendlichen Kinder im Web verbringen dürfen. Oft geben sie sie auch auf Schulen, in denen keine Bildschirmgeräte zugelassen sind.
Facebook und seinesgleichen haben bei Psychologen Studien in Auftrag gegeben und Forschungen veranlasst; sie wissen besser als sonst wer, dass eine hochdosierte Nutzung der So- cial Media bei Jugendlichen einen Verlust von Lebensfreude nach sich zieht, Depressionen auslöst und sogar zu Selbstmorden führen kann. Sie wissen auch, dass »Schönheitsfilter«, mit denen man seine Photos auf Instagram verbessern kann, die Zahl der chirurgischen Schönheitsoperationen bei den 18- bis 30-Jährigen explodieren lassen, die davon träumen, auszusehen wie ihr retuschiertes Bild. Sie sind dabei, für eine Generation von frustrierten und psychisch instabilen Erwachsenen zu sorgen – und tun dies bewusst, um ihre Profite zu mehren. Die Generation der Jugendlichen von heute, die das Opfer davon ist, zahlt den Preis für die Selbstaufgabe der öffentlichen Gewalten gegenüber den Plattformmilliardären. Das Wirt- schaftsmodell von Facebook, YouTube, Instagram, TikTok und Co ist in sich korrupt, weil ihr Erfolg proportional zu ihrem Suchteffekt und der Zahl der Abhängigen wächst. Ihre Rentabilität zu maximieren, setzt den Überkonsum ihrer Dienste voraus. Wir stehen hier, man wird es sehen, vor einem größeren Problem der öffentlichen Gesundheit.
Sie müssen sich nicht alle vier Jahre zur Wahl stellen
Alle diese Männer mit ihrer maßlosen Macht treffen sich mit den Staatschefs, meist auf deren Bitten, und verhandeln mit ihnen von Gleich zu Gleich. In Wahrheit verdienen sie hundertmal mehr als diese, sind tausendmal reicher, und ihre Macht ist vor allem viel weniger vergänglich: Sie können nicht bei jeder Wahl abgesetzt werden. Anders als gewählte Volksvertreter sind diese Milliardäre nicht »von Hindernissen eingezwängt«, wie Musk das genannt hat, um zu rechtfertigen, dass er seinen Job dem eines Staatschefs vorzieht. Manchmal gehen sie auch so weit, sich in das Spiel der Diplomatie einzumischen: Derselbe Musk hat es für gut befunden, der Öffentlichkeit seinen Plan für einen Frieden in der Ukraine (günstig für Russland) vorzustellen und ein noch unrealistischeres Statut für Taiwan (das China begünstigt) zu unterbreiten, sehr zum Missfallen von Washington, das die Freiheit der Insel unterstützt und sie im Fall einer militärischen Invasion Chinas verteidigen will. Musk hat seine pragmatischen Gründe, China zu schmeicheln: China ist ein riesiger Markt für seine Firma Tesla; er besitzt da eine riesige Fabrik und möchte sie behalten, auch wenn die chinesisch-amerikanischen Beziehungen sich verschlechtern. Peking wiederum ist darüber beunruhigt, dass Musk sich mit seinen Starlink-Satelliten eines Tages in seinen Konflikt mit Taiwan einmischen könnte, wie er es in der Ukraine getan hat.
Dass Elon Musk sich für einen ausgezeichneten Diplomaten hält, ist nicht weiter verwunderlich. Manche Länder schicken Botschafter zu den Tech-Magnaten und erkennen damit implizit auch deren Exterritorialität an.
Als Dänemark 2017 einen »Botschafter bei den Großen von Silicon Valley« ernannte, erkannte das Land de facto an, dass diese Menschen die Macht von Staaten besitzen und dass man ihre Besitzer und Leiter als Superstaatschefs behandeln muss. »Wenn Sie betrachten, welchen Einfluss diese Unternehmen auf Sie oder mich haben, werden Sie feststellen, dass viele von ihnen mehr Einfluss haben als die meisten Nationen«, rechtfertigte das der erste Botschafter, Casper Klynge, nach seiner Ernennung durch das dänische Außenministerium.
Doch indem sie diese »übernationalen« Firmen wie Staaten ohne Territorium behandelten, erkannten die Skandinavier auch an, dass es für sie kein fiskalisches Territorium gibt. Wenn Google oder Amazon regelrechte Staaten sind, wenn auch ohne ein Gebiet, ist der US-amerikanische Staat nicht mehr für sie zuständig. Warum sollten sie dann in den Vereinigten Staaten oder den anderen Ländern, in denen sie aktiv sind, Steuern zahlen? Da sie übernational sind, ist es nur logisch, dass sie sich in Ländern niederlassen, in denen ihre Profite wenig oder überhaupt nicht besteuert werden. Sie setzen eine neue internationale Wirtschaftsordnung durch, in der es keine Grenzen mehr gibt und die Staaten ohnmächtig sind.
Europa erlegt ihnen Strafen auf, und die USA drohen damit, sie zu zerschlagen, doch die entsprechenden Bemühungen sind noch weit von ihrem Ziel entfernt. Um zu verhindern, dass es neue Normen oder Reglementierungen gibt, die ihnen nicht passen, beschäftigen sie ganze Armeen von Lobbyisten – Hunderte von mit gewaltigen Mitteln ausgestatteten Experten und Juristen –, um diese Prozesse endlos zu diskutieren, zu verzögern und zu zerreden. Sie intervenieren auf diese Weise bei der Formulierung der sie betreffenden Gesetze. Sie scheinen in einer höheren Sphäre zu schweben als die geschwächten Nationalstaaten, die stets zu spät dran sind.
Der Rückzug der Demokratie
Aber sind sie im Grunde genommen nicht vor allem dadurch geschützt, dass sie too big to fail sind, zu groß, um scheitern zu dürfen? Wie manche Banken während der Subprime-Krise sind sie zu schwergewichtig und zu wichtig für die Struktur der Gesamtwirtschaft, als dass man sie fallen lassen könnte: Sie würden ganze Teile der Wirtschaft mit sich reißen – und das ganze System der amerikanischen Informatik. Deshalb sind sie geschützt und so gut wie unbesiegbar; sie anzugreifen, wäre ein systemisches Risiko.
Heute, am Anfang des 21. Jahrhunderts, sind wir Zeugen einer Verschiebung des Gravitationszentrums der Macht hin zu einem halben Dutzend Männer und ihren firmes-monde, Weltfirmen im Sinne von Fernand Braudel, das heißt ökonomischen und politischen Entitäten, deren Supermächtigkeit vernünftig reguliert werden sollte.
Für Richard Walker, Professor an der University of California in Berkeley, sind wir heute nur »Spielzeuge der Milliardäre, weit mehr noch als der Großunternehmen, die für das 20. Jahrhundert prägend waren«.
Je mehr Einfluss sie auf die Staaten haben, desto weniger herrscht Demokratie, desto mehr bleiben die Entscheidungen willkürlich und wachsen die Verzerrungen der Realität. Denn wir haben keine Kontrolle über sie. Das heißt, jedes dieser Unternehmen hat auf seinem Gebiet den Schlüssel zu unserer Zukunft in der Hand. So wie nicht jeder sich einen Sportwagen oder eine Yacht oder auch eine Reise in den Weltraum (das erste Ticket für einen kleinen Ausflug ins All mit Jeff Bezos an Bord der Blue Origin ist für 28 Millionen Dollar bereits verkauft worden) leisten kann, wird sich auch nicht jeder ein verlängertes Leben oder ein erweitertes Gehirn leisten können. Bis heute hing die Lebensdauer und vor allem die Intelligenz nicht von den finanziellen Möglichkeiten der Einzelnen ab, was auch einen sozialen Aufstieg (mehr oder weniger gut) ermöglichte. Doch mit ihnen wird alles schlechter werden.
Was also tun? Es kann nicht darum gehen, sie zu vernichten, denn ihre Entwicklung und ihre Kreativität dienen dem wirtschaftlichen und technologischen Fortschritt. Indem es seine Tech-Giganten kontrolliert, hat China dazu beigetragen, den Rhythmus seiner wirtschaftlichen Erholung nach der Pandemie zu verlangsamen, und riskiert so, niemals, wie es das geplant hat, die erste Weltmacht zu werden. Doch trotzdem kann man nicht »den freien Fuchs im freien Hühnerstall« machen lassen, was er will. Dass die Herrscher über die sozialen Netzwerke alles über uns wissen wollen, rechtfertigen sie damit, dass sie ihre Dienstleistungen verbessern, also uns glücklicher machen wollen (selbst wenn wir das gar nicht wünschen). Die Menschen sind mit dieser Aneignung einverstanden, denn warum sollten sie etwas zurückweisen, was man ihnen gratis anbietet: Informationen, die auf ihre Interessen zugeschnitten sind, Kontakt zu den Leuten, die ihnen ähneln, unbegrenzte Informationsmengen, stets mehr als sie wollen? Man weist das »Glück« nicht zurück – auch wenn jeder weiß, dass das Produkt nur deshalb umsonst zu haben ist, weil man selbst ein Teil davon ist. Das Risiko der Desinformation, also die politische Gefahr, ist gewaltig, wenn mehr als die Hälfte der Bevölkerung ihre Informationen ausschließlich aus den sozialen Netzwerken bezieht.
Die »Räuberbarone« des 21. Jahrhunderts
Gleich, ob wir ihr Angebot annehmen oder nicht – wir müssen Bedingungen für ihre weltweite Entwicklung stellen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass diese neuen Riesen- unternehmen sich nicht ihrer Pflicht gegen den Fiskus entledigen können. Sie müssen die Steuern zahlen, die sie schuldig sind. Ferner dürfen sie sich nicht einfach jede Konkurrenz vom Hals halten: Sie müssen die jungen Unternehmen leben lassen, die zu ihren Rivalen werden können, und dürfen nicht auf die Dauer Monopoleinnahmen erzwingen. Sie dürfen auch nicht die Gesetze zum Schutz des Privatlebens missachten: Alle Bürger müssen ihre persönlichen Daten nachverfolgen und über sie verfügen können. Schließlich dürfen diese »supranationalen« Mächte nicht die Prinzipien der öffentlichen Gesundheit brechen: Was sie an Inhalten anbieten, muss so reguliert sein, dass diese nicht mehr die mentale Gesundheit der Heranwachsenden gefährden. Eine Generation ist zweifellos schon verloren.
Die »Räuberbarone« des 21. Jahrhunderts haben die Macht ergriffen, aber wessen Fehler war das? Sie haben einfach Macht ergriffen, wenn ihre Fähigkeiten es ihnen erlaubt haben. Doch ihr Aufstieg war nicht alternativlos: In China zum Beispiel waren Larry Page und Sergey Brin mit Google nie sehr erfolgreich. Da die Regeln dort äußerst streng waren, haben sie 2010 eine zensierte Version ihrer Suchmaschine fabriziert, die dann jedoch wieder zurückgezogen, als das in den USA einen Aufschrei auslöste. China ist gewiss kein Rechtsstaat, doch die Vereinigten Staaten oder die Europäische Union bräuchten gar nicht so weit zu gehen, die chinesischen Me- thoden anzuwenden; sie besitzen auch jetzt schon Gesetze, die eine derartige Hegemonie verhindern könnten. Die amerikanische Regierung und in ihrem Gefolge auch Europa machen einen Fehler: Sie organisieren ihre eigene Abdankung. Doch es ist noch nicht zu spät, um den Versuch zu unternehmen, die Schäden wiedergutzumachen, die die neuen Hegemonen bereits angerichtet haben, ... und die zu verhindern, die sie erst anrichten wollen.