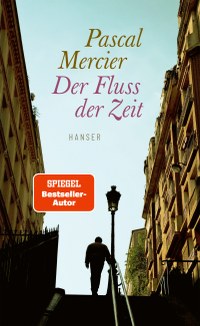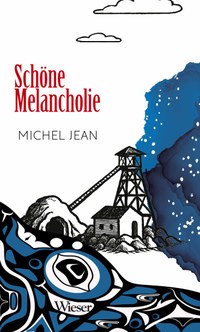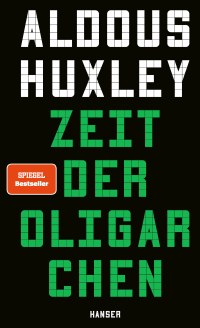Das Leben offenbart sich im Schmerz
Ich sitze im Wartezimmer der Station für leichte Verletzungen am Llandrindod Wells Memorial Hospital. Keine Menschenseele in Sicht. Draußen ist es kalt. Leichter Schneefall, wie schon seit einigen Tagen. Aber drinnen ist es schön warm. Das alte Gebäude knarzt ein bisschen, wie das bei alten Häusern eben so ist. Abgesehen davon ist es allerdings so verdammt still, dass ich mich fast schon frage, ob ich hier überhaupt richtig bin.
Es erinnert mich an einen bestimmten Ort, aber ich kann es nicht einordnen. Vielleicht das Krankenhaus, in dem ich, noch als Jugendlicher, meinen ersten Job hatte und am Ende jeden Arbeitstages im Operationssaal das Blut vom Boden wischen musste. Oder vielleicht war es auch das kleine Landkrankenhaus, in dem meine Mutter seinerzeit als Physiotherapeutin gearbeitet hat. Wie auch immer, es ist irgendwas Altmodisches. Aus längst vergangenen Zeiten. Aber wir haben Januar 2022. Also, was zum Teufel ist hier los? Vielleicht handelt sich in Mittelwales heutzutage niemand mehr leichte Verletzungen ein. Vielleicht ist es auch ein Post-Covid-Phänomen, überlege ich. Online hieß es klar und deutlich, man solle nicht einfach herkommen, sondern vorher anrufen. Ich bin froh, dass ich mich daran gehalten habe.
In der Erwartung, dass es etwas länger dauern könnte, hole ich mein Notebook aus der Tasche. Man hatte mich gebeten, eine Programmnotiz zum Start einer ungewöhnlichen Filminstallation des deutschen Künstlers und Filmemachers Julian Rosefeldt zu verfassen. In dem Stück geht es um die dystopische Natur des Kapitalismus. Trotzdem nennt er seinen Film Euphoria.[ii]
Sollten Sie zur Generation Z gehören, werden Sie bei dem Titel wahrscheinlich sofort an Sam Levinsons umstrittene und von der Kritik hochgelobte HBO-Serie gleichen Namens denken. Nichts für ungut, liebe Millennials, Generation X und Babyboomer. Sie sind vielleicht auch schon drauf gestoßen. Wenn ja, hat euch das Ganze vermutlich eine Heidenangst eingejagt angesichts der Welt, in der eure Kinder leben. So ging es mir jedenfalls. Allerdings bin ich, demografisch gesehen, nicht unbedingt die Zielgruppe.
Euphoria (die Serie) handelt von einer Gruppe amerikanischer High-School-Kids, die »in einer Welt von Drogen, Sex, Traumata und Social Media Liebe und Freundschaften finden«. Die erste Staffel lief 2019 und war ein Riesenerfolg. Die bis dahin eher unbekannten Hauptpersonen wurden augenblicklich zu Stars – mit Ausnahme von Zendaya natürlich, die bereits einer war. Doch ihre Rolle als Rue festigte ihren Status als »aufstrebende kulturelle Ikone« und brachte ihr diverse Emmys und einen Golden Globe ein.[iii]
In Geschichten und Filmen, aber auch im wirklichen Leben, bringt Euphorie eine gewisse Aufregung mit sich. Etwas, das unser Leben und Lieben über das Alltägliche hinaushebt. Etwas Erleichterndes, fast Transzendentes. Oft schwingen aber auch gefährliche Untertöne mit, so als ob wahres Glück immer einen Preis haben muss. Was es natürlich manchmal auch tut.
Dieses Gefühl der verlockenden Gefahr ist vermutlich der Grund, warum Psychiater Euphorie nicht einfach als Zustand von Glück oder Wohlsein definieren, sondern als »übertriebenes« Hochgefühl. Ein Gefühl, das unbegründet ist, in keinem Verhältnis zu seiner Ursache steht oder im Hinblick auf reale Ereignisse unangemessen scheint. So richtig gesund klingt das alles nicht.[iv]
Aber schauen Sie mal, was ich gerade herausgefunden habe: Im ursprünglichen Sinne leitet sich das Wort aus dem Griechischen ab. Eu- (εὔ) bedeutet »gut«, und phoros (φορος) steht für »(er)tragend«. Euphorie beschrieb einen Zustand der »Unbeschwertheit« oder auch ganz schlicht des »Gesundseins«. Noch nicht einmal etwas so Nebulöses wie »Glück« also, sondern pure, einfache Gesundheit. Ärzte verwendeten den Begriff schon im 17. Jahrhundert zur Bezeichnung eines günstigen Ausgangs klinischer Behandlungen – also Fälle, in denen ihre Patienten gut auf medizinische Eingriffe ansprachen. Das Gegenteil von Dysphorie. Wenn die vorherrschte, ging es offensichtlich bergab.
Ist Euphorie also in Wirklichkeit nur eine andere Art, über Gesundheit nachzudenken? Ist Gesundheit das, wonach Rue strebt? Oder ist Euphorie vielleicht eine übersteigerte Form von Gesundheit? Was würde das überhaupt bedeuten? Entweder du bist gesund oder nicht. Ich überlege angestrengt, ob irgendwas davon bei der Definition von Wohlstand als Gesundheit nützlich sein könnte, da geht plötzlich die Tür auf und eine Frau lugt ins Wartezimmer.
»Sind Sie der Mann, der über die Katze gestolpert ist?«
Sehr witzig.
Ich reagiere mit einem (hoffentlich) ironischen Lächeln und humple ihr in den Röntgenraum hinterher. Die Bilder bestätigen die Vermutungen: Ja, der Zeh ist gebrochen, nein, da kann man nicht viel machen. Zu der Zeit ist die Nachricht schon viral gegangen. Oder zumindest das Äquivalent von viral, soweit das in einem verlassenen alten Krankenhaus mitten im ländlichen Wales eben möglich ist.
Da sitze ich nun und lasse mir zeigen, wie man einen Zeh an den anderen bindet, als sich aus den vermeintlich leeren Fluren ein ganzer Strom von Leuten ergießt, von deren Anwesenheit ich bisher absolut nichts mitbekommen hatte. Und alle sind ganz scharf darauf, diesen Engländer zu verarschen, der über eine Katze gestolpert ist und sich dabei den Zeh gebrochen hat. Ich wollte gerade nicht über die Katze stolpern, versuche ich zu erklären. Mach’ dir keinen Kopf, sagen sie zu mir. Du bist jetzt in guten Händen. Llandrindod Wells ist ein ziemlich berühmter Kurort. Oder war es zumindest mal. In früheren Zeiten.
Gesundheit und Wohlstand
Wie der Name schon vermuten lässt, ist die Hauptattraktion von Llandrindod Wells das örtliche Quellwasser – die »Wells«. Die Leute kannten die Quellen schon seit Urzeiten. Doch Mitte des 18. Jahrhunderts erregten sie die Aufmerksamkeit des deutschen Arztes Diederich Wessel Linden, der die heilende Wirkung unbedingt an sich selbst ausprobieren wollte. Offenbar tat ihm das Wasser gut. Denn er beschloss, darüber zu schreiben. Sein 1756 veröffentlichtes Werk Treatise on the Three Medicinal Mineral Waters at Llandrindod in Radnorshire, South Wales machte das Örtchen Llandod (wie es die Einheimischen nennen) über alle Länder bekannt.[v]
Schon bald entwickelte sich das kleine, unscheinbare Dorf zu einem florierenden Kurstädtchen. Ein gefragtes Reiseziel. Ein Ort, wo diejenigen, die Zuflucht vor der rasanten Industrialisierung Britanniens suchten, sich entspannen, soziale Kontakte pflegen, ihre Beschwerden auskurieren und schließlich vor Gesundheit berstend wieder nach Hause reisen konnten. Ein halbes Jahrhundert später lockte Llandod Besucher aus ganz Europa an. Und mit ihnen kam ungewohnter Reichtum. Von der monetären Sorte. Wohlstand, wenn Sie so wollen – im herkömmlichen Sinne des Wortes.
Es sieht ganz nach einer Erfolgsgeschichte aus. Eine Kleinstadt, die Gesundheit zu Geld gemacht hat und davon massiv profitierte. Was sollte daran schlecht sein? Das ist gar nicht mal so weit entfernt von dem, was zum Beispiel Fidel Castro nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Sinn hatte. Kubas Gesundheitssystem wurde weltberühmt. Das Land verwandelte seine heimische Ärzteschaft in eine Art kulturellen Exportschlager. Sie reisten als Leiharbeiter um die ganze Welt, und im Gegenzug flossen ordentliche Erträge zurück in Castros Staatskasse.[vi]
Oder vielleicht ist die Cleveland Clinic ein besseres Beispiel? Die vor hundert Jahren in Cleveland, Ohio, gegründete Klinik exportiert heute medizinische Hightech à la USA in die ganze Welt. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Unterfangen. Die Einrichtung ist zwar offiziell nicht auf Gewinn aus, richtet sich aber eindeutig an die oberen Ränge. Was bedeutet, dass sie ihre Ärzte extrem gut bezahlen kann. Und das ist nicht immer und überall gern gesehen. In London warf man der Klinik vor, den National Health Service (NHS) zu sabotieren, weil sie Beraterhonorare von 400.000 Dollar und mehr anbot – und das für bloß ein paar Tage Arbeit in der Woche. Das entspricht einem Vollzeitgehalt von 1 Million Dollar pro Jahr. Noch nicht ganz die Gehaltsklasse eines Spitzenfußballers – oder eines Managers im mittleren Vorstand eines FTSE-100-Unternehmens. Aber immerhin das Fünffache dessen, was selbst die höchstdotierten Fachärzte im NHS verdienen können. Und jede Menge mehr als die 25.000 Dollar Jahresgehalt, die ein Arzt in Kuba erwarten darf. Also: ja, tatsächlich, das spielt in einer ganz anderen Liga.[vii]
Klar ist aber auch, dass Gesundheit etwas ist, das Menschen wertschätzen. Und sich manchmal sogar leisten können. Wenn Sie also in der Lage sind, daraus Kapital zu schlagen, können Sie einen ziemlich guten Schnitt machen. So wie Llandod. Jedenfalls für eine Weile. Heute ist die Stadt nicht mehr die blühende Metropole, die sie einmal war. Vielleicht rührt daher auch die unheimliche Stille auf der Station für leichte Verletzungen. Und das Memorial Hospital ist nun mal nicht die Cleveland Clinic. Obwohl. Um ehrlich zu sein, mittlerweile habe ich durchaus ein Faible dafür. Und für all das unerwartet freundliche und mitunter eine Spur zu sehr zur Schadenfreude neigende Personal.
In jedem Fall ist es ein passender Ausgangspunkt für meine Reise. Um meine Argumentation zu veranschaulichen, mein Anliegen vorzubringen. Zuerst also, dass Gesundheit zählt und Menschen sie wertschätzen. Zweitens, dass sie manchmal bereit sind, dafür tief in die Tasche zu greifen. Und wenn sie das tun, man leichtes Geld damit verdienen kann. Drittens, und das ist vielleicht der wichtigste Punkt von allen: Gesundheit und Reichtum sind zwei verschiedene Dinge. Wohlstand als Gesundheit zu begreifen, ist nicht dasselbe wie Gesundheit für Reichtum auszubeuten.
Wie auch immer man Wohlstand definieren möchte, es macht keinen Sinn, Gesundheit in finanziellem Erfolg zu messen. Manchmal ist es auch einfach grundverkehrt. Gesundheit lässt sich nicht immer in Geld umsetzen. Und selbst dort, wo es möglich ist, ist es nicht unbedingt eine gute Sache. Und das ist genau der Punkt: Gesundheit und materieller Wohlstand sind nicht dasselbe. Mitunter stehen sie sogar im Widerspruch zueinander. Wie ich hier darlegen möchte, geht es bei der Vorstellung von Wohlstand als Gesundheit nicht darum, bestimmte Arten wirtschaftlicher Aktivitäten durch andere als Quelle wirtschaftlichen Erfolgs und finanziellen Wohlstands zu ersetzen. Es geht darum, die Dinge von Grund auf anders zu denken. Und manches davon lässt sich am Beispiel der Wasserheilkur von Llandod ganz gut veranschaulichen.
Die Wasserheilkur
Die heilende Wirkung von kaltem Wasser ist in der Wissenschaft lange belegt. Das ist vielleicht auch gar nicht überraschend. Man munkelt immerhin, unsere entfernten Verwandten wären vor 500 Millionen Jahren aus dem Meer ans Land gekrochen. Dorthin zurückzukehren hat also immer etwas Kathartisches, seltsam Tröstliches, manchmal ist es sogar ein bisschen inspirierend. Die größte Wohltat für meinen Zeh während unseres Aufenthalts in Wales war sicherlich, barfuß durch die Wellen am Strand von Aberdyfi zu waten, nicht weit von unserer Unterkunft entfernt.
Offenbar wäre es mir sogar noch besser ergangen, wenn ich den Mumm gehabt hätte, gleich richtig einzutauchen. Aber so weit war ich an diesem Punkt meiner Reise noch nicht. Die Wassertemperatur in Wales liegt Mitte Januar kaum über 10 °C. Also ja: Im kalten Wasser schwimmen zu gehen, hielt ich in dem Moment noch für eine komplett verrückte Idee. Obwohl es bei Weitem nicht so verrückt war wie die Behandlungen in Lindens Abhandlung über die heilenden Wasser von Llandod.
Einiges darin war komplett durchgeknallt. Anderes sogar regelrecht gefährlich. Das Wasser sollte alles heilen, von Skorbut bis Lepra, von Geisteskrankheit bis zu »Erkrankungen des schönen Geschlechts«. (Sexismus ist auch nicht mehr das, was es mal war.) Baden, Abschrubben und Beinahe-Ertrinken wurden mit Aderlass kombiniert, während man zeitgleich das besagte Wasser trank (um den Blutfluss zu beschleunigen). Und manchmal wurden übelriechende Wässer in derart großen Mengen verabreicht, dass die Patienten buchstäblich daran starben.[viii]
Eines müssen wir dem deutschen Doktor zugutehalten: Er ist nicht mit allem einverstanden, was er sieht. Hauptsächlich beschreibt er einfach, was dort vor sich ging. Und manches davon mag durchaus positive Wirkung gebracht haben. Linden selbst glaubte jedenfalls fest daran, von seinen Beschwerden geheilt worden zu sein. Allerdings ist nicht ganz klar, wie ernst diese Beschwerden waren. Aber ein Teil des Wahnsinns war eindeutig der reinen Monetarisierung des Wunsches nach Gesundheit geschuldet, schlicht und einfach. Die skrupellose Ausbeutung von Menschen, die verzweifelt darauf aus waren, gesund zu werden, sich besser zu fühlen, ihre Schmerzen zu lindern. So etwas würde heutzutage nicht mehr passieren, oder?
Es ist so einfach, die Weisheit der Vergangenheit zu verdammen. Wir alle haben die Neigung, uns selbst für klüger zu halten als die Leute um uns herum. Psychologen sprechen vom superiority bias, der Selbsttäuschung eigener Überlegenheit. Aber wenn es um unsere Vorfahren geht, kommt noch der Einfluss einer kulturell tief verwurzelten Fortschrittsgläubigkeit ins Spiel. Es leuchtet uns ein, dass wir heute klüger sind als die Menschen gestern – schließlich ist das die Essenz von Fortschritt. So wird die Weisheit der Vergangenheit zwangsläufig als Dummheit abgetan.
Aus dieser Überzeugung ergibt sich jedoch eine unangenehme Schlussfolgerung, die man sich vor Augen halten sollte. Wenn das tatsächlich die Richtung des Fortschritts ist, dann gilt zumindest ein Teil unserer heutigen Weisheit morgen als Dummheit. Was sehr wohl bedeuten könnte, dass es eigentlich heute schon Dummheit ist. Exempel dafür sind mühelos zu finden. Aber lassen Sie mich nur ein Beispiel vortragen. Es geht um Schmerz. Oder genauer gesagt: um die Beziehung zwischen Schmerz, Schmerzbehandlung und Gesundheit.
Das Problem mit dem Schmerz
»Das Leben offenbart sich im Schmerz«, schreibt Boris Groys. In seiner faszinierenden Abhandlung über die Philosophy of Care (dt. Philosophie der Sorge) stellt er fest: »Jeder lebt in der Erwartung von Schmerz – und somit in der Erwartung des Verlustes der eigenen Welt.« Oder anders ausgedrückt: Schmerz ist hart. Deshalb hat alles, was ihn lindert, als gut zu gelten.[ix]
Es gibt einige Schmerzmittel, die sich über die Jahrhunderte hinweg besonders hervorgetan haben. Eines davon ist Opium. Wir kennen seine wundersame Wirkung schon seit jeher. Und aufgrund seiner ausgeprägten narkotischen Eigenschaften ist es auch sehr anfällig für Missbrauch. Das ist eine der Prämissen in Levinsons Euphoria. Den Schmerz loszuwerden – sowohl den psychischen als auch den körperlichen – scheint nur einen kleinen Schritt von der unerbittlichen Jagd nach Euphorie entfernt zu sein.
Die Geschichte dieser Jagd ist so faszinierend, wie sie erschreckend ist. Die erste Erwähnung des Schlafmohns belegt seinen Gebrauch bei den Sumerern in Mesopotamien vor mehr als 5.000 Jahren. Die Sumerer nannten ihn »hul gil«, die Freudenpflanze. Aus recht naheliegenden Gründen. Als die betäubende Wirkung von Opium immer bekannter wurde, verbreitete sich seine Anwendung über Asien bis nach Europa. Der griechische Arzt Hippokrates, der als »Vater der Medizin« bekannt ist und um das Jahr 400 vor unserer Zeitrechnung lebte, unterhielt einen vergleichsweise nüchternen Blick auf die Vorteile von Opium – und seine Risiken. Opium hat hochgradiges Suchtpotenzial.[x]
Als der Schweizer Arzt und Alchemist Theophrastus von Hohenheim, besser bekannt als Paracelsus, das Opium in einer Alkohollösung unter der Bezeichnung »Laudanum« in die westliche Medizin einführte, wurde es schnell zu einem Allheilmittel. In manchen Fällen war es durchaus angebracht. Oft aber ging es allein um den Wohlfühleffekt. Bisweilen wurde Opium auch Menschen empfohlen, die überhaupt nicht krank waren, um »das innere Gleichgewicht des menschlichen Körpers zu optimieren«. Was für eine coole Idee – wenn sie denn funktioniert hätte. Häufiger führte die übermäßige Verschreibung von Laudanum jedoch zu Abhängigkeit und Sucht.[xi]
Schon bald wurde der Gebrauch von Opium so wichtig, dass man es für nötig hielt, die Kontrolle über seine Produktion anzustreben. Mohnpflanzen gedeihen am besten in hoch gelegenen, trockenen Regionen, weshalb das meiste Opium entlang der Gebirgsketten von der Türkei bis nach Myanmar angebaut wird. Häufig sind es Kleinbauern in abgelegenen Gebieten, die sich dem Anbau widmen. Und diese Abgeschiedenheit bringt oft düstere Konsequenzen mit sich. Zum einen war es für die Regierungen praktisch unmöglich, den Opiumhandel zu unterbinden. Selbst wenn sie es ernsthaft versuchten. Zum anderen begünstigte die Isolation die Ausbeutung durch Menschen und Nationen, die über genug Macht verfügten, sie auszuüben.
Im 18. Jahrhundert übernahmen die Briten die Kontrolle über ein ausgedehntes Mohnanbaugebiet in Indien. Doch anstatt es stillzulegen, nutzten sie die East India Company, um ihr Produkt über die Seidenstraße – ein Netz von Handelsrouten zwischen Europa und Asien – nach China zu schmuggeln. Mit den Gewinnen wurden chinesische Luxusgüter wie Seide, Tee und Porzellan nach Europa importiert. Alles lief wie am Schnürchen, bis, nun ja, bis in den 1830er-Jahren die chinesische Regierung, alarmiert durch die steigenden Suchtraten, beschloss, den Handel zu beenden. Britannien hatte etwas dagegen. China beharrte auf der Schließung. Und so führten die beiden Länder schließlich zwei Opiumkriege, um die Sache zu regeln.[xii]
Damals war Großbritanniens Militärmacht so überlegen, dass ein bisschen Kanonenbootdiplomatie so ziemlich alles war, was es brauchte. Auch wenn der Anlass überaus fragwürdig war. Während des ersten Opiumkriegs erklärte der junge William Gladstone – der später Premierminister wurde – vor dem britischen Parlament: »Einen Krieg, der ungerechter in seinen Ursprüngen ist und besser geeignet, dieses Land mit dauerhafter Schande zu überziehen, kenne ich nicht, noch habe ich je von einem solchen gelesen«. Gladstones Schwester starb um ein Haar an der Opiumsucht. Es war ganz offensichtlich eine persönliche Angelegenheit. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir seit seiner Bemerkung noch ein paar mehr solcher Kriege hatten. Aber das ist eine andere Geschichte. Oder ein anderer Teil derselben Geschichte. Eine, die vorerst warten muss.[xiii]
Jedenfalls setzten sich die Briten in diesem Fall durch. Der Opiumhandel überlebte. Und als im amerikanischen Goldrausch des Jahres 1849 Tausende von chinesischen Männern und Frauen in die USA einwanderten, gab es unter ihnen genügend Suchtkranke, um in nahezu allen Chinatowns des Landes höchstbeliebte Opiumhöhlen zu etablieren. In den 1870er-Jahren war das Opiumrauchen dann vor allem im nicht mehr ganz so wilden Westen schwer in Mode. Die Abhängigkeit stieg so schnell an, dass der Gesetzgeber reagieren musste. San Francisco war die erste Stadt, die 1875 Opiumhöhlen verbot – der Freizeitkonsum von Opium und seinen Derivaten ging daraufhin in den Untergrund. Für eine Weile. Dort wäre er vielleicht auch geblieben – wenn nicht die medizinische Nutzung zur gleichen Zeit erheblich angestiegen wäre.[xiv]
Die klinische Verwendung von Opium beruht fast ausschließlich auf einem chemischen Bestandteil des Mohns, der als Morphin bekannt ist, und einer Vielzahl seiner halbsynthetischen Derivate. Morphin selbst wurde erstmals in den frühen 1800er-Jahren von einem wissbegierigen 21-jährigen Apothekergehilfen namens Friedrich Sertürner isoliert. In seiner Freizeit gelang es ihm, durch Tüftelei eine organische Alkaloidverbindung aus dem harzigen Schleim des Mohns zu gewinnen. Er nannte den Stoff Morphium, nach Morpheus, dem griechischen Gott der Träume.
Ab etwa 1827 wurde es als kommerzielles Medikament vermarktet. Aber mit dem Aufkommen der Injektionsnadel Mitte der 1850er-Jahre erst wurde seine Verwendung massiv ausgeweitet. Und als die Opiumhöhlen dann verboten wurden, hatte Morphium gerade die klinische Schmerzbehandlung von Grund auf revolutioniert. Besonders akute Schmerzen konnten jetzt in einer Weise gelindert werden, wie es vorher einfach nicht möglich war. Es hatte einen enormen Einfluss auf die palliative und postoperative Versorgung. Ich verbinde damit immer einen vagen, leicht Übelkeit erregenden Geruch, den ich noch aus meiner Zeit als Blutaufwischer in diesem OP-Saal in Erinnerung habe.
Und wie es der Zufall will, kann ich mich auch persönlich für seine schmerzlindernde Wirksamkeit verbürgen. Vor einigen Jahren verletzte ich mich beim Tennisspielen und litt seitdem unter chronischen Schmerzen im unteren Rücken- und Beckenbereich. Ich legte den Tennisschläger beiseite und verzichtete auf alles, was irgendwie anstrengend war. Ich versuchte es mit sanften Dehnübungen und etwas Yoga. Das half ein bisschen. Man verschrieb mir nichtsteroidale, entzündungshemmende Schmerzmittel. Davon bekam ich Magenschmerzen. Ich ging zu Ärzten und Physiotherapeuten und Osteopathen. Aber nichts half wirklich weiter.
Bei einer Röntgenuntersuchung im Krankenhaus wurde schließlich eine Degeneration des Knorpels in meiner linken Hüfte festgestellt. Die Genetik schlägt zurück, dachte ich bei mir. Und so ganz falsch lag ich damit gar nicht. So ganz richtig aber auch nicht. Der Berater empfahl eine Oberflächenersatz-Operation, ein »Resurfacing« meines Hüftgelenks.
Resurfacing
Genau genommen ist der Begriff »Resurfacing« ein wenig beschönigend. Im Grunde ist es schon eine Art Austausch der Hüfte. Allerdings ist es knochenschonender und ermöglicht in der Regel eine schnellere Genesung. Im Prinzip zumindest. Das ist einer der Gründe, warum es oft Leuten empfohlen wird, die möglichst bald wieder körperlich aktiv sein wollen. Tennisspieler zum Beispiel.
Der ehemalige Weltranglistenerste Andy Murray hatte im Alter von 32 Jahren die gleiche Operation und trat bereits ein Jahr später wieder auf höchstem Niveau an. Ich war fast zwanzig Jahre älter, als es bei mir so weit war, und definitiv kein Vergleich als Tennisspieler. Aber ich hoffte schon, zumindest wieder spielen zu können. Also entschied ich mich, wie Andy, für die OP – auch wenn das Timing nicht sehr clever war.[xv]
Ich hatte die verrückte Idee, die Reha-Phase könnte mir für den Einstieg in ein größeres Buchprojekt dienen. »Nutze die Schwierigkeit« – dieses Motto hatte mich wohl schon damals angesprochen. Also verbrachte ich die Tage vor der OP damit, mein gesamtes Hintergrundmaterial zusammenzutragen: Unterlagen von den ganzen Workshops, die ich geleitet hatte. Artikel, die ich aufgetan, aber noch nicht gelesen hatte. Meine eigenen, im Laufe der Zeit angefertigten Notizen. Und jede Menge unbeschriebenes Papier, für den Fall, dass mich die Inspiration streift. All das packte ich in einen großen blauen Ordner, den ich eines Morgens im Mai 2008 mit in die Klinik schleppte.
Die Sache sollte an einem langen Wochenende über die Bühne gehen. Und als ich ankam, war alles sehr ruhig. Vielleicht war ja das das Krankenhaus, an das ich mich in Llandod zu erinnern versuchte? Nur dass es damals schön warm draußen war, und die Klinik dort modern und lichtdurchflutet war. Nichts, das quietschte oder knarzte. Ich erinnere mich, dass meine Hüfte unglaublich schmerzte, als man mich von der Station zur OP schob. Aber die Sonne des Frühsommers schien durch die Fenster. Ein fahles Licht tanzte auf den weißen Laken. Alles wirkte irgendwie traumhaft. Vermutlich hatten sie mir bereits ein präoperatives Sedativum verpasst. Und dann zählte ich von hundert rückwärts, und ein dichter Nebelschleier aus kühlem Nichts stieg auf und hüllte mich ein.
Als ich wieder zu mir kam, war ich schon wieder auf der Station. Resurfacing – aus der Versenkung auftauchen. Mein Gehirn stellte die seltsamsten Verbindungen her. Und alles schien sich sehr schnell zu bewegen. Ganz von allein. Die Sonnenstrahlen tanzten noch immer über die Wände. Aber irgendwas war anders. Wo vorher Schmerz war, herrschte nun ein seltsames, fast süßes Gefühl. Was war das? Ach ja. Die Abwesenheit von Schmerz.
War’s das schon? War ich jetzt geheilt? Wann würde ich wieder Tennis spielen können?
Erstmal nicht, sagten sie mir.
Später an diesem Tag durfte ich das Bett verlassen und mich zum Tee trinken auf einen Hochlehner setzen. Das fühlte sich definitiv wie Fortschritt an. Langsamer Fortschritt, aber immerhin. Mein Gehirn war immer noch merkwürdig aktiv. Meine Gedanken wandten sich dem Schreibprojekt zu. Es schien mir eine gute Gelegenheit zu sein, die ich nicht verpassen durfte. Also holte ich in der abendlichen Stille den großen blauen Ordner aus dem Schrank neben dem Bett und legte ihn mir auf dem Schoß zurecht. Nach vielleicht ein paar Minuten rastlosen Überlegens nahm ich den Stift zur Hand und begann zu schreiben. Es floss ganz mühelos.
Wenig später kam eine Krankenschwester vorbei, um nach mir zu schauen. Hallo, sagte sie. Was machen Sie denn da? In ihrer Stimme lag ein Anflug von Belustigung. Oder war es eher Alarmstimmung? Ein sorgenvolles Lächeln umspielte ihren Mund. Ach, bloß ein bisschen Arbeit, sagte ich.
Sie wissen aber schon, dass Sie noch unter Morphium stehen, sagte sie.
Und in diesem Moment verwandelte sich ihr Lächeln in ein echtes Lachen. Ich lachte mit. Was nicht schwer ist, wenn man auf Morphium ist. Später in der Nacht, als ich nicht schlafen konnte und das Zeug immer noch in meinem Kopf herumwaberte, ließ der Spaß nach. Aber damals. Und selbst jetzt noch. Wenn ich daran denke. Es ist schon ein bisschen amüsant, irgendwie. Bei dem fraglichen Buchprojekt handelte es sich um Wohlstand ohne Wachstum, das letztlich in rund zwanzig Sprachen übersetzt wurde und mein Leben definitiv verändert hat. Es nahm seinen Anfang unter dem Einfluss von Morphium.
Das Geschenk der Mohnblume
Als Strategie kann ich das nicht empfehlen. Noch nicht mal zum Bücherschreiben. Offen gestanden hat von der Arbeit jenes ersten Abends nicht viel überlebt. Und wahrscheinlich könnte man sagen, dass ich einer der Glücklichen war. Ich verabscheute die Nebenwirkungen von Morphium mehr, als ich die Euphorie genoss, die es mir verschaffte. Ich war also nie wirklich in Versuchung, zu viel davon zu nehmen. Aber ich kann gut verstehen, wie leicht das passieren kann. Und kenne Menschen, denen genau das passiert ist. Wenn man sowas mitansehen muss, fragt man sich unweigerlich, so wie Gladstone, ob das wirklich der richtige Stoff ist, für den man Kriege führen sollte. Oder ob man sich bei der Schmerzbehandlung allzu sehr auf ihn verlassen sollte.
Selbst in seiner klinischen Darreichungsform hat Morphin ein hohes Suchtpotenzial. Man könnte wohl einwenden, dass allein die Abwesenheit von Schmerz schon ziemlich süchtig machen kann. Das würde wohl jeder unterschreiben, der jemals an chronischen Schmerzen gelitten hat. Man tut alles Erdenkliche, um den Schmerz zu vermeiden, so viel steht fest. Sobald die Wirkung der Droge nachlässt, ist der Schmerz zurück. Und natürlich willst du ihn wieder loswerden. Du hast die Nachfrage. Sie haben das Angebot. So läuft das in der Morphium-Ökonomie.
Falls ich es noch nicht ausreichend klargestellt haben sollte: Die Morphium-Ökonomie und die Care-Ökonomie sind nicht dasselbe. Es ist nicht so, dass sie nichts miteinander zu tun hätten. Aber man kann nicht das eine durch das andere ersetzen. Und wenn man es trotzdem versucht, gerät man in eine gefährliche Falle. Denn neben dem offensichtlichen Wunsch, den Schmerz loszuwerden, sind hier noch andere Kräfte im Spiel. Und zusammen bilden sie ein Rezept für die Katastrophe.
Zunächst einmal besteht das Geschenk der Mohnblume nicht allein in der Abwesenheit von Schmerz. Es ist eher wie Euphorie. Eine der Funktionsweisen besteht darin, das sogenannte mesolimbische System dazu anzuregen, den Körper mit dem Glückshormon Dopamin zu fluten, in dem Teil des Gehirns, der für die Steuerung unserer physiologischen und kognitiven Belohnungsmechanismen zuständig ist. Opioide lassen diese Reaktion gewissermaßen überschwappen. Und wenn Schmerz die Alternative ist, wird Euphorie schnell zur Sucht.[xvi]
Und da ist eine weitere, noch gefährlichere Dynamik. Der Körper passt sich an. Wenn die Wirkung der Droge nachlässt, braucht man eine höhere oder häufigere Dosis, um dieselbe euphorische Reaktion zu erzielen – oder auch nur, um wieder die gleiche Schmerzfreiheit zu erreichen. Das trifft im Übrigen auch auf ganz alltägliche Freuden zu. Die Dopaminausschüttung wird durch Überraschung ausgelöst. Und um diese Überraschung zu erzeugen, muss entweder genügend Zeit zwischen den Auslösern liegen, damit die Erwartungen wieder zurückgesetzt werden. Oder die Intensität des Auslösers muss erhöht werden.
Im Fall von verschreibungspflichtigen Opioiden erweist sich diese Dynamik als katastrophal. Wenn man auf den »Reset« wartet, kommt der Schmerz mit voller Wucht zurück. Erhöht man die Dosis, gerät man in eine endlose Spirale. All das macht den Ausstieg aus der Sucht so höllisch schwierig. Ohne Hilfe ist es praktisch unmöglich. Und der Schmerz, den man dabei erfährt, ist mitunter schlimmer als der, mit dem alles begann. Warum also überhaupt aufhören? Es sei denn, versteht sich, man will weiterleben. Aber selbst das ist für manche kein ausreichender Anreiz mehr.
Diese Eigenschaften sind kein Geheimnis. Deshalb gab es lange Zeit strenge Vorschriften für die klinische Anwendung. Morphin wurde im Allgemeinen nur für Menschen verschrieben, die unter akuten oder unheilbaren Krankheiten litten. Hauptsächlich für die postoperative Genesung, zur Behandlung von Krebspatienten und in der Palliativ- oder Hospizpflege. Es wurden erhebliche Anstrengungen unternommen, um sichere und wirksame Alternativen zu finden.
Ob Sie es glauben oder nicht: Genau hier hat Heroin seinen Ursprung. Bayer brachte Heroin 1898 auf den Markt – anfangs als »nicht süchtig machendes« Husten- und Schmerzmittel. Im Jahr 1906 empfahl die American Medical Association seinen Einsatz, um Morphinabhängige von ihrer Sucht zu entwöhnen. Wie sich jedoch herausstellte, ist Heroin doppelt so stark wie Morphin und macht genauso süchtig. 1924 wurde seine Verwendung dann unter Strafe gestellt. Doch neunzig Jahre später, auf der Höhe seiner Verbreitung, starben immer noch rund 15.000 Menschen pro Jahr an Heroin.[xvii]
Das war der Punkt, an dem der Konsum zurückzugehen begann. Und es mag auf den ersten Blick vielleicht wie ein Erfolg für die Drogenbekämpfung aussehen. War es aber nicht. Es hatte weit mehr mit dem spektakulären Aufstieg anderer, ebenso starker und vollkommen legaler Opioide zu tun. Allen voran Oxy.
Dopesick
Das Schmerzmittel Oxycodon wurde erstmals 1916 aus einer opiumbasierten Verbindung namens Thebain synthetisiert. Aber erst mit der Einführung eines starken, verschreibungspflichtigen Depotpräparats namens Oxycontin – oder »Oxy«, wie es in der Szene genannt wird – begannen die Dinge wirklich aus dem Ruder zu laufen. Und auch das wäre vielleicht gar nicht passiert, wäre da nicht diese unheilvolle Kombination aus Ignoranz, Gier und dem Komplettversagen behördlicher Aufsicht gewesen.
In groben Zügen verlief die Geschichte ungefähr so: Mitte der 1990er hatte das Unternehmen Purdue Pharma, das sich im Besitz der Familie Sackler befand, mit finanziellen Verbindlichkeiten und sinkender Nachfrage zu kämpfen. Es startete eine aggressive Marketingkampagne, um Ärzte davon zu überzeugen, Oxy nicht nur bei akuten Schmerzen zu verschreiben, wie es bei Morphin der Fall war, sondern auch bei leichten oder mittelschweren Schmerzen.[xviii]
Ein Arbeitsunfall. Muskelverspannung. Schleimbeutelentzündungen. Verrenkungen. Knochenbrüche. Neuralgie. Arthritis. Die Folgen eines Sturzes. Was auch immer. Oxy gibt dir dein Leben zurück. Plötzlich war ein starkes Opioid auf Rezept beim Hausarzt erhältlich. Und diese leichte Verfügbarkeit ließ einen Dämon auf die Gesellschaft los. Es gab Zeiten, da verschrieben amerikanische Ärzte 255.000 Opioidrezepte pro Jahr – genug, um jeden Erwachsenen in den USA mit einer Flasche Oxycontin zu versorgen.
Es ist schockierend, wie es dazu kommen konnte. Wenn Sie sich für die Details interessieren: Die sind leicht zu finden. Dopesick (auf dem Streamingdienst Hulu) und PainKiller (auf Netflix) sind beides überzeugende filmische Darstellungen der Story. Beide beruhen auf umfangreichen Recherchen, unterscheiden sich aber in ihrer Schwerpunktsetzung. Dopesick beleuchtet das Geschehen vor allem aus der Perspektive eines Arztes. Es erzählt die Geschichte seines anfänglichen Widerstands gegen die Verschreibung des Medikaments, bis hin zu der Abhängigkeit, die ihn später selbst ereilt. PainKiller wird hauptsächlich aus der Perspektive einer jungen Anwältin erzählt, die versucht, die Familie Sackler zur Rechenschaft zu ziehen.[xix]
Beide Schilderungen beleuchten Purdues aggressive Marketing- und Verkaufskampagne. Beide offenbaren den Missbrauch der Wissenschaft, die Aushebelung ordnungsgemäßer Verfahren und das erschreckende Versagen des Regulierungssystems selbst. Beide machen das Leiden derjenigen spürbar, die durch den Konsum von Oxy ihre Gesundheit, ihren Lebensunterhalt und manchmal auch ihr Leben verloren haben. Seien Sie gewarnt. Die Geschichte ist wirklich beklemmend.
Am schockierendsten war vielleicht Purdues Reaktion, als sich die Beweise für die Schäden häuften, die Oxy im Leben der Menschen anrichtete. Anstatt sich dem Problem zu stellen oder die Verkaufsaktivitäten zurückzufahren, starteten sie eine haarsträubende Kampagne, in der sie den Opfern die Schuld zuschoben. Das Problem sei nicht das Medikament selbst oder die Art und Weise, wie es verschrieben wurde. Das Problem sei der Missbrauch durch einen harten Kern von Drogenkonsumenten, die sich illegal Rezepte beschafften. Oxy sei überhaupt nicht das Problem. Wäre es nicht Oxy gewesen, dann hätte es eben ein anderes Medikament gegeben, behaupteten sie. Erstaunlicherweise ist diese Haltung bis heute verbreitet, und zwar genau dort, wo sie definitiv nichts zu suchen hat.
Bis heute steht auf der Webseite der US-Drogenbekämpfungsbehörde (DEA), Oxycodon sei ein »beliebtes Missbrauchsmedikament unter der narkotikaabhängigen Bevölkerung«. Diese Beschreibung erweckt den Eindruck, es handle sich um ein gewöhnliches verschreibungspflichtiges Schmerzmittel, das von einer kleinen Minderheit hartnäckiger Süchtiger kriminell zweckentfremdet wird. Menschen, die sich ohnehin auf jede erdenkliche Weise selbst zerstören würden, sobald sie nur die Gelegenheit dazu bekämen. Dopesick und PainKiller zeigen jedoch beide, dass dies eine äußerst gefährliche – und doppelzüngige – Darstellung der Sachlage ist.[xx]
Die Realität ist noch anstößiger. Oxy hat im Alleingang eine Opioidkrise heraufbeschworen, die durch die Legalisierung verschreibungspflichtiger Schmerzmittel propagiert wurde. Diese Krise hat inzwischen mehr als eine halbe Million Menschen in den USA das Leben gekostet. Nach Schätzungen der WHO sterben weltweit jedes Jahr etwa 600.000 Menschen an den Folgen des Drogenkonsums, ein Viertel davon an einer Überdosis Opioide.[xxi]
Diese Zahlen könnten sich leicht noch verschlechtern, bevor sie besser werden. Die jüngste Wendung in der Geschichte birgt einen alarmierenden Anstieg des Missbrauchs von Fentanyl – einem Opioid, das fünfzigmal stärker ist als Oxy. Es gelangt durch gefälschte Rezepte in den Straßenhandel. Oftmals werden sie als Verschreibung für Oxy getarnt. Und manchmal enthalten sie Fentanyl in tödlicher Konzentration.[xxii]
Mit Klagen überhäuft, meldete Purdue Pharma im Jahr 2019 schließlich Insolvenz an. Als Teil eines ausgehandelten Vergleichs einigte sich die Eigentümerfamilie Sackler mit dem Gericht darauf, sechs Milliarden Dollar zur Behandlung von Opioidabhängigkeit beizusteuern. Im Gegenzug erhielten sie Immunität vor Strafverfolgung, und ein beträchtlicher Teil des Familienvermögens blieb unangetastet. Das Vergleichsabkommen wurde im Juni 2024 vom Obersten Gerichtshof aufgehoben. Und fast zwei Jahrzehnte nach der Zulassung von Oxycontin als verschreibungspflichtiges Medikament wurden die unmittelbar Verantwortlichen für die verheerenden Folgen noch immer nicht zur Rechenschaft gezogen.[xxiii]
Verhängnisvolle Verwechslung
Hier nun meine Frage. Sind wir wirklich die Klugen? Was ist dümmer? Ein paar skrupellosen Quacksalbern zu erlauben, neben den bewährten Vorteilen der Wasserkur auch fragwürdige Heilmittel anzubieten? Oder die Verschreibung eines starken Betäubungsmittels mit bekanntermaßen süchtig machenden Eigenschaften zu legalisieren und fast zwei Jahrzehnte lang die Augen vor seiner zügellosen und betrügerischen Kommerzialisierung zu verschließen, weil sich durch den Verkauf von Arzneimitteln immense Reichtümer anhäufen lassen?
Und abgesehen von der offenkundigen Skrupellosigkeit oder ordinären Gier all jener, die von der Versorgungskette dieser Tragödie profitiert haben, wo genau liegt die Dummheit? Wer oder was sollte jetzt eigentlich für die Opioidkrise zur Rechenschaft gezogen werden?
Was meine beiden Geschichten in diesem Kapitel verbindet, ist der Wunsch nach Gesundheit. Und dieser Wunsch steht im Zentrum meiner These. Der Ursprung des englischen Worts value liegt im lateinischen valere, was »stark sein, gesund sein« bedeutet. Der Wert der Gesundheit liegt auf der Hand. Natürlich messen wir der Gesundheit hohen Wert bei. Ohne Gesundheit ist alles nichts. Ohne Gesundheit ist es schwierig, sich Wohlstand überhaupt vorzustellen. Und ohne Gesundheit wirkt das Streben nach materiellem Wohlstand nur noch schal.
Aber es ergibt doch gewiss keinen Sinn, unser Verlangen nach Gesundheit für die Opioidkrise verantwortlich zu machen? Das wäre so, als würde man den arglosen Opfern der Kuren in Llandod sagen, ihr seid selbst schuld an eurem Ableben, wenn ihr euch in die Hände heimtückischer Scharlatane begebt.
Meiner Ansicht nach liegt das Problem in der Verwechslung von Gesundheit mit Vergnügen. Und von Vergnügen mit der Abwesenheit von Schmerz. Ich sage nicht, dass das völlig abwegig ist. Die beiden Dinge haben eindeutig miteinander zu tun. In den Worten des indisch-amerikanischen Neurologen V. S. Ramachandran: »Schmerz ist eine Meinung über den Gesundheitszustand des Organismus.« Aber er hat keine unmittelbare Korrelation zu Krankheit oder Verletzung. Er ist ein »Protektor« und kein »Detektor«, betont der britische Arzt Monty Lyman.[xxiv]
Und dass wir Gesundheit so gründlich mit der Abwesenheit von Schmerz verwechselt haben, liegt unter anderem daran, dass Letztere so leicht zu monetarisieren und eine so ergiebige Profitquelle ist. Doch die Folgen dieser falschen Verknüpfungen sind über alle Maßen gefährlich. Wir haben eine Opioidkrise ausgelöst, die außer Kontrolle geraten ist und heute das Gefüge der Gesellschaft in Städten weltweit zerstört. Angetrieben vom trügerischen Versprechen der Euphorie.
Und mit diesem einen Wort schließt sich wieder der Kreis. Die Medizinwissenschaften haben schon vor langer Zeit Gesundheit und Euphorie durcheinandergebracht. Und der Grund dafür war Opium. Oder genauer gesagt: Laudanum. Die historische Koinzidenz ist verblüffend. In den 1660er-Jahren machte der Arzt Thomas Sydenham eine auf Paracelsus zurückgehende Tinktur auf Opiumbasis in Großbritannien populär. Der erste Verweis auf die medizinische Definition von Euphorie als Gesundheit stammt aus dem Jahr 1665, just als das Allheilmittel allgemeine Verbreitung zu finden begann.[xxv]
Es wäre nicht weit hergeholt anzunehmen, dass Ärzte, die ihre Patienten mit Laudanum behandelten und dabei »Verbesserungen« beobachteten, die sie als Euphorie beschrieben, zumindest teilweise die Wirkung von Opium auf die Opioidrezeptoren im Gehirn sahen. Es überdeckt zwar den Schmerz, aber gleichzeitig wird die Dopaminreaktion überstimuliert und löst Zustände übertriebener Euphorie aus, die dem realen Geschehen nicht angemessen sind. Was sie für Gesundheit hielten, war in Wirklichkeit Euphorie.
Gewinn und Verlust
Es gibt noch etwas, das die Geschichten in diesem Kapitel gemeinsam haben. Abgesehen von dem Wunsch nach Gesundheit. Abgesehen von der Verwechslung von Gesundheit mit Euphorie. Die schädlichen Konsequenzen des Morphingebrauchs werden, genau wie die fragwürdigen Auswüchse der Wasserkuren, vom Streben nach Profit vorangetrieben – manchmal unerbittlich. Es gibt zweifellos Fälle – wie bei Purdue Pharma –, in denen die Geschäftemacherei an pure Gier grenzt. Und in denen Gier strategisch zur Profitmaximierung eingesetzt wurde. Beide haben aus dem Wunsch ganz normaler Menschen, Schmerz zu vermeiden und Euphorie zu erleben, Kapital geschlagen. Doch da ist noch etwas anderes im Gange. Etwas Systemimmanentes.
Profit ist unverzichtbar für den Aufbau von Vermögen. Er ist das Lebenselixier der Geldwirtschaft. Die Gewinnmaximierung und Vermögensakkumulation treiben das Wachstum des BIP an. Und dieser Prozess wird durch die Gleichsetzung von Wohlhabenheit mit Wohlstand und von Wachstum mit Fortschritt legitimiert. Wenn wir also die wahren Übeltäter finden wollen, müssen wir über Fehlannahmen hinausblicken. Wir müssen außerhalb von Fehlverhalten und Gier suchen. Wir müssen auch über die menschliche Anfälligkeit für Täuschung hinausblicken, die durch den Wunsch nach Gesundheit – oder auch nach Euphorie – genährt wird. Wir können die Schuld nicht allein der menschlichen Natur zuschieben.
Meiner Ansicht nach liegt die dysfunktionale Dynamik im Herzen unserer Kultur. Sie ist im Kern einer Gesellschaft verankert, die spezifisch um das Streben nach Profit herum organisiert ist. Sie ist tief in unserem fehlgeleiteten Wohlstandsbegriff verwurzelt. Die Akkumulation von Reichtum bildet das Fundament der kapitalistischen Wirtschaftsstruktur. Ihre Legitimation liegt in der Behauptung, dass »mehr« immer »besser« sei. Dieselbe Philosophie setzt steigenden Wohlstand mit wirtschaftlichem Wachstum gleich. Sie erlaubt es uns, sowohl über Gier als auch über Geldschneiderei hinwegzusehen – selbst, wenn sie zu so katastrophalen Folgen wie der Opioidkrise führt oder dem Ertränken gebrechlicher Menschen im Namen der Gesundheit –, weil wir glauben, sie weise in dieselbe Richtung wie der Pfeil des sozialen Fortschritts.
Vielleicht leiht sich diese Philosophie auch etwas von unserem rastlosen Verlangen nach Euphorie. Reichtum – und das Streben nach Reichtum – trägt eindeutig Züge, die typisch für süchtig machende, unausgeglichene Abhängigkeitsspiralen sind, wie man sie oft in der Jagd nach Euphorie findet. Zu dieser Schlussfolgerung kommt jedenfalls Julian Rosefeldt in seinem eigenen Kommentar zu Euphoria. Und das Bild, das er dort zeichnet, ist zutiefst dystopisch.[xxvi]
Wenn das stimmt, führt unsere Suche nach Schuldigen direkt zurück zu den schädlichen Annahmen, die im Kern unserer kulturellen Vorstellung von Wohlstand verankert sind. Das ist bitte nicht als Duldung individueller Gier zu verstehen. Es ist auch keine Entschuldigung für Kriminalität. Es entbindet uns nicht einmal von unserer eigenen Verantwortung. Weder auf individueller noch auf kultureller Ebene. Natürlich ist es unklug, sich von Scharlatanen zu Wundermitteln verführen zu lassen. Natürlich ist es fahrlässig, skrupellose Unternehmen, die von Tragödien profitieren, nicht zu regulieren und sie sogar noch zu ermutigen. Natürlich ist es in gewisser Weise unvernünftig, wenn eine vernünftige Gesellschaft so etwas zulässt.
Der springende Punkt ist aber, dass all das von der kulturellen Idee befeuert, gerechtfertigt und legitimiert wird, die das unerbittliche Streben nach »mehr« als treibende Kraft des sozialen Fortschritts betrachtet. Wenn wir also wirklich nach Bösewichten suchen, nach den Ursprüngen der Dysphorie, die uns heimsucht, sollten wir vielleicht die kulturellen Mythen neu hinterfragen, auf denen unsere Gesellschaft basiert.
Es ist ein Gedanke, auf den ich noch zurückkommen werde. Dass nämlich unsere Kultur als solche krank macht. Das Streben nach und die Anhäufung von Reichtum schaffen eine Dynamik, in der menschliche Ambitionen verzerrt werden. In der sich die menschliche Natur gegen sich selbst wendet. In der unsere Neurobiologie zu unserem schlimmsten Feind wird. In der pathologische Ergebnisse unvermeidbar sind. Und all das geschieht aus einem ganz einfachen Grund: Das Streben nach materiellem Wohlstand steht in innigem Widerspruch zur Ausrichtung auf einen Wohlstand, der durch Gesundheit definiert wird. Ersteres folgt einer Logik von Akkumulation und Wachstum. Die Dynamik von Gesundheit ist radikal anders beschaffen. Es ist an der Zeit, diese Dynamik genauer unter die Lupe zu nehmen.
Kapitel 2 – Euphoria
[i] Boris Groys, Philosophy of Care, 2022, S. 87.
[ii] Rosefeldts Film-Installation: https://www.theguardian.com/artanddesign/2023/feb/14/hopefully-some-people-hate-it-the-immersive-film-about-capitalism-coming-to-melbourne.
[iii] HBO-Serie Euphoria: https://www.hbo.com/euphoria. Für einen Kommentar zur Serie siehe: https://time.com/6152502/euphoria-hbo-teenage-drug-use/.
[iv] Definition von Euphorie: Euphoria Definition & Meaning - Merriam-Webster. Zur Definition aus psychologischer Sicht vgl. APA Dictionary of Psychology: siehe auch euphoria - Definition | OpenMD.com
[v] Llandrindod Wells: https://www.storipowys.org.uk/news-1/dr-linden-and-the-miracle-waters-of-llandrindod-wells?locale=en; siehe auch: Linden 1756.
[vi] Kubas Ärzteschaft: https://business.cornell.edu/hub/2021/05/19/is-cubas-army-white-coats-medical-diplomacy-or-contemporary-slavery/.
[vii] Ärztegehälter an der Cleveland Clinic: https://www.ft.com/content/dd25a898-58f0-43cd-9433-bcd2852363b3. Ärztegehälter in Kuba: https://worldsalaries.com/average-doctor-salary-in-cuba/. Beraterhonorare beim NHS: https://www.nhsemployers.org/system/files/2023-08/Pay%20and%20Conditions%20Circular%20%28MD%29%204-2023%20FINAL_0.pdf.
[viii] »Erkrankungen des schönen Geschlechts«: Linden 1756, S. 84. Zum Aderlass: vgl. ebenda, S. 208.
[ix] »Jeder lebt in der Erwartung des Schmerzes«: Groys 2022, S. 88.
[x] Geschichte von Opium: https://museum.dea.gov/exhibits/online-exhibits/cannabis-coca-and-poppy-natures-addictive-plants/opium-poppy.
[xi] »das innere Gleichgewicht des menschlichen Körpers optimieren«: Robson 1999, S. 161.
[xii] Opium-Kriege: https://www.theguardian.com/society/2023/may/23/out-of-our-minds-opium-imperial-history-opium-wars-china-britain.
[xiii] »Einen Krieg, der ungerechter […] ist, [..] kenne ich nicht«: https://hansard.parliament.uk/Commons/1880-06-04/debates/b53a59e8-4235-47f9-beec-31da92fdfbf4/TheOpiumTrade—Observations.
[xiv] Opiumhöhlen in San Francisco: https://www.history.com/topics/crime/history-of-heroin-morphine-and-opiates.
[xv] Hüft-Resurfacing-Operation: https://www.whitehouse-clinic.co.uk/articles-and-advice/what-is-hip-resurfacing-the-andy-murray-hip; https://www.edwinsu.com/andy-murray-and-hip-resurfacing.html.
[xvi] Mesolimbisches Belohnungssystem: Kosten and George 2022.
[xvii] Heroin als Hustensaft: https://museum.dea.gov/museum-collection/collection-spotlight/artifact/heroin-bottle. Opiodbedingte Todesfallzahlen: https://nida.nih.gov/research-topics/trends-statistics/overdose-death-rates; siehe auch: https://www.commonwealthfund.org/blog/2022/too-many-lives-lost-comparing-overdose-mortality-rates-policy-solutions; Statistikdaten zur Opioid-Epidemie: https://www.cdc.gov/overdose-prevention/about/understanding-the-opioid-overdose-epidemic.html.
[xviii] Purdue Pharma: https://www.theguardian.com/us-news/2023/aug/10/purdue-pharma-oxycontin-supreme-court-sacklers-bankruptcy-deal; https://www.theguardian.com/society/2018/sep/30/theyre-drug-dealers-in-armani-suits-executives-draw-focus-amid-us-epidemic; https://www.theguardian.com/news/2018/nov/08/the-making-of-an-opioid-epidemic; Verschreibungsstatistik von Opioiden in den USA: https://www.cdc.gov/drugoverdose/rxrate-maps/index.html.
[xix] Pain Killer siehe Meier 2020, sowie das Netflix-Drama PainKiller: https://time.com/6303583/painkiller-netflix-true-story/. Dopesick: https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2021/oct/11/dopesick-michael-keaton-hulu-opioid-crisis-purdue-pharma.
[xx] DEA und Oxycodon: https://www.dea.gov/sites/default/files/2020-06/Oxycodone-2020_0.pdf.
[xxi] Opioid-Überdosis: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/opioid-overdose.
[xxii] Fentanyl: Stanley 2014; https://www.jpain.org/article/S1526-5900(14)00905-5/pdf; https://www.pharmaceutical-technology.com/features/fentanyl-go-wrong/?cf-view; Fentanyl getarnt als Oxy: https://www.cfr.org/backgrounder/fentanyl-and-us-opioid-epidemic.
[xxiii] Anhörung am Obersten Gerichtshof der USA: https://www.insurancejournal.com/news/national/2023/11/27/749501.htm.
[xxiv] »Schmerz ist eine Meinung«: Ramachandran und Blakeslee 1998, S. 224, Hervorhebung im Original. »Schmerz ist ein Protektor«: Lyman 2022, S. 22.
[xxv] Erster bekannter Verweis auf die medizinische Definition von Euphorie, 1665: https://www.merriam-webster.com/dictionary/euphoria.
[xxvi] Rosefeldt: Vgl. Anm. 2.