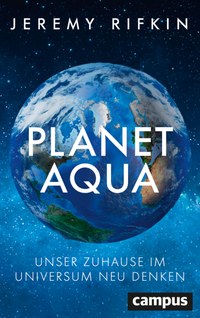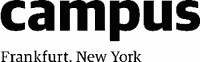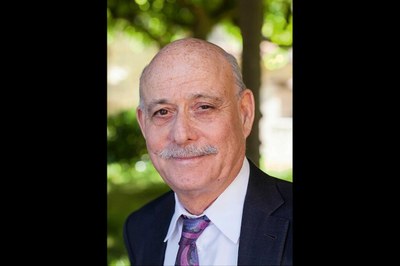Stellen Sie sich vor, die Menschheit würde eines Morgens aufwachen und feststellen, dass sich die Welt so fremd anfühlt, als wären wir auf einen anderen Planeten gebeamt worden, weil sich die Eckpfeiler unseres Daseins in Luft aufgelöst haben und wir uns unserer Situation hilflos ausgeliefert fühlen. Dieses erschreckende Szenario ist schon heute Wirklichkeit. Nichts von dem, was wir über unsere Heimat im Universum zu wissen glaubten, scheint mehr wahr zu sein. Die vertrauten Grundlagen, die uns ein Gefühl der Zugehörigkeit und Richtung vermittelt haben, haben sich quasi über Nacht in Luft aufgelöst, und wir fühlen uns wie Asylsuchende im eigenen Land. Jeder von uns ist auf ganz eigene Weise verunsichert und wir wissen nicht mehr, wo wir Trost finden und was wir tun sollen.
Was ist geschehen, dass wir uns auf unserem Heimatplaneten wie Fremde fühlen? So ungern wir das hören: Während der sechs Jahrtausende dessen, was wir als »Zivilisation« bezeichnen, haben wir uns vollkommen falsche Vorstellungen von unserer Existenz und unseren Lebensgrundlagen gemacht. Vereinfacht ausgedrückt haben wir Menschen gerade im Westen geglaubt, dass wir auf einer »Mutter Erde« leben, einem üppig grünen und unerschütterlichen Fundament, auf dem wir fest stehen und das wir unser Zuhause im Weltall nennen. Dieses Heimatgefühl wurde zum ersten Mal am 7. Dezember 1972 erschüttert.
Auf ihrem Weg zum Mond machten die Astronauten von Apollo 17 einen Schnappschuss von der Erde aus 29.400 Kilometern Entfernung. Das Foto zeigt eine blaue Kugel im Sonnenlicht und veränderte unsere gesamte Wahrnehmung von unserem Zuhause. Das Grün der Erde erwies sich als eine dünne Haut auf einem Wasserplaneten, der mit seinen zahlreichen Blauschattierungen in unserem Sonnensystem und vielleicht sogar im gesamten Universum einzigartig ist. Am 24. August 2021 prägte die Europäische Raumfahrtagentur ESA daher den Namen »Planet Aqua«. Die amerikanische National Aeronautics and Space Administration (NASA) stimmt zu und erklärt auf ihrer Website: »Wenn man unsere Erde aus dem Weltraum betrachtet, ist es offensichtlich, dass wir auf einem Wasserplaneten leben.«
Dieser Wasserplanet ist in letzter Zeit Gesprächsstoff an Esstischen genauso wie in Kommunen, Regierungen, Industrie und Zivilgesellschaft. Das liegt daran, dass die Hydrosphäre der Erde inzwischen auf eine Weise außer Rand und Band gerät, wie wir es noch vor wenigen Jahren für unmöglich gehalten hätten, und uns damit zum Abgrund des sechsten Massensterbens bringt. Die Wissenschaft erklärt uns, dass in den kommenden achtzig Jahren – die Lebensspanne der heute Geborenen – mehr als die Hälfte der heute lebenden Arten aussterben könnte. [1] Diese Arten bevölkern den Planeten zum Teil schon seit vielen Jahrmillionen.
Unser Klima erwärmt sich durch die Freisetzung der Treibhausgase Kohlendioxid, Methan und Stickoxid in die Atmosphäre. Das hat auch Einfluss auf die Hydrosphäre: Mit jedem Grad Celsius der Erderwärmung verdunstet das Wasser aus dem Boden und dem Meer schneller in die Atmosphäre, die Wasserkonzentration in den Wolken steigt um 7 Prozent, und die Folge sind extremere Wetterereignisse – im Winter tiefere Temperaturen mit starken atmosphärischen Strömungen und Schneefällen, im Frühjahr gewaltige Überschwemmungen, im Sommer anhaltende Dürren, tödliche Hitzewellen und Feuersbrünste, und im Herbst katastrophale Wirbelstürme, die die Ökosysteme heimsuchen, das Leben von Menschen und unseren Mitlebewesen gefährden und gewaltige Schäden in der Infrastruktur anrichten.2
Ein Überblick über den bisher entstandenen Schaden muss unvollständig bleiben. Die Bilanz ist gleichwohl ernüchternd, doch wir müssen ihr ins Auge sehen, um uns aus unserer Leugnung, Gleichgültigkeit oder, schlimmer noch, Verzweiflung herauszureißen.
− Aktuell sind 2,6 Milliarden Menschen von starkem oder extremem Wassermangel betroffen. Bis 2040 werden es insgesamt 5,4 Milliarden Menschen in 59 Ländern sein – mehr als die Hälfte derprognos tizierten Weltbevölkerung.3
− Aufgrund des Wassermangels könnte 2050 die Ernährung von 3,5 Milliarden Menschen gefährdet sein; heute sind es 1,5 Milliarden.4
− In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der durch Wasserknappheit verursachten Konflikte und Kriege weltweit um 270 Pro-
zent gestiegen.5
− Eine Milliarde Menschen lebt in Ländern, die nicht über die Mittel verfügen, um sich an neue Umweltbedrohungen anpassen zu können; so entstehen bis 2050 Bedingungen für die Klimamigration und Massenflucht ganzer Populationen.6
− Überschwemmungen sind seit 1990 zur häufigsten Naturkatastrophe geworden und machen heute 42 Prozent aus. Besonders betroffen ist China, wo 2010 wegen Hochwasser und Schlammlawinen 15,2 Millionen Menschen evakuiert werden mussten. Auch in Europa haben Überschwemmungen an Häufigkeit und Ausmaß zugenommen und machen aktuell rund 35 Prozent der Naturkatastrophen auf dem Kontinent aus, Tendenz steigend.7
− Dürren, Hitzewellen und gewaltige Waldbrände breiten sich auf allen Kontinenten aus, wo sie Ökosysteme vernichten und Infrastruktureinrichtungen zerstören.
− Im Spätfrühjahr 2022 waren 32 Prozent der Vereinigten Staaten (ohne Alaska und Hawaii) von »starker bis extremer Trockenheit« betroffen.8 Im Jahr 2023 lebten 1,84 Milliarden Menschen – fast ein Viertel der Menschheit – in von schwerer Dürre betroffenen Ländern, 85 Prozent davon in Ländern mit mittleren oder unteren Einkommen.9
− In weiten Teilen der Welt werden Rekordtemperaturen von 43 bis 50 Grad Celsius erreicht. Am 9. Juli 2023 kletterte das Thermometer im Death Valley auf 54 Grad Celsius und blieb damit nur knapp unter der höchsten jemals auf der Erde gemessenen Temperatur.10
Aus der Antarktis wurde während einer außergewöhnlichen Hitzewelle im April 2020 ein Rekord von 18,3 Grad Celsius gemeldet.
Die Jahre von 2015 bis 2021 waren die wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen11 und im Juli 2023 erlebte der Planet die heißesten drei Tage in Folge, die je gemessen wurden.12
− In den ersten neun Monaten des Jahres 2023 wurden in den Vereinigten Staaten durch 44.011 Brände 9.478 Quadratkilometer Land zerstört.13 Diese Feuersbrünste wurden noch weit in den Schatten gestellt von der Brandkatastrophe in Kanada vom Mai und Juni 2023, die innerhalb von nur sechs Wochen 185.000 Quadratkilometer boreale Nadelwälder zerstörte.14 In diesen Wäldern sind 12 Prozent des von Landökosystemen gebundenen Kohlenstoffs gespeichert; würde dieser durch Brände freigesetzt, entspräche dies der Menge, die durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen in 36 Jahren freigesetzt würde.15
− Der Rauch der kanadischen Waldbrände beeinträchtigte auch in weiten Teilen der Vereinigten Staaten die Luftqualität; in New York färbte sich der Himmel orange und die Behörden sprachen von der schlechtesten Luftqualität der Welt. Dort sowie in Chicago, Washington, D.C., und anderen Großstädten des Landes wurde die Bevölkerung aufgerufen, zu Hause zu bleiben.
− In neunzehn Nationen sind mindestens 10 Prozent der Bevölkerung vom Anstieg des Meeresspiegels betroffen. In den kommenden drei Jahrzehnten werden nicht nur die tiefliegenden Küstenregionen von China, Bangladesch, Indien, Vietnam, Indonesien und Thailand den Anstieg zu spüren bekommen, sondern auch Metropolregionen wie Alexandria in Ägypten, Den Haag in den Niederlanden oder Osaka in Japan.16
− Bis 2050 werden 4,7 Milliarden Menschen in Ländern leben, die großen oder extremen Umweltgefahren ausgesetzt sind – knapp 50 Prozent der prognostizierten Weltbevölkerung.17
− Bis 2050 könnten bis zu 1,2 Milliarden Menschen in aller Welt durch Klimakatastrophen aus ihrer Heimat vertrieben werden.18
− Die Schmelze der Polkappen und Gletscher sowie die Entnahme beispielloser Mengen von Grundwasser zur Bewässerung und Trinkwasserversorgung haben die Gewichtsverteilung auf der Erde so verändert, dass sie die Rotation der Erdachse beeinflusst, mit nicht absehbaren Folgen für das künftige Leben auf der Erde.19
− In den Weltmeeren lässt der Klimawandel den Sauerstoffanteil sinken; in einigen Regionen ist er um bis zu 40 Prozent gefallen.20
− Bis 2050 befinden sich 61 Prozent aller Staudämme des Planeten in Flusstälern, die durch Dürre, Überschwemmung oder beides
gefährdet sind.21
− Rund 20 Prozent des verbleibenden Süßwassers auf der Erde befinden sich in den fünf Großen Seen Nordamerikas.22
− Nach Angaben der Weltbank hat sich »die Menge an Süßwasser pro Kopf in den vergangenen fünfzig Jahren halbiert«.23
Nachdem wir den Planeten so lange geplündert haben, könnten wir nun zu seinen Rettern werden – aber nur vielleicht. Es gibt durchaus Anlass zur vorsichtigen Hoffnung, doch naiver Optimismus wäre unangebracht. Um die Wende zu schaffen, müssen wir uns selbst und unsere Beziehung zu unserem Planeten vollkommen neu verstehen.
In einer Art Manöverkritik müssen wir uns klarmachen, wie es kommen konnte, dass die Menschheit vor gut sechs Jahrtausenden aus der Reihe aller anderen Lebewesen ausscherte, die sich fließend an einen lebendigen und sich ständig verändernden Planeten anpassten.
Unsere frühesten Vorfahren waren Animisten, sie erlebten die Welt als pulsierenden, lebendigen und mit Geistwesen erfüllten Ort, und sich selbst erfuhren sie als untrennbaren Teil dieser grenzenlosen Natur.
Der Bruch kam, als unsere Vorfahren begannen, mithilfe ihrer außergewöhnlichen geistigen Kapazität und körperlichen Geschicklichkeit ihre Umwelt nun umgekehrt an ihre Launen und Nützlichkeitserwägungen anzupassen und die Natur auszubeuten.
Vor sechs Jahrtausenden begannen unsere Vorfahren an den Ufern des Euphrat und Tigris24 in der heutigen Türkei und im Irak und wenig später am Nil in Ägypten,25 am Ghaggar-Hakra und Indus im heutigen Indien und Pakistan,26 am Gelben Fluss in China27 und schließlich auch im Römischen Reich,28 das Wasser für die ausschließliche Nutzung durch den Menschen zu bändigen. Sie bauten Dämme und Wasserspeicher, Deiche und Schleusen, gruben Kanäle und lenkten Flüsse in andere Bahnen, um das Wasser in Besitz zu nehmen und zu kommerzialisieren. Es war ein tiefer Eingriff in die Ökologie dieser Bioregionen. Mit dieser Infrastruktur begann etwas, das Historiker als urbane oder hydraulische Zivilisation bezeichnen. Das Auffangen von Wasser setzte sich bis in unsere Zeit ungebrochen fort und erreichte zu Beginn des 21. Jahrhunderts einen neuen Höchststand.
Auch wenn Historiker und Anthropologen dieser gewaltigen Umorientierung der Hydrosphäre des Planeten kaum Beachtung14 geschenkt haben, von Soziologen und Wirtschaftswissenschaftlern ganz zu schweigen, wäre unser urbanes Leben ohne diese hydraulische Infrastruktur vollkommen undenkbar. Die Gesellschaften, Wirtschaftssysteme und Regierungsformen, die die Menschheit in den letzten sechs Jahrtausenden hervorgebracht hat, ruhen auf dem Fundament dieser Infrastruktur. Zwar haben Menschen in Nischen jenseits dieser gewaltigen Apparate existiert, einige sogar bis heute, doch es sind die großen urbanen hydraulischen Zivilisationen, die den historischen Fußabdruck der Menschheit geprägt haben. Angesichts der Erderwärmung, die überwiegend dem auf fossiler Energie basierenden Komplex Wasser – Energie – Ernährung anzulasten ist, kollabiert die Zivilisation weltweit. An ihre Stelle tritt ein Neustart der Beziehung des Menschen zur Hydrosphäre des Planeten. Wir lernen einmal mehr, uns an die Anforderungen eines lebendigen, sich ständig verändernden und selbst organisierenden Planeten anzupassen. Die Hydrosphäre spielt dabei eine zentrale Rolle als Regisseur des Lebens. Wir benötigen heute eine Form des Neo-Animismus, basierend auf einer wissenschaftlich und technisch versierten Wiederannäherung an unseren vom Wasser geprägten Heimatplaneten.
Unsere Neuorientierung auf unserem entfesselten Planeten bringt uns zurück zu einer Vorstellung, die westliche Philosophen als »das Erhabene« bezeichnet haben. Der Gedanke geht zurück auf den irischen Denker Edmund Burke und seinen Aufsatz Philosophische Untersuchung über den Ursprung unserer Ideen vom Erhabenen und Schönen aus dem Jahr 1757. Zeitgenossen griffen den Gedanken auf und machten das Erhabene zu einem zentralen Begriff der Aufklärung und der Romantik, der bis heute nachwirkt.
[...]