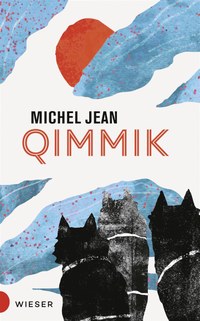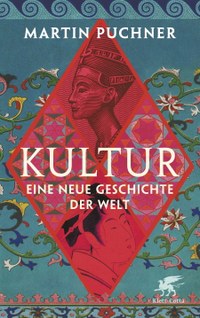Nunavik
Der Himmel, der Felsen, das Meer. Unter einem obszönen Himmel, gegenüber der Arktis, das Eismeer. Nackte Erde. Baumloses Land. Zwischen Brandung und Stille ist der Wind, der Wind des Nordens, uneingeschränkter Herrscher. Sein eisiger Hauch wühlt die Fluten auf, überzieht Land und Wasser mit Schneegestöbern. Die Tundra grollt.
Nirgendwo ist das Leben rauer. Eine seltsame Fauna lebt dort. Im Ozean die fetten Fische, der Narwal – Einhorn des Meeres –, die Robben Grönlands, Klappmützen, grau, gefleckt, bärtig, gewöhnlich. Wale, die achtzehn Meter lang sind und sechzig Tonnen wiegen. Walrosse mit furchterregenden Eckzähnen. An der Küste streift der Eisbär umher, das grimmigste Raubtier des Planeten, und weiter entfernt wandert die große Karibuherde im Wechsel der Jahreszeiten nach Lust und Laune über die trockenen Heiden. Zugvögel kommen hierher, um ihre Eier zu legen. Polarfuchs und Wolf jagen in von Flüssen und riesigen Seen durchzogenen Steppen.
Diese während der langen Wintermonate erstarrte Welt flammt auf zu Beginn ihres kurzen Sommers, und ein eiliges, fiebriges, ausgelassenes Leben explodiert. Es ist rot, ockerfarben, blau, grün, türkis, gelb, orange. Unglaubliche Farben in dieser einfarbigen Welt. Düfte von Blumen und Gräsern wogen in der Luft.
Auf diesem lange vergessenen Kontinent leben die Menschen mit ihren qimmiit, ihren Hunden. Große, starke, ausdauernde und treue Hunde.
Seit fünftausend Jahren hört man Inuktitut und das Gebell der Hunde in Nunavik. Das Leben dort ist grausam. Aber eben das macht es schön. Kostbar.
Seesaibling
Wir haben nur ein Zelt mitgenommen.
»Wir zelten, solange es schön ist«, hat er gesagt. »Wir werden uns später einen Iglu bauen. Wir haben Zeit.« Ich habe seine Unbekümmertheit sofort gemocht. Die Männer meines Flusses kamen mir immer so ernst vor. Man weiß nie, ob man genug Nahrung für den Winter haben wird. Mein Vater hat mir erzählt, dass sein Vater, der alt und verbraucht war, sich in seiner Jugend während einer Hungersnot das Leben genommen hatte, um seinen Anteil an der Nahrung den Jüngeren zu überlassen. »Aber das ist ja schrecklich. Warum hat er das getan?« Die Vorstellung, dass man sich in einer Situation wiederfinden kann, in der ein Älterer so weit geht, sich auf diese Weise zu opfern, erschreckte mich.
»Manchmal, Saullu, kann ein Maul weniger zu stopfen drei Junge retten. Und das Wichtigste, das, was zählt, ist doch, das Überleben der Gruppe zu sichern.«
Ich hätte diesen Großvater geliebt, für den die Liebe zu seiner Familie mehr bedeutete als sein eigenes Leben.
»Komm, wir gehen fischen.«
Er sagte das, als handelte es sich um einen Spaziergang. Ich folgte ihm. Wir gingen an der Felswand entlang, ohne ein Geräusch zu machen, wobei wir uns vor allem bemühten, keinen Schatten auf das Wasser zu werfen.
»Der Fisch hört alles, meine Tochter«, hatte mein Vater mir erklärt, als ich Kind war. »Er kann einen Stein rollen hören, und er sieht alles.«
Ulaajuk hatte seine Lanze mitgenommen, er lief lautlos über die Felsen. Da ich gute Augen hatte, hatte mein Vater mich immer mitgenommen, um ihm zu helfen.
Normalerweise bleiben die Frauen im Lager. Sie haben dort ihre eigenen Aufgaben. Aber ich liebte es, meinen Vater, und jetzt Ulaajuk, zum Fischen zu begleiten.
Ich entdeckte den ersten Fisch. Er bewegte sich langsam unter der Wasseroberfläche. Ich gab Ulaajuk, der ihn ebenfalls gesehen hatte, ein Zeichen. Er stieg hinunter auf einen Felsvorsprung, der über das Wasser ragte, wobei er darauf achtete, den richtigen Winkel einzunehmen, um unsichtbar zu bleiben. Die Lanze flog durch die milde Luft, tauchte ins Wasser ein und bohrte sich ins Fleisch. Die Spitze verbiegt sich, wenn sie ein Ziel trifft, bleibt stecken und hält den Fisch fest. Ulaajuk zog an der Leine, die ihn hielt, befreite den Fisch, einen arktischen Saibling von stattlicher Größe, und warf ihn mir zu. Ich gab ihm den Rest, indem ich ihm mit einem großen Stein auf den Kopf schlug, und wir setzten unsere Jagd fort.
Von meiner erhöhten Position aus hatte ich eine ausgezeichnete Sicht auf den Grund des Sees, und wir machten einen guten Fang. Wenn die Spitze der Lanze über die Haut der Beute glitt, ohne sie zu verletzen, schärfte Ulaajuk sie sorgfältig an einem Felsen, und wir setzten unsere Arbeit fort. Innerhalb einer Stunde hatten wir ein Dutzend Fische gefangen. Das war genug. Ich wickelte sie in eine Haut, und wir brachten unsere Beute ins Lager.
Wir hatten Hunger und teilten uns einen Saibling, den wir roh aßen. Mit der Spitze seines Messers löste er ein Auge heraus und reichte es mir. Lächelnd aß ich es.
Während des Sommers verbreitet die Sonne ihre Wärme über die Taiga. Aber der Boden bleibt kalt, was erlaubt, das Fleisch zu konservieren. Wir versteckten den Rest unseres Fangs unter den Felsen für den Winter, wenn das Wild seltener und das Leben härter wird. Für den Augenblick waren wir am Ufer des Wassers und am Fuß eines Riesen aus Granit unbeschwert. Ich glaube, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich das Gefühl hatte, verliebt zu sein.
Angler
Der Pfad schlängelt sich zwischen großen Bäumen mit zarten Zweigen hindurch, die der Wind sanft schaukelt. Die Sonne taucht hinter den Bergen auf, dringt aber kaum durch das pflanzliche Dach. Zwei Männer laufen, die Rücken gekrümmt wie Schilf, vorsichtig inmitten der Gerüche von nasser Erde. Der Weg ist kurvig und schmal, aber sie kennen jede Biegung, jeden Stein. Ihre Brillen rutschen auf ihren vom morgendlichen Nieselregen nassen Nasen.
Als sie endlich aus dem Unterholz auftauchen, zwingt das grelle Licht die Angler, stehen zu bleiben und ihren alten Augen Zeit zu lassen, sich an die aggressiven Sonnenstrahlen zu gewöhnen. In der Luft liegt der Geruch von Wasser, den alle Angler erkennen. Als sie das Bild endlich klar vor Augen haben, lächeln sie. Seit vierzig Jahren kommen sie hierher, aber es gibt eine Schönheit, der man nie überdrüssig wird.
Die beiden Freunde gehen vorsichtig über verwitterte Steine. Seit Jahrtausenden liefern Wasser und Fels sich hier einen endlosen Kampf. Die Fluten greifen voller Wut die Felsen an, die immer stärker verwittern und schließlich verschwinden, aber wenn das Wasser glaubt, gewonnen zu haben, tauchen neue Blöcke aus dem Boden auf. Ein solcher Kampf dauert natürlich Jahrhunderte, aber die Menschen sehen nur das fließende Wasser. Sie sehen eine Stromschnelle. Manche Phänomene bleiben ihnen verborgen.
Die Angler sind zu einem Ort unterwegs, wo der Fluss um große Felsen herumfließt und die Strömung langsamer wird. Dort ist das Wasser tief, die Lachse ruhen sich gern dort aus. Hier haben sie oft ihre schönsten Exemplare gefangen. Früher ist dieser Fluss wild gewesen, ein Innu-Führer hat ihnen diesen Ort gezeigt. Heute ist er ausgeschildert, und jedes Lachsbecken ist auf einer Karte eingetragen. Außer diesem einen, das den Stammanglern entgangen ist, vermutlich weil man einen langen Weg zurücklegen muss, um zu ihm zu gelangen.
Sie legen ihre Ausrüstung auf einem kleinen Streifen weißen Sandes am Waldrand ab. Martin Lacombe holt seine Thermosflasche heraus und schenkt seinem Freund Luc Fortin heißen Tee ein. Die Gläser klirren. Das Getränk wärmt die verbrauchten Körper der Angler.
Fortin packt seine Ausrüstung aus. Es ist das erste Mal, dass er seine neue, teuer gekaufte Angel benutzt. Tags zuvor hat er lange geübt, um ein Gefühl für sie zu bekommen. Für die Fliegenfischerei braucht man viel Übung, und Angler wie er sind stolz auf ihre Geschicklichkeit.
Bald sausen die Angelschnüre durch die Luft, die Fliegen fliegen anmutig und fallen platschend aufs Wasser. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Angler und Fisch. Ein Spiel für den Menschen, eine Frage von Leben und Tod für das Tier. Die Sonne steigt am Himmel empor, die Lachse weigern sich zu beißen. Nach zwei Stunden legen Fortin und Lacombe ihre Angelruten auf das Ufer und gehen zu dem kleinen Strand, wo sie ihren Imbiss auspacken. Sandwiches mit Schinken und eine Coca-Cola, wie damals, als sie noch arbeiteten und das alles war, wofür sie Zeit hatten. Sich an ihre Jugend zurückzuerinnern gehört zu den Freuden des Alters.
Luc Fortin hat gerade einen großen Bissen Schinken hinuntergeschluckt, als das Seil sich um seinen Hals wickelt. Überrascht verschluckt er sich und erstickt fast. Bevor er reagieren kann, drückt sich das Seil in die Haut seines Halses. Er rollt über den Sand, und sein Gesicht erstarrt in einem merkwürdigen Ausdruck der Überraschung.
Der Angriff hat nur ein paar Sekunden gedauert. Martin Lacombe dreht sich um und sieht seinen Freund auf dem Boden liegen. Erschrocken versucht er aufzustehen, aber das Seil wickelt sich auch um seinen Hals und zieht ihn zu Boden. Er versucht sich mit den Fingern zu befreien, während das Seil sich immer fester zusammenzieht. Hat er Angst? Das alles geschieht viel zu schnell. Er kämpft, aber er wird über den Sand gezogen und bleibt am Fluss liegen. Einen Gewehrlauf auf seiner Stirn, ein Finger am Abzug, er kennt diese Geste. Der Geruch des Flusses ist das Letzte, was er wahrnimmt.
»Qimmik! Qimmik!«
Der Wind spielt in seinem weiß-grau-schwarzen Fell.
Im Sonnenlicht schimmert es rötlich, während er über den menschenleeren Strand läuft und seine großen Pfoten gegen den feuchten Sand trommeln.
»Nicht ins Wasser!«
Der Hund rennt auf die Fluten zu, mit offenem Maul, als wollte er das Meer herausfordern. Man könnte meinen, er lächelt. Er lächelt.
»Qimmik, hierher!«
Das Tier macht einen Satz und teilt in einer Folge wilder Sprünge die Wellen, die sich auf beiden Seiten seines mächtigen Brustkorbs brechen. Seine großen braunen Augen glänzen. Die Kälte kann ihm ebenso wenig anhaben wie die Angst.
Manchmal denke ich bei mir, dass er das unendliche Blau mehr braucht als ich und dass er diese Leere versteht, die ich immer mit Wasser und Salz füllen muss.
Als er endlich zurückkommt, tut er es, weil er es will. Die Tropfen perlen auf seinem dichten Fell. Er läuft über den Strand, seine Muskeln zeichnen sich unter dem Fell ab und wirbeln Sandwolken auf. Das amüsiert ihn.
»Nein, nicht, Qimmik.«
Er springt um mich herum und versucht, an meinem Ärmel zu knabbern, um mich in sein Spiel hineinzuziehen. Seine Verrenkungen machen meine Kleidung nass, und auch wenn ich das hasse, muss ich laut lachen.
Glücklich, mich in seinen Tanz hineingezogen zu haben wälzt er sich auf dem Boden, steht auf und schüttelt sich. Sogar seine Zunge ist mit hellem Sand bedeckt.
Zum Glück habe ich Kleidung zum Wechseln eingepackt. Ich sollte mit ihm schimpfen, aber ich verstehe seine Freude.
»Na komm, mein Großer.«
Qimmik schüttelt sich in einer Wolke aus Tropfen, bevor er mir endlich folgt.
»Wir machen einen Spaziergang, damit du ein bisschen trocknen kannst, du Tollpatsch.«
Über den Strand zu laufen, der Linie zu folgen, die das Hin und Her der Wellen zeichnet, beruhigt mich. Der unendliche Horizont hat immer diese Wirkung auf mich gehabt, die ich im Schatten von Schornsteinen aufgewachsen bin, die diese ockerfarbenen Wolken in den Himmel entließen, die über den Köpfen von uns Kindern schwebten.
Ich lebte an der Mündung eines Flusses und eines Stroms, aber die Bilder von Fabriken, von überfüllten Kais, von rostzerfressenen Schiffen auf Reede bevölkern meine Erinnerungen. Das Wasser meiner Kindheit riecht nach Öl, und wir betrachteten es aus der Ferne, auf den alten, rissigen Betonkais des Hafens von Sorel.
Um zu einer klareren Strömung zu gelangen, musste man sich zu der Inselgruppe zehn Kilometer flussabwärts begeben, die wie ein Filter auf die Fluten wirkt, die der Sankt Lorenz von den Großen Seen mitbringt.
Als Kind stieg ich auf mein Fahrrad, meine Angel auf dem Rücken, und strampelte zum Quai de Sainte-Anne vor den Inseln. Ich fing Flussbarsche, mit etwas Glück manchmal auch kleine gefräßige Hechte. Mit meiner Freundin Manon fuhr ich manchmal die Rivière Richelieu hinauf bis zur Schleuse von Saint-Ours. Wir setzten uns auf den Rasen des hübschen Parks, um unsere Angeln auszuwerfen. Ich liebte es, am Wasser zu sitzen, und träumte von Meeren und Ozeanen.
Der Wind legt sich, der Golf wird schläfrig. Die Sonne dringt durch die Wolken, und das Wasser wird heller. Es ist ein scheues Meer, das seine Geheimnisse für sich behält. Wir beide verstehen uns.
Ich bedaure manchmal, dass ich nicht Medizin studiert habe wie Manon Beauchemin. Ihre Arbeit als Chirurgin erlaubt ihr, Leben zu retten. Das gibt ihrem Leben einen Sinn. Die Justiz schafft das nicht immer. An der juristischen Fakultät brachten unsere Professoren uns bei, dass Justitia blind ist, was ihr erlaubt, alle Menschen gleich zu behandeln. Aber das stimmt natürlich nicht, alle Anwälte wissen das.
Meine Arbeit ist es, dafür zu sorgen, dass die Angeklagten freigesprochen werden. Egal, ob sie unschuldig sind oder nicht. Die Anwälte streiten. Die Blinde entscheidet.
Ich habe einen Freispruch für Kriminelle erreicht und mich sehr stolz gefühlt, obwohl ich wusste, dass sie schuldig waren, weil ich das Wissen angewandt habe, dass die hervorragenden Juristen, die meine Lehrer waren, mir eingetrichtert hatten.
Ich bin eine gute Schülerin, aber manchmal beneide ich Manon. Auf dem OP-Tisch entscheidet das Skalpell. Der Patient lebt oder stirbt. Vor einem Richter ist es grau. Anscheinend gewöhnt man sich mit der Zeit daran.
Viele meiner Freundinnen gehen ins Spa, wenn sie einen Augenblick für sich haben oder ihren Geist auslüften wollen. Ich komme hierher, nach Longue-Rive, an der Cote-Nord. Ich brauche es, den Wind des offenen Meers auf meinem Gesicht zu spüren. Die Touristen ziehen Les Bergeronnes nebenan vor, von wo aus sie Ausflüge machen, um Wale zu beobachten. Oder auch die Innu-Gemeinde Essipit, die ihnen, vermute ich, eine Dosis Exotismus verschafft.
Der Strand von Longue-Rive bildet einen sandigen Halbmond, in den ein ganz kleiner gewundener Fluss mündet, der sich aus Bächen speist und träge zwischen den hohen Gräsern zum Meer fließt. Es gibt hier nichts als Sand, Wasser, den endlosen Himmel und den Wind. Mehr brauche ich nicht.
Gewiegt von der Natur, brauche ich eine Weile, um zu erkennen, dass das merkwürdige Geräusch, das ich höre, das Klingeln meines Handys ist. Niemand ruft mich an, wenn ich hier bin. Es sei denn, es handelt sich um einen Notfall.