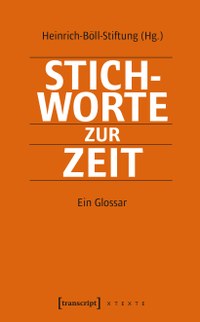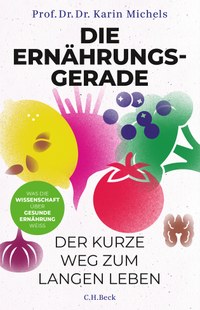Vorwort
Die Heinrich-Böll-Stiftung versteht sich als Institution, die relevante Zeitdiagnosen für ein breites Publikum zugänglich macht. Einen Rahmen für grundsätzliche Orientierung zur Verfügung zu stellen ist eine der vornehmsten Aufgaben politischer Bildungsarbeit. Es ist wichtig, unsere Zeit – und das gilt für Deutschland, Europa und die Welt gleichermaßen – über die spezialisierten Fachdebatten und allgemeinen Spiegelstriche hinaus in den Blick zu nehmen. Wie verändern sich Kultur und Gesellschaft vor unserer Haustür, aber auch jenseits unseres eigenen Milieus? Grundsätzliche Orientierungsdiskurse, das Zurücktreten aus dem Alltag und die Reflexion über die prägenden Entwicklungen unserer Zeit sind hochwillkommen und nachgefragt.
Dieses Buch basiert auf unserer Vortragsund Diskussionsreihe »Auf der Höhe – Diagnosen zur Zeit«. Zwischen 2013 und 2020 haben Intellektuelle aus verschiedenen Perspektiven aktuelle Trends und Begriffe vorgestellt und beleuchtet. Das Emblem der Veranstaltungsreihe war dabei ein »Hochsitz«, wie er etwa einer Waldspaziergängerin begegnet. Der Hochsitz steht symbolisch für den Abstand, den es zu gewinnen gilt, die Distanz zum Getümmel der täglichen Routinen und Meldungen und die nachdenkliche Ruhe des Überblicks. Zeitdiagnose sollte sich als Ausgangspunkt für Diskussionen, nicht als Monolog verstehen. Zu einer entsprechenden Diskussion möchte das vorliegende Glossar mit 26 Stichworten in seiner Vielstimmigkeit einladen.
Ein besonderer Dank für dieses Projekt geht an Peter Siller, der bis 2020 als Leiter der Abteilung Inland das Thema Zeitdiagnose vorangetrieben und in der Heinrich-Böll-Stiftung etabliert hat. Seit 2017 hat Ole Meinefeld als Referent für Zeitdiagnose & Diskursanalyse das Themenfeld, die Vortragsund Diskussionsreihe und damit auch das vorliegende Buch entscheidend geprägt. Ihm danken wir an dieser Stelle für die kompetente und verantwortungsvolle Kompilation und Redaktion der Beiträge. Für die umfassende Unterstützung der Referatsarbeit danken wir zudem Stephan Stoll, Christine Weiß und Tobias Heinze sowie – für das sorgsame Lektorat – Bernd Rheinberg.
Der entscheidende Dank jedoch gebührt allen Autorinnen und Autoren, die zu diesem Band beigetragen haben, und nicht zuletzt allen Gästen, die in unseren öffentlichen Veranstaltungen zur Zeitdiagnose ebenso angeregt wie anregend mitdiskutiert haben.
Berlin, im Sommer 2020
Dr. Ellen Ueberschär, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung
Was heißt »Zeitdiagnose«?
Anmerkungen zu einem nachgefragten Genre
von Peter Siller und Ole Meinefeld
Der Schmale Grat der Zeitdiagnose
In Zeiten des Umbruchs und der Ungewissheit wächst das Bedürfnis, besser verstehen zu wollen, in welcher Zeit wir eigentlich leben. Dabei gibt es nichts Schwierigeres, als das unmittelbare »Jetzt« verstehen zu wollen, es in der Zeit einzuordnen. Die Diagnosen der eigenen Zeit kommen, entsprechend Hegels geflügeltem Wort von der »Eule der Minerva«, die ihren Flug erst in der Dämmerung ansetzt, gewissermaßen immer zu spät. Erst in der Retrospektive wird sichtbar, worin wir leben – und was vor uns liegt. Gegenüber dem, was »ist«, und dem, was wir »sind«, können wir nur distanzlos sein – zumal, wenn es auf neuen Entwicklungen beruht.
Auf die Möglichkeit von Zeitdiagnosen zum »Jetzt« zu setzen, heißt dann – von der philosophisch-spekulativen Frage nach dem Status dieses »Jetzt« einmal abgesehen –, Dinge aus dem Rückbezug neu zu betrachten. Was wir über dieses »Jetzt« bei allen Einschränkungen sagen können, sind Dinge, die als latente Entwicklungen und Prognosen schon da waren und sich heute neu und anders zeigen. Dabei bedeutet die gedankliche Verlängerung in die
Zukunft beides: eine möglichst realistische Einschätzung von wahrscheinlichen Entwicklungen ebenso wie die normativ geleitete Spekulation, die Gefahren und Chancen herausarbeitet.
Die Probe aufs Exempel:
Zeitdiagnose in Zeiten der Corona-Pandemie
Verstanden als Neubetrachtung im Rückbezug ist es mehr als lohnenswert, sich im Zuge der Verunsicherung durch die Corona-Pandemie nochmals mit den Zeitdiagnosen zu befassen, die den Jahren dieses Einschnitts vorausgingen. Denn so richtig es ist, dass in jeder echten Krise etwas Neues, Unbekanntes hinzukommt, so zutreffend ist es, dass Krisen oftmals Katalysatoren für die Entwicklungen sind, die bereits zuvor beschrieben wurden.
Die Corona-Pandemie wurde in den ersten Monaten des Jahres 2020 mit Blick auf vielfältige Konsequenzen zu Recht als »Zäsur« bezeichnet. Doch die Corona-Pandemie hebelt damit keineswegs die Relevanz zeitdiagnostischer Anstrengungen aus, die sich vorgängig mit Entwicklungen befasst haben, die gerade durch die Krise of fen zutage treten. Der Umgang mit alternativen Fakten beispielsweise ist nicht neu, wie Rainer Forst in seinen Überlegungen zur Wahrheit in diesem Band unterstreicht, aber seine Dringlichkeit zeigt sich gerade in der aktuellen Konjunktur der Verschwörungstheorien. Welche Relevanz die Geschichte einer anti-demokratischen Querfront gegenwärtig hat, aktualisiert die umsichtige Genealogie dieser Querfrontbewegung von Volker Weiß. Wie sehr in einem Shutdown des öffentlichen Lebens die Fragen der Familienorganisation drängen, verdeutlicht besonders Christina von Brauns Beitrag über Patchwork – um hier nur einige der im Glossar vertretenen Diagnosen zu nennen.
Dabei führt die Frage nach der Zeitdiagnose in der Corona-Pandemie auch auf eine Re-Aktualisierung des Verhältnisses zwischen dem Politischen in einem normativen Sinn und der Wissenschaft als empirischer Disziplin. Politische Praxis (und Theorie) ist auf empirische Wissenschaft angewiesen. Die Antwort auf das gesellschaftliche Wollen und Sollen kann Letztere nicht geben und auch nicht beanspruchen. Zugleich sind es auch in der Wissenschaft selbst der Pluralismus und die Kontroverse, die Erkenntnisfortschritte möglich machen. Im Zuge der Corona-Pandemie sehen wir deutlicher als zuvor: Die Idee einer Gesellschaft, die evidenzbasiert entscheidet und deren Organisation auf wissenschaftlichen Tatsachen beruht, stößt an ihre Grenzen, wenn es um eine grundsätzliche Orientierung geht. Sein-Sollen-Schlüsse aus vermeintlich »reinen Fakten« verbieten sich für eine Zeitdiagnose, die Orientierung zwischen den Handlungsoptionen bieten und nicht auf eine Sachzwang-Argumentation zurückfallen will.
In der aktuellen Debatte um den Umgang mit der Corona-Pandemie werden von den einen Argumentationen vorgetragen und verstärkt, die bereits vor der Corona-Pandemie prägend waren. Für andere steht die Theorie jetzt, in der Corona-Pandemie, quasi am Nullpunkt, und es gelte, die althergebrachten Orientierungen und Begriffe zu suspendieren. Während es für die einen jetzt eher um die Aktualisierung von normativen Gewissheiten geht, wird von den anderen eine allerneueste Unübersichtlichkeit diagnostiziert.
Armin Nassehi meint zum Beispiel, der »Flickenteppich« von Maßnahmen korrespondiere mit einem »Flickenteppich« von Diagnosen, der Ausdruck einer neuen Konstellation sei: Die Komplexität lädt dazu ein, radikal neu zu sortieren und dafür das, »was wir an den Universitäten in Hauptseminaren seit Jahren lehren«, als »Entscheidungen unter Unsicherheit« auch gesellschaftlich-politisch zu akzeptieren.1 Für Joseph Vogl ist es sogar so, dass unter dem praktischen Entscheidungsdruck die politisch-öffentliche Debatte »mögliche oder wahrscheinliche Aussichten dramatisiert, um im Unübersichtlichen übersichtliche Handlungsoptionen zu gewinnen«.2 Aus dieser Perspektive wirkt die Forderung nach normativer Orientierung, die politische und zivilgesellschaftliche Vorschläge und Abwägungen leitet, beinahe rückwärtsgewandt.
Dem normativen Orientierungsbedürfnis wird von anderer Seite Rechnung getragen, wenn etwa die Pandemie als der »letzte Sargnagel für den Neoliberalismus« (Marcel Fratzscher) oder als »Krise einer Lebensform« der reinen ökonomischen Effizienz (Rahel Jaeggi) gesehen wird.3 Möglicherweise manifestiert sich in den unmittelbaren Reaktionen von Menschen auf die Krise sogar eine Rückkehr der Solidarität, die mehr sein könnte als eine Taktik von Egoisten in der Krise (Heinz Bude).4
Gelungene Zeitdiagnose verbindet nicht nur das Normative und das Deskriptive, sie verbindet auch die Frage nach dem Bisherigen mit der Frage nach dem Neuen. Sie schreibt nicht linear fort, und doch schöpft sie zugleich aus bisherigen Erkenntnissen.
Was sich neu zeigt, war auch vorher schon da und zeigt sich zugleich auf andere Weise: Die Grenzen der Marktförmigkeit im Gesundheitssystem werden unter dem Druck der Pandemie anders sichtbar. Für soziale Teilhabe entscheidende Institutionen wie Kitas und Schulen, Bibliotheken und Jugendzentren werden allenthalben nach der Schließung vermisst und führen durch ihr Fehlen (möglicherweise) zu mehr Einsicht, welchen Stellenwert sie für ein selbstbestimmtes Leben schon vorher hatten. Die Begegnung im öffentlichen Raum wird in ihrer Relevanz für unser Leben nur umso deutlicher, wenn sie zeitweise eingeschränkt werden muss. Die fundamentale Bedeutung von Infrastrukturen tritt uns in der Krise vor Augen, von den Krankenhäusern bis zu den Internetkabeln.5
Die Corona-Pandemie wird so zum Brennglas für Entwicklungen und Zusammenhänge, deren Diagnose neu und anders möglich geworden ist. Für die Aufgabe der Zeitdiagnose wird hierbei klar, dass Normen und entsprechende Gesellschaftsbilder aktualisiert werden müssen. Wenn es um die öf fentliche Rezeption von empirischer und deskriptiver Wissenschaf t in freiheitsbewahrender Absicht gehen soll, brauchen wir eine nicht nur durch wissenschaftliche Empirie informierte, sondern ebenso an normativer Theorie interessierte Zeitdiagnose. Somit erwächst der Philosophie, den Kulturund Sozialwissenschaften sowie der Literatur die besondere Aufgabe, diese Reflexion immer wieder zu realisieren.
Eine Gattung, viele Ansätze – Jenseits von Großtheorie und Einzelfallbetrachtung
»Zeitdiagnose« hat sich über die Jahrzehnte als eigene, meist soziologische Textgattung etabliert. Sie versucht – jenseits von Großtheorie und Einzelfallanalyse – in zugespitzter Weise grundlegende Merkmale der zeitgenössischen Gesellschaft herauszuarbeiten. In der Regel hebt sie dabei eine bestimmte Entwicklung oder ein einzelnes Prinzip der gesellschaftlichen Gegenwartsordnung heraus und erhält dadurch ihre Prägnanz.6 Sie bezieht ihre Dringlichkeit aus ihrer Aktualität, ihrer Gegenwärtigkeit, beruht aber gleichzeitig in aller Regel auf einer Entwicklungsthese, die aus der Vergangenheit rührt und in die Zukunf t weist. Zwar scheint der Sinn von Unternehmen begrenzt, die eine »Methode«7 oder gar eine »Logik der Zeitdiagnose«8 postulieren, aber einige unvollständige Überlegungen zu den unterschiedlichen Arten von Zeitdiagnose lassen sich durchaus anstellen.
Von Zeitdiagnosen kann als einer Gattung gesprochen werden, die sich in vielen unterschiedlichen Ansätzen ausprägt. Verschiedene Arten von Zeitdiagnosen lassen sich dabei auf mehreren Achsen verorten. Zunächst einmal kann zwischen spekulativen Ansätzen, die unterschiedliche Möglichkeiten der Realität aufzeigen wollen, und empirischen Ansätzen, die sich ganz auf Daten und Erhebungen stützen, unterschieden werden. In der Regel ergeben sich hier Mischverhältnisse. Entsprechend finden sich eher deduktive Herangehensweisen, in denen die Beobachtungen (die möglicherweise empirisch überprüft werden könnten) sauber in eine vorgegebene These eingepasst werden, und induktive Ansätze, die zwar bestimmte Schlüsse und Folgerungen erlauben, sich aber kaum zu einer prägnanten These verdichten.
In ähnlicher Weise lassen sich auch deskriptive und normative Anliegen von Zeitdiagnosen unterscheiden. Schließlich kann eine Diagnose deskriptiver Art dazu aufrufen, nicht mehr, wie gehabt, vom festen Urteil etwa über eine Generation auszugehen und stattdessen neu darüber nachzudenken. Sie kann aber genauso die gesteigerte Relevanz bestimmter Emotionen beschreiben – wie im Fall von Heinz Budes These zur Angstgesellschaft,9 die schwerlich ganz von der Intuition zu trennen ist, dass eine Neubesinnung auf Solidarität die normative Antwort der Stunde sein könnte. Solche explizit auf normative Orientierungsvorschläge oder bisweilen gar konkrete Handlungsanweisungen hinauslaufende Zeitdiagnosen sind dann nicht nur Diagnose zum Status quo, sondern stets ein Vorgriff auf eine andere Welt. Sie enthalten einen spekulativen Teil. Im letzteren Fall gibt es Überschneidungen zu konkreten Utopien, deren Auftreten und darauffolgendes Verschwinden keineswegs zur grundsätzlichen Widerlegung taugen muss. Solche Utopien können genauso als »Possibilismus«10 historisch rekonstruiert werden, als Sequenz von sich einander ablösenden Zukunftsentwürfen.
Als Analyseform, die sich – unter einem bestimmten Aspekt – auf die ganze Gesellschaft bezieht, hat die Zeitdiagnose das Potential, zum öffentlichen Diskurs über die fragmentierten Einzelteile hinaus und damit zur »Selbstaufklärung der Gesellschaft« beizutragen. Als verallgemeinernde und zugleich veranschaulichende Betrachtung taugt sie für gesellschaf tliche und politische Orientierungsdebatten, die sich weder in großtheoretischer Abstraktion verf lüchtigen noch in fachlichen Spiegelstrichen verzetteln. Sie vermag es, über die Beschreibung von Brüchen Aufmerksamkeit und Neugierde zu wecken, weil »das Beständige keinen Nachrichtenwert hat«11. Als Aufruf zur Gegenwartsbefassung erinnert sie uns daran, die Fragen nach Vergangenheit und Zukunft auf das Hier und Jetzt zu beziehen, anstatt sich in historischem oder utopischem Eskapismus einzurichten.
Das Verhältnis politisch-intellektueller Grundströmungen zur Zeitdiagnose
Nun ist es nicht so, dass die idealtypischen Ausprägungen von Zeitdiagnosen stets gleichermaßen vertreten oder gefragt wären. Es bleibt schließlich umstritten, was jeweils zur gegebenen Zeit zur »Selbstaufklärung der Gesellschaft« beiträgt. Schon Jürgen Habermas hat diese Thematik in seiner Einleitung zu den »Stichworten zur geistigen Situation der Zeit«12 aufgeworfen und nach der Verortung von Intellektuellen in ihrer Zeit gefragt. Immerhin beanspruchte er seinerzeit, eine Kompilation »der Linken« zu versammeln, bei aller Vielstimmigkeit. Wer hier veröffentlichte, bezog Stellung, trotz aller Fragmentierung.
Die politische Linke ist über vierzig Jahre nach den von Habermas kompilierten »Stichworten« nicht minder fragmentiert und trifft sich am ehesten in Krisendiagnosen. Auch die Beiträge im vorliegenden Glossar greifen selbstverständlich Krisenphänomene und Bruchlinien von Kultur und Gesellschaft in unserer Zeit auf, wie Gentrifizierung (Martin Kronauer), Neofeudalismus (Sighard Neckel) oder Burnout (Greta Wagner und Friedericke Hardering), aber sie legen an zahlreichen Stellen eben auch ein Augenmerk auf Chancen zur Entwicklung – durchaus als Kontrapunkt, sei es in der Verteidigung der Fortschrittsidee in Zeiten der Regression (Rahel Jaeggi), sei es im Spiegel der popkulturellen Figuren wie den Superhelden (Jens Balzer) oder im Hinweis darauf, wie Humor (Benedikt Porzelt) unser Verhältnis zur etablierten Politik entkrampfen kann.
Wo sie nicht mit einfachen Antworten aufwartet, macht gelungene Zeitdiagnose es sich selbst und dem Publikum in der Regel nicht leicht: sie beschreibt strukturelle Probleme und Gefahren ebenso, wie sie Potentiale und Chancen aufzeigt, auf die sich auf bauen lässt. Alles andere wäre eine Unterforderung. In einer Gesellschaft, in der angeblich »alles den Bach runtergeht«, ist ein Auftritt als »Ankläger« und »Retterin in der Not« einfach zu haben.
Vielleicht boomt Zeitdiagnose paradoxerweise besonders dann, wenn die Umstände eher geordnet und übersichtlich erscheinen und ihre Dringlichkeit deshalb vielleicht nicht ganz so groß ist. In den 1970er-, 1980erund auch in den 1990er-Jahren gab es unzählige »Gesellschaf tsdiagnosen«, die es in kurzer Zeit ins Repertoire politischer Zeitgeist-Begriffe schafften: Diese reichen von der »Kommunikations-« (Richard Münch), »Netzwerk-« (Manuel Castells), der »Risiko-« (Ulrich Beck), »Erlebnis-« (Gerhard Schulze), »Verantwortungs-« (Amitai Etzioni), »Multioptions-« (Peter Gross), »Konsum-« (Guy Debord) bis zur »nachindustriellen Gesellschaft« (Daniel Bell).13 Ob dieser Vielzahl der Selbstbeschreibungen stellte Fran Osrecki der Gegenwart pointiert die Diagnose einer »Diagnosegesellschaft«.14
Heute, wo nicht nur Corona uns beschäftigt, sondern innerhalb weniger Jahre vieles unklar und instabil geworden zu sein scheint, geraten repräsentative Demokratie und die offene Gesellschaft von verschiedenen Seiten unter Druck. Die etablierten regressiven Zeitdiagnosen fahren bestärkt und routiniert fort – und der Applaus der Identitären, Anti-Modernisten und Demokratieverächter bestärkt sie.
Es mag diese »neueste Unübersichtlichkeit« sein, die die Zeitdiagnose dazu bringt, sich derzeit weniger auf die äußeren, strukturellen Verhältnisse zu beziehen, sondern eher auf die gesellschaftlichen Stimmungen.15 Es ist eher die Angst in der Gesellschaft, die gerade im Zentrum der Diagnosen steht – und wiederum ihr Gegenteil, das »Glück«, etwa als »Bruttosozialglück«.16 Dabei diagnostiziert Zeitdiagnose nicht unbedingt nur die gesellschaftlichen Emotionen. Vielmehr erzeugen und bestärken sie diese selbst, indem Diagnosen auf diese Weise Emotionen verallgemeinernd in den Mittelpunkt rücken. Das geschieht nicht erst in Folge des digitalen Zerfaserns von Öffentlichkeit in einzelne »Echoräume«. In diesem Zug erscheint auch die Subjektivierung des Politischen – verbunden mit der allgemeinen Forderung von »Empörung« und »Haltung« – als problematischer Trend. Zeitdiagnose sollte aber die Aufgabe von Beschreibungen des gesellschaftlichen Strukturwandels nicht aus dem Blick verlieren. Bei einer solchen Ausrichtung an den gesellschaftlichen Strukturen kommt die normative Grundierung von Zeitdiagnosen dann stärker über die Themenwahl zum Ausdruck.
Mehr als ein Sowohl-als-auch
Zeitdiagnose ist in der Politik eine stark nachgefragte Ware, und das nicht nur aufgrund ihrer Zuspitzung, über die sich in politischer Kommunikation Komplexität reduzieren lässt. So gesehen lässt sich die Nachfrage auch durchaus marktförmig interpretieren.17 Doch damit wird eine entscheidende Nachfrage übersehen, die sich gerade nicht aus dem subjektiven Bedürfnis der Leserinnen und Leser speist, sondern vielmehr auf einen Bedarf verweist, politische Orientierungen durch eine Interpretation der eigenen Zeit zu begründen und anzureichern. Denn die Frage, in welcher Welt wir gerade leben, bildet den Ausgangspunkt für Schwerpunktsetzungen, für die Dringlichkeit von Maßnahmen, von Aufarbeitungen und von Besinnung auf die nächsten und übernächsten Schritte. Und die Antworten sind oft schnell zur Hand und in ständiger Verwendung. Von der »digitalen« bis zur »postfaktischen« Gesellschaft, vom »postdemokratischen« bis zum »postsäkularen« Zeitalter. Wer möchte sich schon vorwerfen lassen, mit seinen politischen Vorschlägen nicht mit beiden Beinen in der Gegenwart zu stehen, nicht »up to date« zu sein.
Im schlechtesten Fall handelt es sich dabei mehr um publizistischen Zeitgeist als um Zeitdiagnose, der allerdings durchaus die Kraft hat, sich im politischen Sprachgebrauch zu verfestigen. Was ist »danach«? An den beliebten zeitdiagnostischen Präfixen »post-«, »spät-« oder »nach-« erkennt man bereits die Schwierigkeit der Aufgabe: Man hat den Eindruck, dass etwas zu Ende geht – die Demokratie, der Kapitalismus, das Säkulare –, hat aber gar keinen Begriff für das, was stattdessen der Fall ist. Das kann dafür sprechen, dass sich darin eher eine Hoffnung auf Veränderung als eine Diagnose artikuliert. Interessant ist jedenfalls, dass die gängigen Begriffe, um eine »Gesellschaft«, eine »Generation« oder einen »Trend« zu beschreiben, oftmals nicht viel überzeugender wirken als ihr plakativ formuliertes Gegenteil. Und das ist vielleicht auch kein Wunder, denn oft ist es ja so, dass eine gesellschaftliche Entwicklung gleichzeitig eine gegenläufige Entwicklung initiiert oder befördert. Und so leben wir am Ende eben tatsächlich in einer Zeit der »Globalisierung« und der »Renationalisierung«, der »Digitalisierung« und der »Rückkehr des Analogen«, der »Individualisierung« und der »Vergemeinschaftung«, der »Säkularisierung« und der »Rückkehr der Religion« usw. – Es ist die Gleichzeitigkeit der modernen Gegenwart, die die große rhetorische Figur des »en même temps« (Emmanuel Macron) durchaus rechtfertigt. Einerseits, andererseits.
Fraglich ist allerdings auch hier, ob das Sowohl-als-auch reicht, um zur größtmöglichen Orientierung beizutragen. Denn zum einen sind gegenläufige Diagnosen in ihrer Breite und ihrem Einfluss so unterschiedlich, dass eine bloße Addition wenig Orientierung bietet. Zum anderen sind oftmals die interessantesten Zeitdiagnosen solche, in denen sich Entwicklungen nicht einfach dichotom gegenüberstehen, sondern in denen diese die wirklich zentralen Entwicklungslinien des »Zeitgeschehens« sichtbar werden lassen. Sie machen Konfliktkonstellationen und die Logik von gesellschaftlichen Bewegungen lesbar, indem sie Gegenbewegungen einbeziehen. Solche Diagnosen erlauben, die sich daraus entspinnenden Möglichkeitsräume neu zu kartieren. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag, um bei einer zeitdiagnostischen Orientierung von der bloßen Addition zu einer Anordnung zu kommen, die zumindest dort gefragt ist, wo Zeitdiagnosen auf konkrete Handlungsoptionen hin ausgerichtet werden. Man kann hier auch von der »Deutungsmacht«18 von Zeitdiagnosen sprechen. Es zählt zu den zentralen Rechtfertigungsfiguren der politischen Praxis, Veränderungsoder Reformbedarfe aus der Notwendigkeit einer veränderten Welt zu begründen. Es muss etwas anders werden, weil die Welt eine andere ist. Zeitdiagnosen können so auch Angebote solcher Ist-Beschreibungen liefern, aus denen ein anderes Sollen abgeleitet wird.
»Auf der Höhe – Diagnosen zur Zeit«
Die Heinrich-Böll-Stiftung befragte in der Vortragsreihe Auf der Höhe – Diagnosen zur Zeit in den letzten Jahren Intellektuelle zu aktuellen gesellschaftsund kulturdiagnostischen Stichworten: von A wie »Authentizität« bis Z wie »Zombie«. Ziel war es, prominente und relevante Diagnosen unserer Zeit zu versammeln, aber genauso – über das Zufallsprinzip der alphabetischen Reihung generiert – neue Perspektiven auf die Gegenwart jenseits des etablierten Vokabulars zu suchen.
Entstanden ist dabei eine Art Glossar mit Stichworten unserer Zeit. Dabei war stets klar, dass sich Zeitdiagnose nicht aus einer einzigen Perspektive betreiben lässt. Gerade weil sie perspektivisch ist, bedarf es der Kombination verschiedener Perspektiven – und damit verschiedener Diagnosen. Die breit angelegte Darstellung und Reflexion gegenwärtiger Zeitdiagnose speist sich aus vielen Segmenten. So wenig, wie es also um die Einheit einer Art Disziplin der Diagnose gehen kann, so wenig handelt es sich einfach um »eine Zeit«, die hier verhandelt wird. Vielmehr geht es um Sequenzen einer Zeit, in der sich Begriffe, Ereignisse und Diskurse aus mehreren Jahren ergänzen, überlagern und befruchten können.
–––––––––––––––––––––
Anmerkungen
1 Philipp May: »Unglaublich schwierig, politisch die richtige Entscheidung zu treffen.« Interview mit Armin Nassehi, in: Deutschlandfunk (22.04.2020), https://www. deutschlandfunk.de/dynamik-in-der-coronadebatte-unglaublich-schwierig.694. de.html?dram:article_id=475201, zuletzt aufgerufen am 12.05.2020.
2 Tomasz Kurianowicz: »Die Moral interveniert, wenn man nicht weiter weiß.« Interview mit Joseph Vogl, in: Welt online (23.04.2020), https://www.welt.de/kultur/plus207440963/ Joseph-Vogl-Die-Moral-interveniert-wenn-man-nicht-weiterweiss.html, zuletzt aufgerufen am 12.05.2020.
3 »Der letzte Sargnagel für den Neoliberalismus«, in: Spiegel.de (30.04.2020), https://www. spiegel.de/wirtschaf t/corona-krise-diw-chef-marcel-fratscher-sieht-sargnagel-fuerden-neoliberalismus-a-9498047e-9d8d-4c1a-a88d-9f688962d3e4, zuletzt aufgerufen am 12.05.2020; Rahel Jaeggi: Schluss mit dem TINA-Prinzip. In: Philosophie Magazin On line, 09.04.2020, https://philomag.de/schluss-mit-dem-tina-prinzip/, zuletzt aufgerufen am 12.05.2020.
4 Heinz Bude: Solidarität. Die Zukunf t einer großen Idee, München 2019.
5 Vgl. dazu Heinrich-Böll-Stif tung (Hg.): Öf fentlicher Raum! – Politik der gesellschaf tli-
chen Teilhabe und Zusammenkunf t, Frankfurt am Main/New York 2020.
6 Uwe Schimank: »Zeitdiagnose, soziologische«, in: Werner Fuchs-Heinritz u.a. (Hg.), Lexi-
kon zur Soziologie, 5. Auflage, Wiesbaden 2013, S. 765.
7 Walter Reese-Schäfer: Deutungen der Gegenwart. Zur Kritik wissenschaf tlicher Zeitdia-
gnostik, Stuttgart 2019.
8 Jo Reichertz: Ein Pfeil ins Blaue? Zur Logik sozialwissenschaftlicher Zeitdiagnose. In:
Gegenwärtige Zukünfte. Hg. v. Ronald Hitzler u. Michaela Pfadenhauer, Wiesbaden
2005, S. 45-54.
9 Heinz Bude: Gesellschaf t der Angst, Hamburg 2014.
10 Joachim Radkau: Geschichte der Zukunf t: Prognosen, Visionen, Irrungen in Deutschland
von 1945 bis heute, München 2017.
11 Jürgen Kaube: Auf dem Jahrmarkt der Zeitdiagnosen, in: FAZ online (aktualisiert am
05.01.2013), https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/bilder-und-zeiten/essay-auf-dem-
jahrmarkt-der-zeitdiagnosen-12014592.html, zuletzt aufgerufen am 12.05.2020.
12 Jürgen Habermas: Stichworte zur geistigen Situation der Zeit, Frankfurt am Main 1979.
13 Richard Münch: Dynamik der Kommunikationsgesellschaft, Frankfurt am Main 1995;
Manuel Castells: Das Informationszeitalter. Die Netzwerkgesellschaft, Opladen 2001; Ulrich Beck: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt am Main 1986; Gerhard Schulze: Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart, Frankfurt am Main 2005; Amitai Etzioni: Die Verantwortungsgesellschaft. Individualismus und Moral in der heutigen Demokratie, Frankfurt am Main/New York 1997; Peter Gross: Die Multioptionsgesellschaft, Frankfurt am Main 1994; Guy Debord: Die Gesellschaf t des Spektakels, Berlin 1996; Daniel Bell: Die nachindustrielle Gesellschaf t, Frankfurt am Main/New York 1985.
14 Fran Osrecki: Die Diagnosegesellschaf t: Zeitdiagnostik zwischen Soziologie und medialer Popularität, Bielefeld 2011.
15 Heinz Bude: Das Gefühl der Welt. Über die Macht von Stimmungen, München 2016.
16 Heinz Bude: Gesellschaft der Angst, a.a.O.; Annette Jensen: Wir steigern das Bruttosozialglück: Von Menschen, die anders wirtschaften und besser leben, Freiburg im Breisgau 2011; Petra Pinzler: Immer mehr ist nicht genug! Vom Wachstumswahn zum Brutto-
sozialglück, München 2011.
17 Jürgen Kaube: Auf dem Jahrmarkt der Zeitdiagnosen, in: FAZ online (aktualisiert am
05.01.2013), https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/bilder-und-zeiten/essay-auf-dem-
jahrmarkt-der-zeitdiagnosen-12014592.html, zuletzt aufgerufen am 12.5.2020.
18 Heiner Hastedt (Hg.): Deutungsmacht von Zeitdiagnosen. Interdisziplinäre Perspektiven, Bielefeld 2019.
Dr. Sebastian Bukow Leiter der Abteilung Inland der Heinrich-Böll-Stif tung